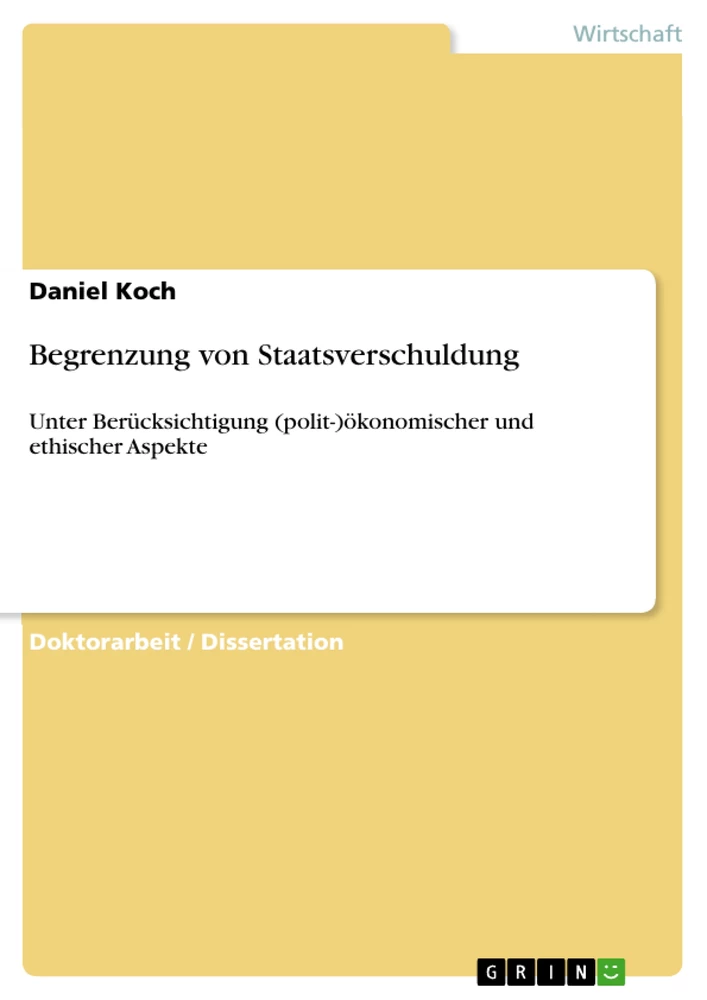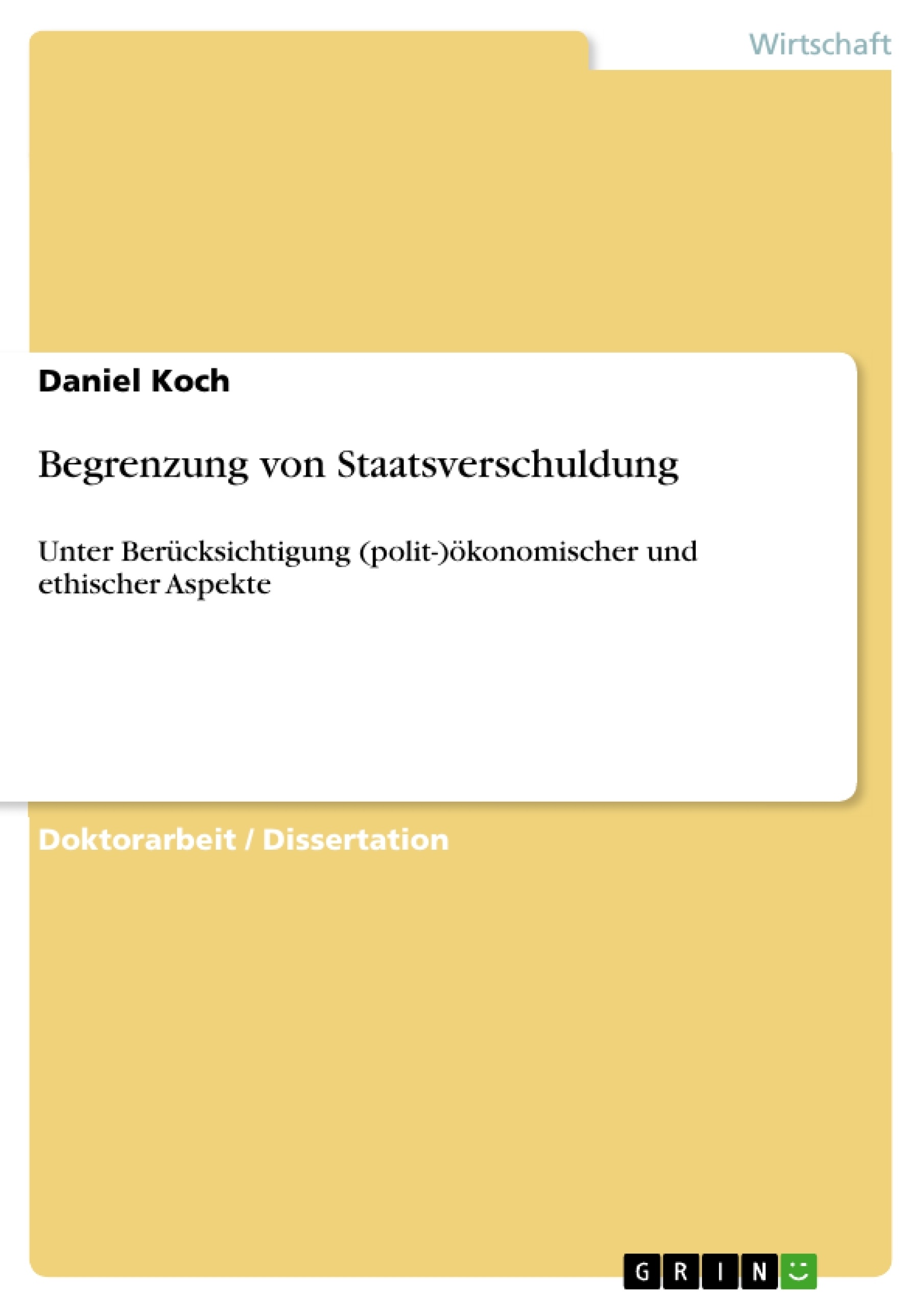In den letzten Jahrzehnten griff die Staatsverschuldung in den meisten westlichen Staaten um sich wie ein wucherndes Krebsgeschwür. Die Ereignisse im Zuge der Euro-Krise haben ein Schlaglicht auf die Gefahren dieser Entwicklung geworfen.
Diese Arbeit untersucht die Frage, wie sich Staatsverschuldung wirksam begrenzen lässt, wann dies nötig ist und welche Komponenten dafür berücksichtigt werden sollten. Sie betrachtet verschiedene Ansätze zur Begrenzung von Staatsverschuldung, evaluiert sie, und versucht aus ihren Stärken und Schwächen eine verbesserte Begrenzungsregel abzuleiten. Schließlich untermauert sie die gesellschaftliche Akzeptanz und Relevanz ihres Vorschlags, indem sie die Notwendigkeit und die mögliche Ausgestaltung einer Begrenzungsregel nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet, sondern auch eine normative Untersuchung vornimmt. Die erarbeiteten Evaluierungskriterien und Vorschläge sollen gleichermaßen mit ethischen und ökonomischen Anforderungen vereinbar sein.
Es wird gezeigt, dass Staatsverschuldung aus Effizienzgründen wie auch aus ethischen Überlegungen begrenzt werden sollte. Sie zeigt, dass es ohne ein entsprechendes Reglement immer wieder zu einem staatsverschuldungsförderndem Politikversagen kommt. Andererseits teilt diese Arbeit aber nicht den weit verbreiteten Defätismus, dass der Kampf gegen die ansteigende Verschuldung aussichtslos sei. Vielmehr wird ein Vorschlag erarbeitet, wie sich dieses Politikversagen aushebeln und solide Staatsfinanzen erzwingen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Theorie der Staatsverschuldung
- Definition und Abgrenzung
- Explizite Verschuldung
- Implizite Verschuldung und Generationenbilanzen
- Nachhaltigkeitsbegriff und Tragfähigkeit
- Staatsvermögen - „Goldene Regel“ der Staatsverschuldung
- Für diese Arbeit relevanter Verschuldungsbegriff
- Rechtfertigungsgründe
- Die Stabilisierungsfunktion: Konjunkturpolitik
- Die Überbrückungsfunktion: Steuerglättung
- Die Lastenverschiebungsfunktion: Pay as you use
- Besondere Ereignisse
- Weitere Aspekte
- Auswirkungen
- Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen und intergenerative Umverteilung
- Staatschuldneutralität
- Fiskalische Folgen
- Intragenerative Verteilungswirkung
- Politische Auswirkungen
- Politische Ökonomie der Staatsverschuldung
- Staatsverschuldung und Wettbewerb auf politischen Märkten
- Warum es immer wieder zu Defiziten kommt
- Wann solide Finanzpolitik doch möglich ist
- B. Normative Aspekte der Staatsverschuldung: Die Theorie der katholischen Soziallehre
- Zur Nützlichkeit einer normativen Analyse
- Grundlagen der katholischen Soziallehre
- Aussagen der katholischen Soziallehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Staatsverschuldung wirksam begrenzt werden kann, unter Berücksichtigung sowohl (polit-)ökonomischer als auch ethischer Aspekte. Ziel ist es, einen umfassenden Ansatz zur nachhaltigen Bewältigung der Staatsverschuldung zu entwickeln, der die Interessen der Gegenwart und der Zukunft gleichermaßen berücksichtigt.
- Theoretische und praktische Aspekte der Staatsverschuldung
- Die Rolle der katholischen Soziallehre in der Analyse der Staatsverschuldung
- Politische und ökonomische Mechanismen, die zu Staatsverschuldung führen
- Inter- und intragenerative Verteilungswirkungen von Staatsverschuldung
- Möglichkeiten zur Vermeidung und Begrenzung von Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Staatsverschuldung ein und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen europäischen Schuldenkrise. Der Autor erläutert die Ziele und die methodische Vorgehensweise der Arbeit.
- Definition und Abgrenzung der Staatsverschuldung: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten der Staatsverschuldung definiert und voneinander abgegrenzt, darunter explizite und implizite Verschuldung, Schuldenstand und Schuldenstandsquote, Neuverschuldung und Defizitquote. Der Autor erläutert verschiedene Ansätze zur Messung der impliziten Verschuldung, insbesondere den OECD-Ansatz und Generationenbilanzen.
- Rechtfertigungsgründe für Staatsverschuldung: Dieses Kapitel behandelt die traditionellen Rechtfertigungsgründe für Staatsverschuldung, darunter die Stabilisierungsfunktion der Konjunkturpolitik, die Überbrückungsfunktion der Steuerglättung und die Lastenverschiebungsfunktion des Pay as you use Prinzips.
- Auswirkungen der Staatsverschuldung: In diesem Kapitel werden die ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Staatsverschuldung untersucht, darunter Crowding Out, Wachstumseinbußen, intergenerative Umverteilung und politische Instabilität. Der Autor diskutiert verschiedene Theorien, wie die des ricardianischen Äquivalenztheorems und der Lerner'schen Neuen Orthodoxie.
- Politische Ökonomie der Staatsverschuldung: Dieses Kapitel beleuchtet die politische Dimension der Staatsverschuldung. Der Autor untersucht die Rolle von Wettbewerb auf politischen Märkten und analysiert die Ursachen für wiederkehrende Defizite.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Nachhaltigkeit, (polit-)ökonomische Aspekte, ethische Aspekte, katholische Soziallehre, Generationenbilanzen, Crowding Out, intergenerative Umverteilung, politische Ökonomie, Finanzpolitik, Steuerglättung, Konjunkturpolitik, Tragfähigkeit, Defizitquote, Schuldenstand, implizite Verschuldung, explizite Verschuldung.
- Citation du texte
- Dr. Daniel Koch (Auteur), 2012, Begrenzung von Staatsverschuldung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188875