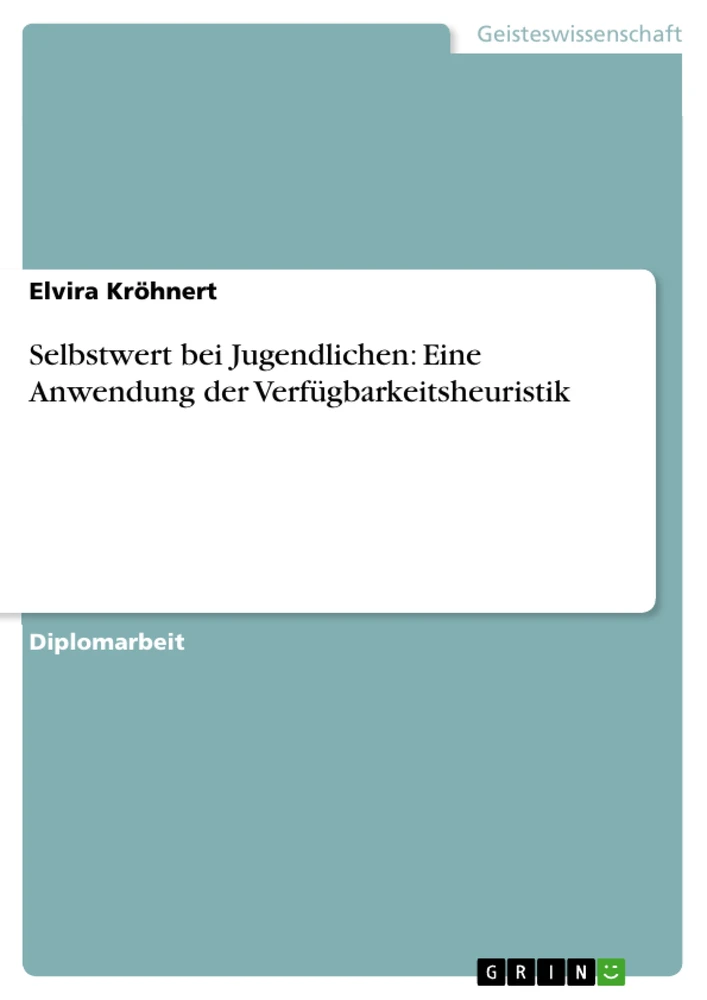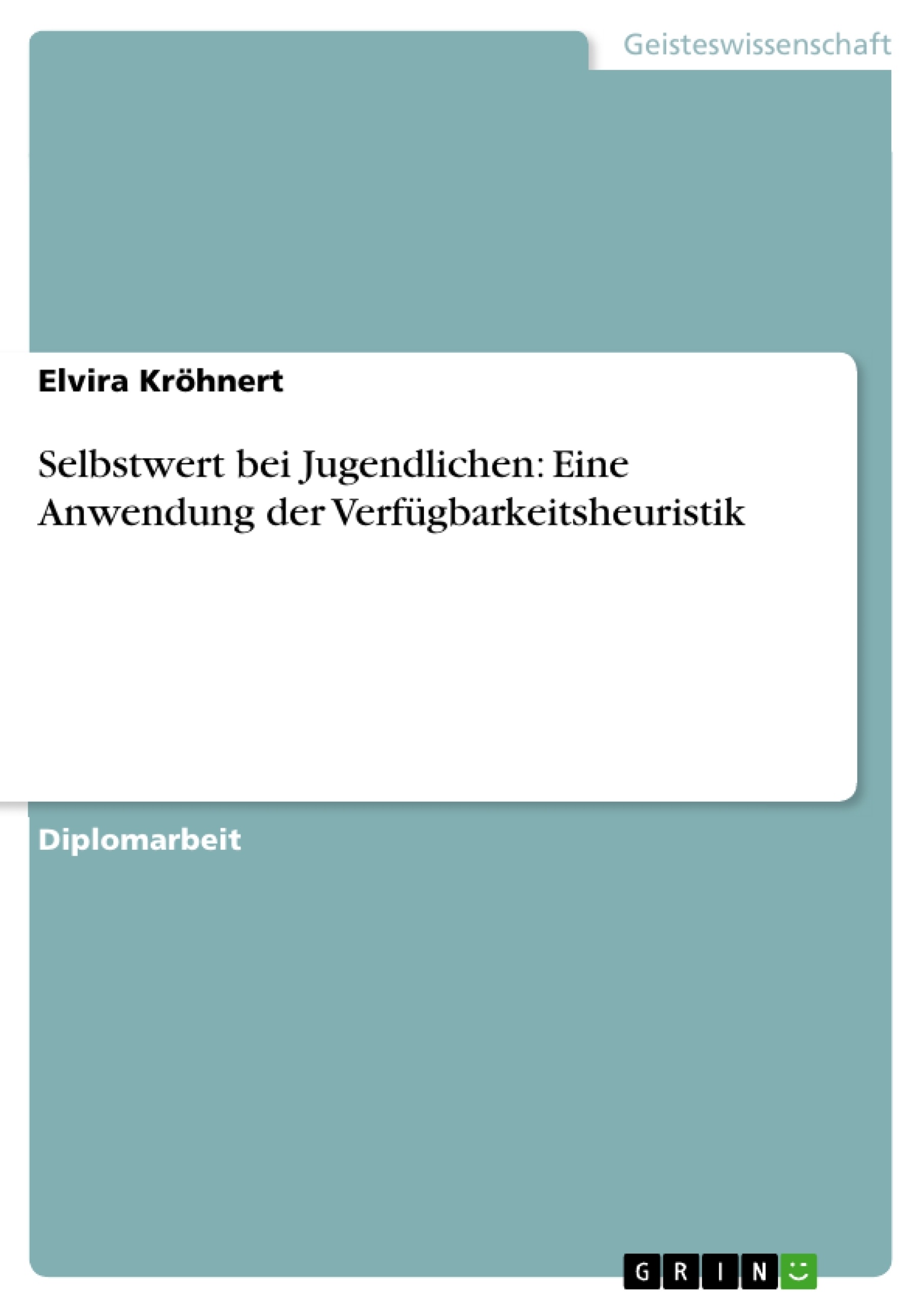Der Gegenstand dieser Studie bezieht sich auf den Selbstwert, die emotionale Komponente des Selbstkonzepts. Er stellt einen sensiblen Bereich dar, die Bewertung der eigenen Person. Der Selbstwert wird allgemein aus unterschiedlichen Quellen gespeist. Man kann z.B. zwischen Kompetenz- und Beziehungsebene (Brennan & Bosson, 1998) unterscheiden. Besonders bei Personen in der Adoleszenz unterliegt der Selbstwert noch großen Schwankungen. Sie sind in ihrem Selbstkonzept unsicher und können noch nicht auf viel Kompetenzerfahrung zurückgreifen. Deshalb sollte in diesem Alter der Selbstwert stark von den interpersonalen Erfahrungen, besonders mi dem gegengeschlechtlichen Peers, abhängig sein. Ein Experiment mit der Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik soll Aufschluss geben, ob die gemachten Erfahrungen auf der Beziehungsebene eine wichtige Quelle des Selbstwertes Jugendlicher darstellt. Zu diesem Zweck wurden 134 Personen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren beiderlei Geschlechts an ihren Schulen befragt. Es zeigte sich eine 3-fach Wechselwirkung, jeweils signifikant, zwischen Geschlecht, Art der Erfahrung (positiv oder negativ) und der Anzahl der Erfahrungen (leichte vs schwere Bedingung). Die männlichen Probanden wandten im Gegensatz zu den weiblichen die Verfügbarkeitsheuristik an. Es wird diskutiert, ob dieser erfasste Unterschied auf tatsächliche Unterschiede im Selbstkonzept der Geschlechter zurückgeht.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Selbstwert der Jugendlichen: Eine Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik
- Adoleszenz
- Das Selbstkonzept
- Selbstwert
- Einfluss interpersonaler Beziehungen
- Stabil oder manipulierbar?
- Verfügbarkeitsheuristik
- Schlussfolgerung und Hypothese
- Methode
- Stichprobe
- Ablauf
- Versuchsplan
- Fragebogen und Messungen
- Messung der Relevanz (Vorerfahrung/Involviertheit)
- Messung der Attraktivität
- Messung des Autonomiebedürfnisses
- Manipulation
- Manipulations-Check
- Messung der Selbstwirksamkeit
- Messung des momentanen Selbstwerts
- Resultate
- Manipulations-Check
- Kontrollvariable Relevanz
- Selbstwert
- Korrelationen mit Selbstwert
- Diskussion
- Zusammenfassung
- Der Selbstwert bei Jugendlichen und seine Entwicklung
- Die Rolle der Verfügbarkeitsheuristik bei der Selbstwertbildung
- Der Einfluss interpersonaler Beziehungen auf den Selbstwert
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Selbstwert und der Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik
- Methodische Ansätze zur Untersuchung des Selbstwerts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss interpersonaler Erfahrungen auf den Selbstwert von Jugendlichen. Dabei wird die Verfügbarkeitsheuristik angewendet, um zu beleuchten, wie leicht zugängliche Erfahrungen den Selbstwert beeinflussen. Die Studie analysiert die Auswirkungen von positiven und negativen Erfahrungen im Kontext von Beziehungen auf die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Selbstwerts bei Jugendlichen ein. Es werden grundlegende Aspekte des Selbstkonzepts, der Adoleszenz und der Verfügbarkeitsheuristik beleuchtet. Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Studie. Die Stichprobe, der Ablauf des Experiments, der Versuchsplan und die Messinstrumente werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 3 präsentiert. Die Untersuchungsergebnisse zu den Einflüssen von Geschlecht, Art der Erfahrung und Anzahl der Erfahrungen auf den Selbstwert werden analysiert.
Schlüsselwörter
Selbstwert, Jugendliche, Adoleszenz, Verfügbarkeitsheuristik, Interpersonale Beziehungen, Selbstkonzept, Geschlecht, Erfahrungen, Selbstwirksamkeit, Methode, Experiment
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Verfügbarkeitsheuristik?
Eine mentale Abkürzung, bei der Menschen Informationen danach bewerten, wie leicht sie ihnen im Gedächtnis verfügbar sind.
Wie beeinflussen Peers den Selbstwert von Jugendlichen?
Besonders gegengeschlechtliche Beziehungen sind in der Adoleszenz eine zentrale Quelle für die Bewertung der eigenen Attraktivität und Kompetenz.
Gibt es Geschlechterunterschiede bei der Selbstwertbildung?
Die Studie zeigt, dass männliche Probanden die Verfügbarkeitsheuristik anders anwandten als weibliche, was auf Unterschiede im Selbstkonzept hindeutet.
Ist der Selbstwert in der Adoleszenz stabil?
Nein, er unterliegt großen Schwankungen, da Jugendliche noch unsicher sind und weniger auf eigene Kompetenzerfahrungen zurückgreifen können.
Was wurde im Experiment mit den 134 Jugendlichen untersucht?
Es wurde geprüft, ob die Erinnerung an positive oder negative Beziehungserfahrungen den momentanen Selbstwert unmittelbar beeinflusst.
- Citar trabajo
- Diplom-Psychologin Elvira Kröhnert (Autor), 2003, Selbstwert bei Jugendlichen: Eine Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188891