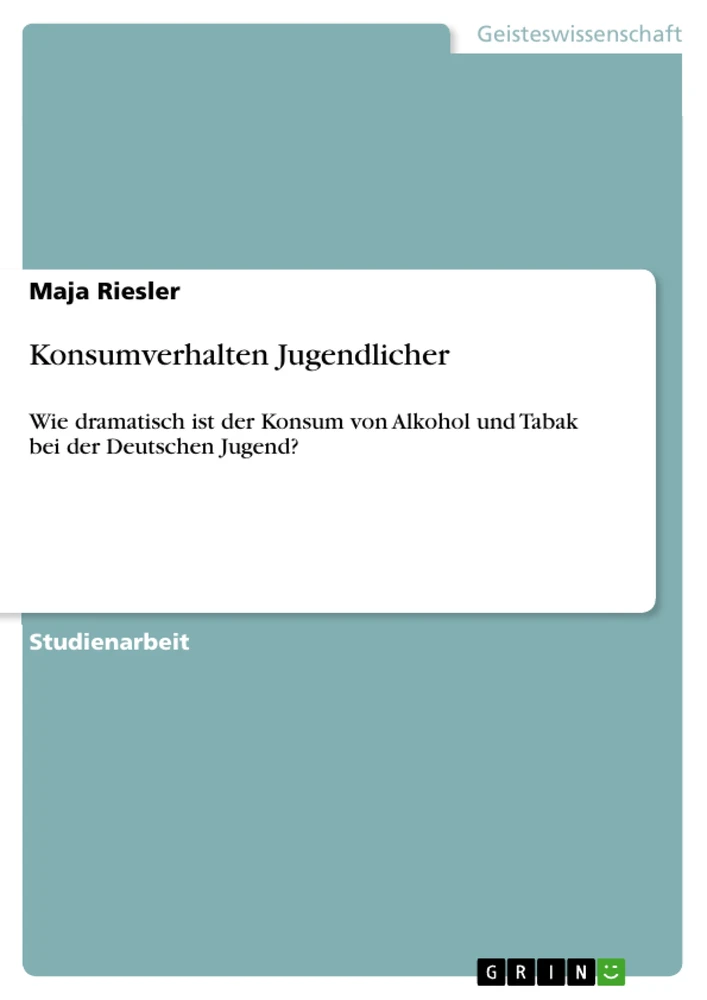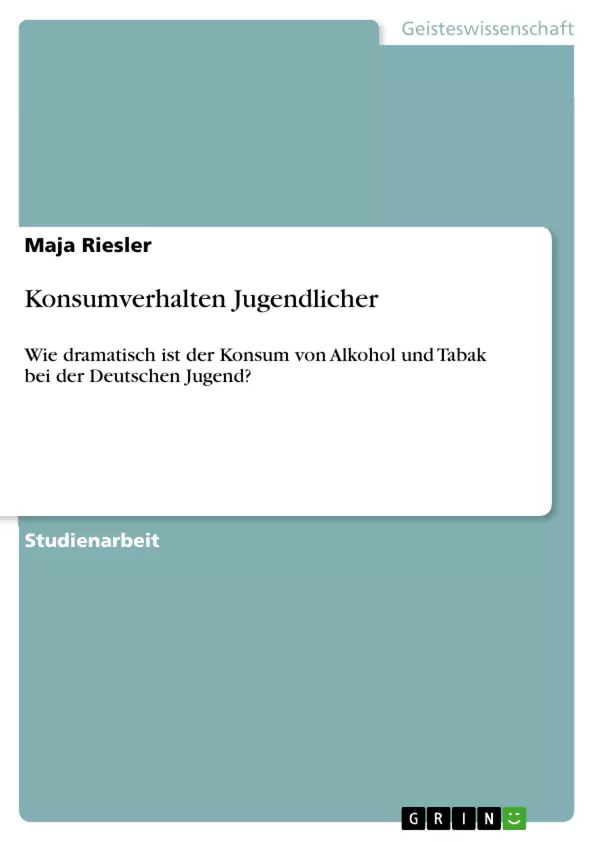Die vorliegende Seminararbeit analysiert das Konsumverhalten von legalen Drogen. Der Fokus der Arbeit liegt auf den Substanzen Alkohol und Tabak. Das Hauptaugenmerk der Konsumenten liegt auf den Jugendlichen. Untersucht wird ob soziodemographische Differenzen beim Gebrauch von Alltagsdrogen bei Heranwachsenden relevant sind. Die gegebenen Problematiken und Risiken - die auf Grund des leichtfertigen Verhaltens Jugendlicher gegenüber legaler Drogen - werden außerdem Bestandteil meiner Arbeit sein.
Des Weiteren möchte ich die Motive, welche Einfluss auf den Heranwachsenden ausüben und eine Einsicht in das Konsumverhalten gewähren.
Ich werde mit dieser Arbeit versuchen, die Gründe und Faktoren Jugendlicher, die maßgebend sind für den Alkohol und Nikotinkonsum aufzuzeigen.
Weniger wichtig werden in dieser Arbeit die Geschlechtsspezifischen Unterschiede sein.
Zu allererst werde ich verdeutlichen welche Substanzen zu den legalen Drogen zählen und was man unter „psychoaktiver Substanz“ zu verstehen hat, ebenfalls werden die Termini „Genussmittel“, „Rauschmittel“ und „Suchtmittel“ erläutert.
Im zweiten Teil meiner Arbeit behandle ich die soziodemographischen Unterschiede, sowie die Prädiktoren die Einfluss auf das Verhalten Jugendlicher beim Konsum legaler Drogen haben. Zusätzlich werde ich über die derzeitigen Entwicklungstrends von Alltagsdrogen bei Teenagern erzählen.
Im letzten Teil der Seminararbeit folgt nach einer kurzen Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfrage, meine eigene Meinung als auch die wichtigsten angesprochenen Punkte. Schlussfolgernd bleibt die Frage offen, ob eine Gesetzesverschärfung den Konsum legaler Drogen bei Jugendlichen zügeln kann? Und inwieweit man ein Desinteresse von Alltagssubstanzen bei Teenagern fördern kann?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Begriffserklärung -,,legale Drogen“, „psychoaktive Substanzen\",\n,,Genuss & Rauschmittel“ und „,Suchtmittel“.
- Der Stellenwert von Alltagsdrogen bei Jugendlichen
- Verbreitung und Ausmaß von Tabak und Alkohol
- Konsummuster und soziodemographische Faktoren
- Einflussfaktoren, Ursachen und Motive die eine Rolle spielen beim Substanzkonsum
- Entwicklungstrends und die einhergehenden Problematiken
- Soziale- und Gesundheitliche Risiken die beim Missbrauch entstehen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht das Konsumverhalten von legalen Drogen, insbesondere Alkohol und Tabak, bei Jugendlichen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, ob soziodemographische Unterschiede beim Gebrauch von Alltagsdrogen bei Heranwachsenden relevant sind und welche Problematiken und Risiken im Zusammenhang mit dem Konsumverhalten von Jugendlichen entstehen. Die Arbeit analysiert die Einflussfaktoren, Motive und Entwicklungstrends im Bereich des Drogenkonsums bei Teenagern.
- Soziodemographische Unterschiede beim Konsum von Alkohol und Tabak bei Jugendlichen
- Einflussfaktoren, Ursachen und Motive für den Substanzkonsum bei Jugendlichen
- Entwicklungstrends und Problematiken im Bereich des Drogenkonsums bei Teenagern
- Soziale und gesundheitliche Risiken, die durch den Missbrauch von Alltagsdrogen entstehen
- Die Frage, ob eine Gesetzesverschärfung den Konsum legaler Drogen bei Jugendlichen zügeln kann und inwieweit ein Desinteresse an Alltagssubstanzen gefördert werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Seminararbeit stellt grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit legalen Drogen vor, wie z. B. „psychoaktive Substanz“, „Genussmittel“, „Rauschmittel“ und „Suchtmittel“. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Stellenwert von Alltagsdrogen bei Jugendlichen und analysiert die Verbreitung und das Ausmaß von Tabak- und Alkoholkonsum. Zudem werden Konsummuster und soziodemographische Faktoren, die Einfluss auf das Konsumverhalten haben, beleuchtet. Das Kapitel geht auch auf die Einflussfaktoren, Ursachen und Motive ein, die eine Rolle beim Substanzkonsum spielen. Abschließend werden Entwicklungstrends und die einhergehenden Problematiken im Bereich des Drogenkonsums bei Jugendlichen sowie die sozialen und gesundheitlichen Risiken, die durch den Missbrauch von Alltagsdrogen entstehen, behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Schwerpunkte der Seminararbeit sind legale Drogen, Konsumverhalten, Jugendliche, Alkohol, Tabak, soziodemographische Faktoren, Einflussfaktoren, Entwicklungstrends, Problematiken, Risiken, Sucht, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „legale Drogen“?
Damit sind psychoaktive Substanzen gemeint, deren Erwerb und Konsum gesetzlich erlaubt sind, insbesondere Alkohol und Tabak.
Welche Motive führen Jugendliche zum Konsum von Alkohol und Nikotin?
Häufige Motive sind Neugier, Gruppenzwang, Stressbewältigung, der Wunsch nach Grenzerfahrung oder die Nachahmung von Vorbildern.
Spielen soziodemographische Faktoren eine Rolle beim Drogenkonsum?
Ja, Unterschiede in der sozialen Herkunft, dem Bildungsstand und dem Wohnumfeld können das Konsummuster und das Einstiegsalter beeinflussen.
Was sind die gesundheitlichen Risiken für Teenager?
Neben akuten Gefahren wie Alkoholvergiftungen drohen langfristige Schäden an Organen, eine Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung und ein hohes Suchtpotenzial.
Kann eine Gesetzesverschärfung den Konsum senken?
Dies ist eine zentrale Forschungsfrage. Während strengere Abgaberegeln den Zugang erschweren, ist auch eine präventive Förderung von Desinteresse an Suchtmitteln entscheidend.
Was ist eine „psychoaktive Substanz“?
Es handelt sich um Stoffe, die das zentrale Nervensystem beeinflussen und dadurch die Wahrnehmung, das Denken, das Fühlen oder das Verhalten verändern.
- Quote paper
- Maja Riesler (Author), 2012, Konsumverhalten Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189089