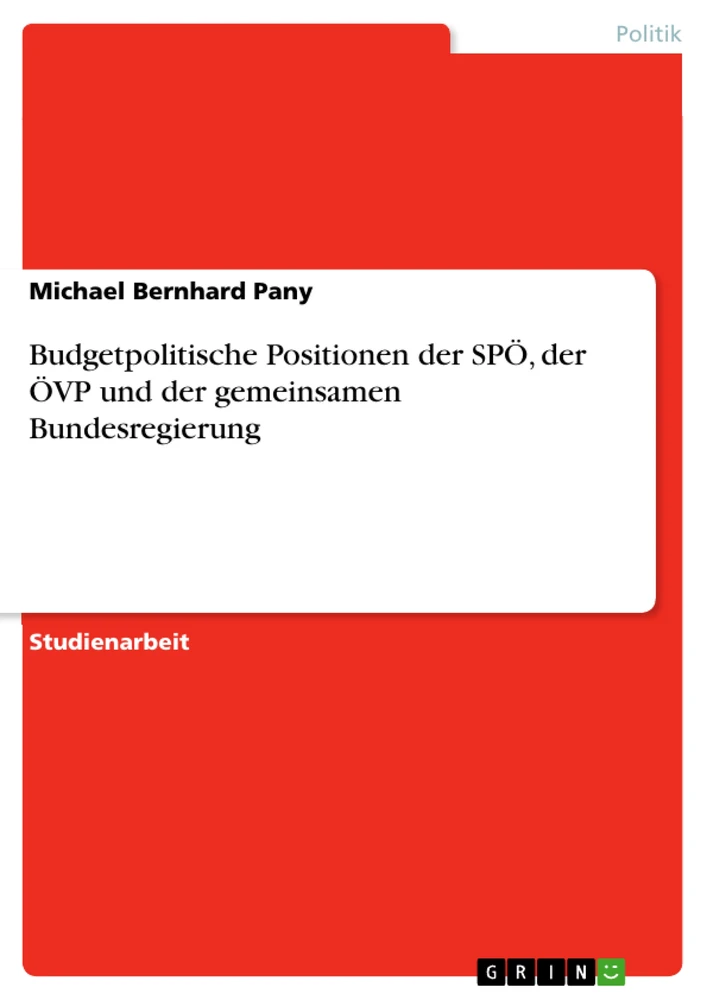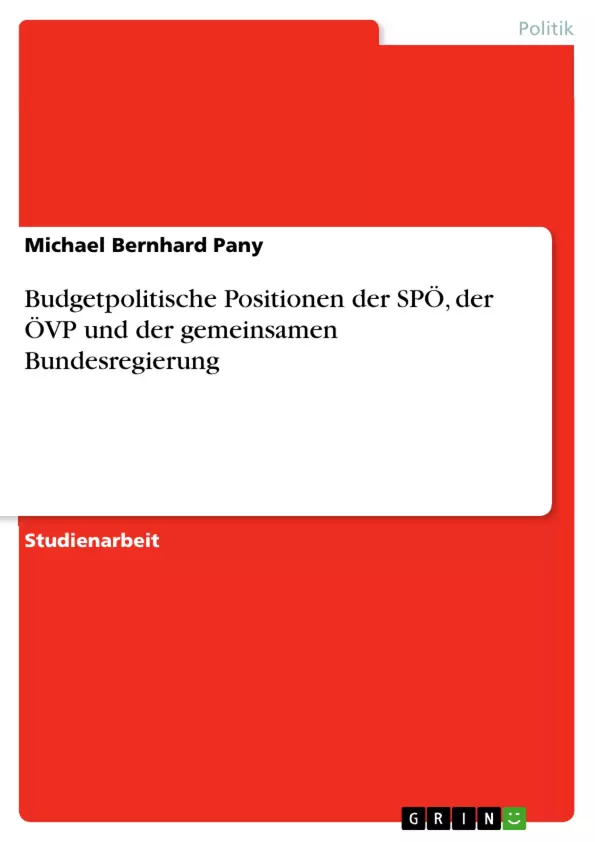Grob skizziert soll es das Ziel dieser SE-Arbeit sein, zunächst die budgetpolitischen Positionen von SPÖ und ÖVP auszumachen, sowie die dahinter liegenden Intentionen zu erläutern, um dann in weiterer Folge das Zustandekommen der aktuellen budgetpolitischen Positionen der gemeinsamen Bundesregierung nachvollziehbar zu machen.
Wenngleich Budgetpolitik an sich etwas sehr praktisches darstellt, geht es in dieser SE-Arbeit daher vor allem um das theoretische, quasi das dahinter liegende.
Zunächst ist es einmal das vorrangige Ziel des Verfassers, jene Kategorien zu systematisieren, in denen sich die zu behandelnden Positionen überhaupt erst kategorisieren lassen. Thema sind also anfänglich die handlungsanleitenden „Ideologien“ Keynesianismus und Neoklassik, als Biotop, in welchem sich die programmatischen Positionen bewegen, in Verbindung mit der möglichen Prioritätensetzung im sogenannten Magischen Viereck/Vieleck der VWL, sowie der Unterteilung des „Meta“-Politikfeldes Wirtschaftspolitik in die Unterpolitikfelder Lohnpolitik, Finanz- und Währungspolitik, sowie Fiskal- beziehungsweise Budgetpolitik. Nach dieser Art Einführung werden dann die zu behandelnden budgetpolitischen Positionen exemplarisch analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Einleitung
- Mögliches makroökonomisches Aufeinanderprallen der beiden Volksparteien SPÖ und ÖVP
- Unterschiedliche Präferenzen im „Magischen Viereck/Vieleck“
- Unterschiedliche Konzepte in der Theorie
- Budgetpolitische Positionen und Ziele der SPÖ, exemplarisch
- Budgetpolitische Positionen und Ziele der ÖVP, exemplarisch
- Budgetpolitische Ziele der Bundesregierung
- Bundesregierung als monolithischer Block oder Bundesbudget als kleinster gemeinsamer Nenner
- Wer setzte sich durch, Diskrepanz veröffentlichter Meinung/Budget-,,Wahrheit“
- Resümee
- Anhang
- Quellenangaben
- Literatur
- Periodische Druckerzeugnisse
- Stenographische Protokolle
- Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die budgetpolitischen Positionen der SPÖ und ÖVP sowie die Entstehung der aktuellen budgetpolitischen Positionen der gemeinsamen Bundesregierung. Sie befasst sich mit der theoretischen Grundlage der Positionen, insbesondere mit den „Ideologien“ Keynesianismus und Neoklassik, sowie den Prioritätensetzungen im „Magischen Viereck/Vieleck“ der Volkswirtschaftslehre. Die Arbeit beleuchtet die programmatischen Ausrichtungen der Parteien, ihre Visionen für die Zukunft und ihre praktischen Umsetzungen im Doppelbudget der XXIII. Legislaturperiode.
- Analyse der budgetpolitischen Positionen der SPÖ und ÖVP
- Untersuchung der theoretischen Grundlagen der Positionen (Keynesianismus, Neoklassik)
- Behandlung der unterschiedlichen Präferenzen im „Magischen Viereck/Vieleck“
- Bewertung der Budgetpolitik der gemeinsamen Bundesregierung
- Diskussion der Unterschiede zwischen den Positionen der Parteien und den realen Budgetentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Ziel der Arbeit dar, welches darin besteht, die budgetpolitischen Positionen der SPÖ und ÖVP zu beleuchten und die Entstehung der aktuellen Budgetpolitik der gemeinsamen Bundesregierung zu erklären. Sie erklärt die theoretischen Rahmenbedingungen, die der Analyse zugrundeliegen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die potenziellen Konflikte zwischen den beiden Volksparteien im Bereich der Wirtschaftspolitik. Es diskutiert die traditionellen Dichotomien zwischen Arbeit und Kapital sowie die unterschiedlichen Schwerpunkte der Parteien im Bereich der Lohnpolitik, Finanz- und Währungspolitik sowie der Fiskal- und Budgetpolitik.
Das dritte Kapitel analysiert die unterschiedlichen Präferenzen der SPÖ und ÖVP im „Magischen Viereck/Vieleck“ der Volkswirtschaftslehre. Es geht auf die verschiedenen Ziele ein, die die Parteien im Bereich des Wirtschaftswachstums, der Beschäftigung, der Preisstabilität und des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts verfolgen.
Das vierte Kapitel behandelt die unterschiedlichen Konzepte der SPÖ und ÖVP in der Wirtschaftspolitik. Es erklärt die beiden paradigmatischen Ansätze des Keynesianismus und der Neoklassik und zeigt, wie sie die jeweiligen Budgetpositionen der Parteien beeinflussen.
Schlüsselwörter
Budgetpolitik, SPÖ, ÖVP, Bundesregierung, Keynesianismus, Neoklassik, „Magisches Viereck/Vieleck“, Wirtschaftspolitik, Sozialstaat, Doppelbudget, XXIII. Legislaturperiode.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die budgetpolitischen Unterschiede zwischen SPÖ und ÖVP?
Die SPÖ orientiert sich traditionell eher am Keynesianismus (Nachfragesteuerung), während die ÖVP stärker neoklassische Positionen (Angebotsorientierung) vertritt.
Was ist das „Magische Viereck“ der Wirtschaftspolitik?
Es umfasst die Ziele Preisstabilität, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges Wirtschaftswachstum, zwischen denen oft Zielkonflikte bestehen.
Wie entsteht ein gemeinsames Bundesbudget in einer Koalition?
Das Budget ist oft das Ergebnis von Kompromissen, bei denen die unterschiedlichen Prioritäten der Parteien auf einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“ gebracht werden.
Was bedeutet Fiskalpolitik in diesem Kontext?
Fiskalpolitik nutzt die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben (das Budget), um die konjunkturelle Entwicklung und soziale Ziele des Staates zu steuern.
Welche Rolle spielt die „Budgetwahrheit“ in der politischen Debatte?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der veröffentlichten Meinung der Parteien und der tatsächlichen budgetären Umsetzung in der Regierungsverantwortung.
- Quote paper
- Michael Bernhard Pany (Author), 2007, Budgetpolitische Positionen der SPÖ, der ÖVP und der gemeinsamen Bundesregierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189117