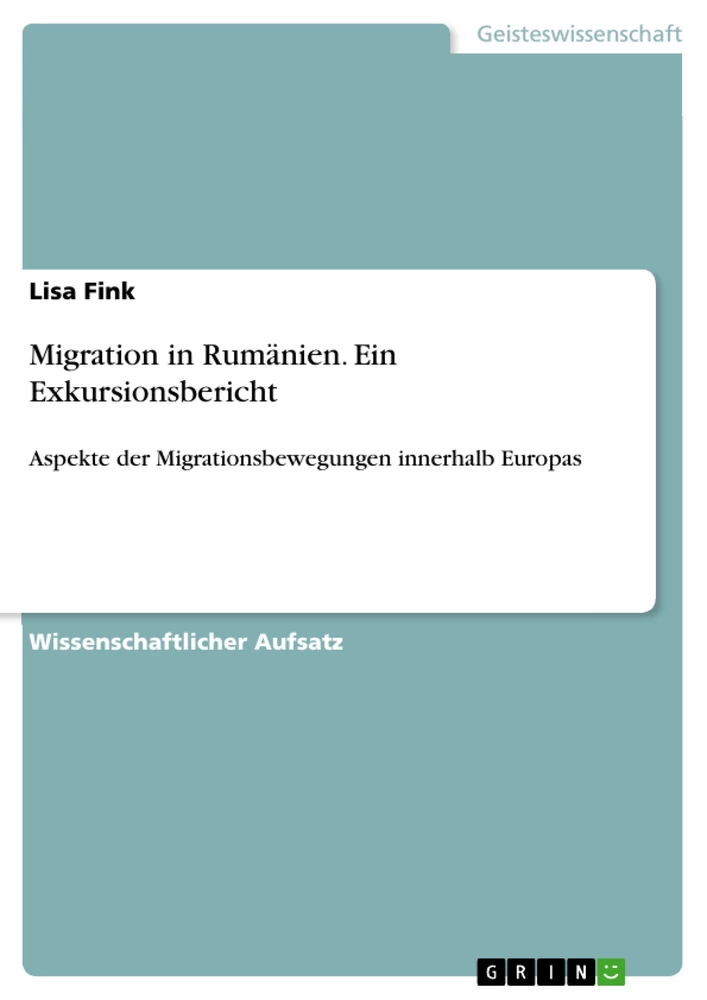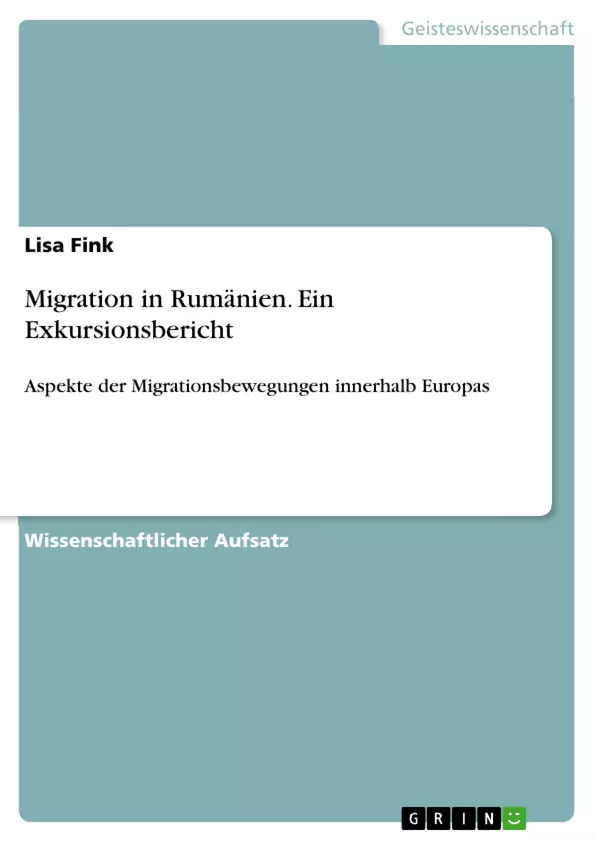Als ein Beispiel eines multiethnisch zusammengesetzten Staates soll in diesem Text die Republik Rumänien betrachtet werden. Als Rahmen sollen hierbei, anhand von Anmerkungen zur Europäisierungsforschung von Sabine Hess über Forschungsergebnisse des von der Kulturstiftung des Bundes in Auftrag gegebenen Forschungsprojekts „TRANSIT MIGRATION“, in Bezug auf Mobilität und Mobilisierung innerstaatliche sowie länderübergreifende Veränderungen fokussiert werden, die der europäische Integrationsprozess mit sich bringt, wobei Arbeits- und Lebenssituationen im soziokulturellen, ökonomischen und politischen Wandel besonders in den Vordergrund, sowie die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Vorstellung einer „Festung Europas“ in Frage gestellt werden sollen.
Als Beispiele für Migrationsbewegungen innerhalb, nach, bzw. aus Rumänien, soll auf Basis des Artikels „Chinesische ImmigrantInnen in Bukarest: Eine neue rumänische Minderheit?“ auf die wirtschaftliche Situation und Bedeutung, sowie die Lebensverhältnisse der „chinesischen Community“, der Minderheit der chinesischen Immigranten in Bukarest, welche nach 1989 im Zusammenhang von Transformationsprozessen nach Rumänien immigrierten, sowie Veränderungsprozesse sowohl im Herkunftsland China, als auch im Immigrationsland Rumänien eingegangen werden.
Des Weiteren sollen die Lebensverhältnisse rumänischer Auswanderer in wirtschaftlich starken Ländern in Bezug auf den „Market Effect“ anhand eines Artikels des rumänischen Professors Petre Raluca aus Constanta verdeutlicht und auf die unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen der Auswanderer, sowie der im Herkunftsland gebliebenen Rumänen und die daraus resultierenden Missverständnisse mit deren sozialen und wirtschaftlichen Folgen hervorgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- TRANSIT MIGRATION – Transnationale Zonen der Prekarität
- Ein Beispiel für eine bedeutende Migrationsströmung in Osteuropa – Die chinesische Community in Bukarest
- The „Market Effect“ – Die Genealogie eines Missverständnisses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Exkursionsbericht widmet sich der Erforschung von Migrationsbewegungen innerhalb Europas und beleuchtet dabei verschiedene Aspekte dieser komplexen Thematik. Ziel ist es, die Bedeutung von Migration in einer globalisierten Welt aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die beteiligten Gesellschaften zu untersuchen.
- Die Relevanz von Migrationsbewegungen im Kontext der Globalisierung und wachsenden Mobilität
- Die Transformation von Staatsgrenzen und der Wandel von Nationalismus und Internationalismus
- Die Auswirkungen von Migration auf die soziokulturelle, ökonomische und politische Entwicklung von Gesellschaften
- Die Rolle von transnationalen Migrationsbewegungen und deren Bedeutung für die Entwicklung neuer Sozialräume
- Die Herausforderungen und Konflikte im Kontext von Migrationsbewegungen, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Migranten in neue Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Migrationsbewegungen ein und betont ihre Bedeutung in der heutigen Zeit. Es wird das Beispiel Rumäniens als multiethnisch zusammengesetztem Staat herangezogen und der Rahmen für die weiteren Analysen gelegt.
- TRANSIT MIGRATION – Transnationale Zonen der Prekarität: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Forschungsprojekt „TRANSIT MIGRATION“ und dessen Untersuchung von Migrations- und Grenzregimepraktiken im Südosten Europas. Es wird die Frage der „Festung Europa“ aufgeworfen und die Bedeutung transnationaler Migrationsströmungen für die Entwicklung eines „Mehrebenenstaates“ erörtert.
- Ein Beispiel für eine bedeutende Migrationsströmung in Osteuropa – Die chinesische Community in Bukarest: Dieses Kapitel fokussiert auf die chinesische Community in Bukarest als Beispiel für eine bedeutende Migrationsströmung in Osteuropa. Es wird die Geschichte dieser Gruppe und die Gründe für ihre Auswanderung nach Rumänien beleuchtet. Weiterhin werden die Lebensverhältnisse und Herausforderungen der chinesischen Community in Bukarest analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des vorliegenden Exkursionsberichts sind Migration, Globalisierung, Transnationalisierung, Europäische Integration, Grenzregime, multiethnische Gesellschaften, kulturelle Veränderungsprozesse, wirtschaftliche und soziale Folgen von Migration, „Market Effect“, Identitätsbildung und Integration von Migranten.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht das Projekt „TRANSIT MIGRATION“?
Es analysiert Migrations- und Grenzregimepraktiken im Südosten Europas und hinterfragt die Vorstellung einer „Festung Europa“ im Kontext transnationaler Mobilität.
Warum gibt es eine chinesische Community in Bukarest?
Nach 1989 immigrierten viele Chinesen im Zuge von Transformationsprozessen nach Rumänien, um wirtschaftliche Chancen zu nutzen und neue Märkte zu erschließen.
Was versteht man unter dem „Market Effect“ bei Auswanderern?
Er beschreibt die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Auswanderer und der Realität in wirtschaftlich starken Ländern sowie die Missverständnisse mit den im Herkunftsland gebliebenen Verwandten.
Wie wirkt sich die EU-Integration auf Rumänien aus?
Der Prozess bringt sowohl innerstaatliche als auch länderübergreifende Veränderungen in der Arbeits- und Lebenssituation sowie im soziokulturellen Gefüge mit sich.
Ist Rumänien ein multiethnischer Staat?
Ja, Rumänien wird als Beispiel für einen Staat mit vielfältigen Minderheiten und komplexen Migrationsbewegungen (Ein-, Aus- und Transitmigration) betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Lisa Fink (Autor:in), 2012, Migration in Rumänien. Ein Exkursionsbericht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189129