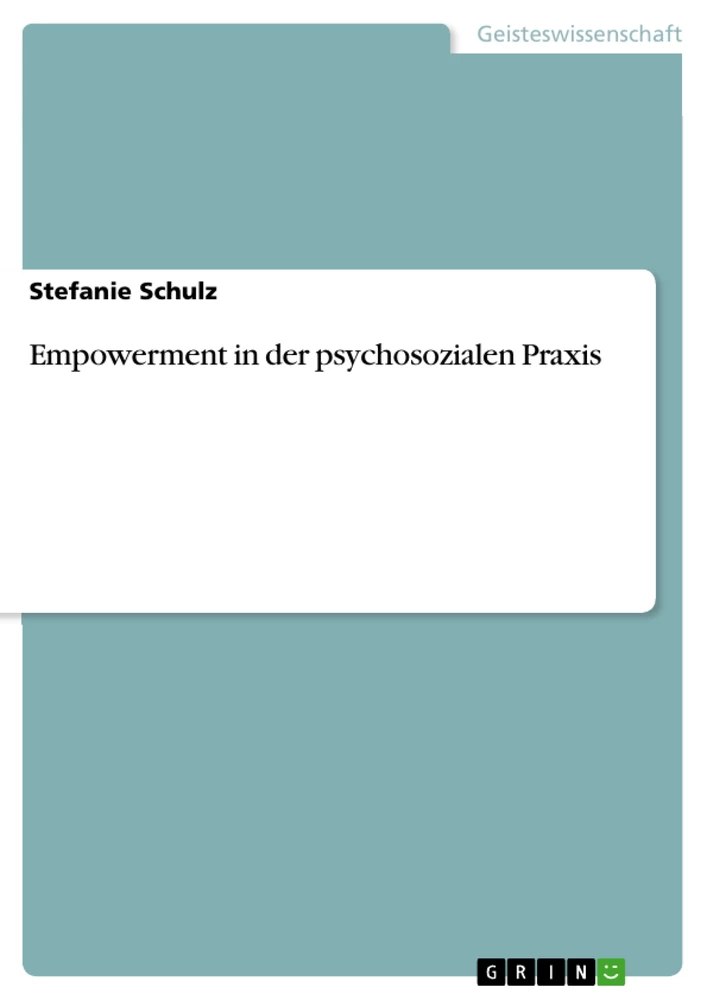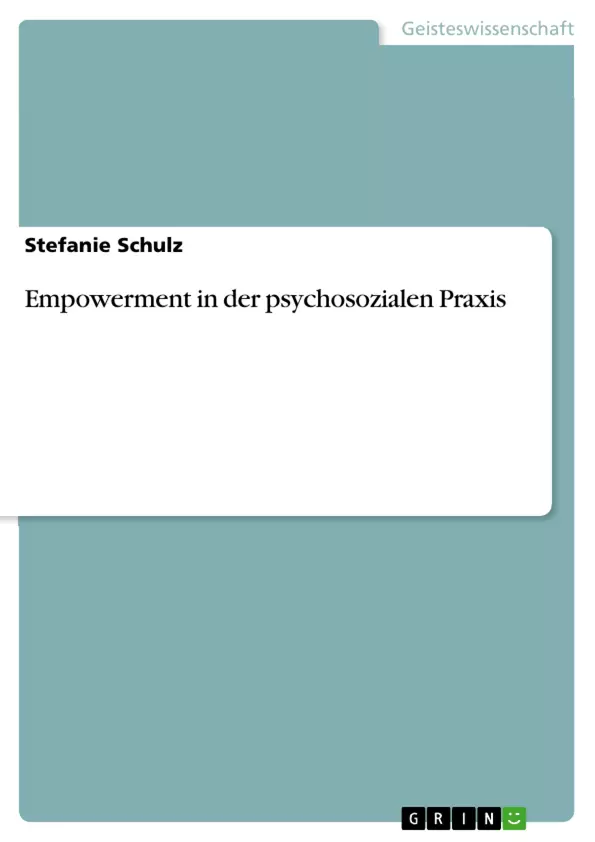„Man hilft Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst können“
Abraham Lincoln
1. Einleitung
Das Eingangszitat von Abraham Lincoln verdeutlicht sehr gut was, meiner Ansicht nach, einen der wesentlichen Leitgedanken des Handelns im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld darstellen sollte. In vielen Bereichen der sozialen Arbeit bestimmt noch immer der ‚Defizitorientierte Blick‘ die Entscheidungen und das Verhalten der professionellen Mitarbeiter. Herriger beschreibt dies wie folgt: „Soziale Arbeit, wie so viele andere helfende Berufe auch, hat viele Bestände ihrer Theorie und Praxis auf der Annahme aufgebaut, daß Klienten zu Klienten werden, weil sie Träger von Defiziten, Problemen, Pathologien und Krankheiten sind, daß sie - im kritischen Maße - beschädigt oder schwach sind (Herriger, 2010, S.68). Empowerment richtet sich an die Arbeitshaltung der professionellen Mitarbeiter und fordert von ihnen, den Klienten mehr Selbstbestimmung und Verantwortung in ihrem Handeln zu übertragen. Dabei soll sich die Sichtweise der Sozialarbeiter von den Schwächen der Klienten lösen und deren Fähigkeiten und Ressourcen mehr Beachtung geschenkt werden. Jedoch entspricht das Empowerment-Konzept gegenwärtig nicht den wissenschaftstheoretischen Anforderungen und darf daher nicht als Methode verstanden werden. Hinzu kommt, dass keine klaren Vorgaben bestehen, auf die die Vertreter dieses Konzepts in verschiedenen (Problem-)Situationen zurückgreifen können. Allerdings ist ein Ziel dieses Konzeptes Denkanstöße zu geben, um die eigene Arbeitshaltung zu überprüfen und in einem anderen, neuen Blickwinkel zu betrachten (vgl. Stark 1996, S. 155).
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Zusammenfassung meiner Bachelor-Arbeit.
Die vorliegende Arbeit befasst sich speziell mit der Thematik, welche Rolle Empowerment in der psychosozialen Praxis spielt. Dabei wird zu Beginn versucht, einen Überblick über den Begriff ‚Empowerment‘ zu gegeben und wie er in die die psychosoziale Praxis eingebunden ist. Anschließend werden die Theorie der erlernten Hilflosigkeit, das Konzept der Salutogenese und die Ressourcenorientierung vorgestellt, um ein Hintergrundwissen für die Förderung von Empowermentprozessen zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EMPOWERMENT
- GESCHICHTLICHER HINTERGRUND
- DEFINITION EMPOWERMENT
- PHASENMODELL VON KIEFFER
- EBENEN
- DIE INDIVIDUELLE EBENE
- DIE EBENE VON GRUPPEN UND ORGANISATIONEN
- DIE STRUKTURELLE EBENE
- ZUGÄNGE
- EMPOWERMENT IN DER PSYCHOSOZIALEN PRAXIS
- SOZIALPSYCHOLOGISCHE GRUNDLAGEN
- ERLERNTE HILFLOSIGKEIT
- SALUTOGENESE
- KONTINUUM VS. DICHOTOMIE
- GESUNDHEITSFAKTOREN VS. RISIKOFAKTOREN
- HETEROSTASE VS. HOMÖOSTASE
- VERSTEHBARKEIT (KOGNITIVE KOMPONENTE)
- HANDHABBARKEIT (KOGNITIV-EMOTIONALE KOMPONENTE)
- BEDEUTSAMKEIT (MOTIVATIONALE KOMPONENTE)
- FÖRDERUNG DER VERSTEHBARKEIT
- FÖRDERN DER HANDHABBARKEIT
- FÖRDERN DER BEDEUTSAMKEIT
- RESSOURCENORIENTIERUNG
- FÖRDERMÖGLICHKEITEN VON EMPOWERMENT DURCH DIE SOZIALE ARBEIT
- UNTERSTÜTZUNGSMANAGEMENT
- RESSOUCENDIAGNOSTIK
- FÖRDERUNG VON KONTAKTFÄHIGKEIT UND SOZIALEN BEZIEHUNGEN
- BIOGRAFIEARBEIT
- FÖRDERN DES SELBSTBESTIMMUNGSRECHTS
- MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept von Empowerment und seiner Bedeutung in der psychosozialen Praxis. Sie analysiert den historischen Hintergrund, die Definition, die verschiedenen Phasen und Ebenen des Empowerments sowie die relevanten sozialpsychologischen Grundlagen. Darüber hinaus werden konkrete Fördermöglichkeiten von Empowerment durch die soziale Arbeit beleuchtet.
- Geschichte und Definition des Empowerment-Konzepts
- Sozialpsychologische Grundlagen, die Empowerment beeinflussen
- Phasenmodell von Kieffer: Die Entwicklung von Empowermentprozessen
- Verschiedene Ebenen des Empowerments (individuelle, Gruppen-, strukturelle Ebene)
- Konkrete Fördermöglichkeiten von Empowerment in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die zentrale Bedeutung des Empowerment-Gedankens für die psychosoziale Praxis. Sie kritisiert die verbreitete "Defizitorientierung" in der Sozialen Arbeit und betont die Wichtigkeit, die Stärken und Ressourcen der Klienten in den Vordergrund zu stellen.
Das Kapitel "Empowerment" beleuchtet den historischen Hintergrund der Empowerment-Idee, die im Kontext der Bürgerrechtsbewegung in den USA entstand. Es geht auf verschiedene Definitionen von Empowerment ein und stellt das Phasenmodell von Kieffer vor, das die Entwicklung von Empowermentprozessen in vier Phasen beschreibt.
Das Kapitel "Empowerment in der psychosozialen Praxis" befasst sich mit den sozialpsychologischen Grundlagen, die Empowerment beeinflussen. Hier werden die Theorie der erlernten Hilflosigkeit, das Konzept der Salutogenese und die Ressourcenorientierung vorgestellt. Die Salutogenese wird dabei anhand von verschiedenen Dimensionen wie Kontinuum vs. Dichotomie, Gesundheitsfaktoren vs. Risikofaktoren, Heterostase vs. Homöostase, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit erläutert.
Das Kapitel "Fördermöglichkeiten von Empowerment durch die soziale Arbeit" behandelt verschiedene Ansatzpunkte, wie die Soziale Arbeit Empowerment-Prozesse unterstützen kann. Dazu gehören unter anderem Unterstützungsmanagement, Ressourcendiagnostik, Förderung von Kontaktfähigkeit und sozialen Beziehungen, Biografiearbeit, Förderung des Selbstbestimmungsrechts sowie motivierende Gesprächsführung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit umfassen Empowerment, Selbstbestimmung, Ressourcenorientierung, Stärken und Schwächen, erlernte Hilflosigkeit, Salutogenese, soziale Arbeit, psychosoziale Praxis, Defizitorientierung und Klientenorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernziel von Empowerment in der sozialen Arbeit?
Das Ziel ist es, Klienten zu mehr Selbstbestimmung und Verantwortung zu verhelfen, indem man sich auf ihre Ressourcen und Stärken statt auf ihre Defizite konzentriert.
Was versteht man unter „erlernter Hilflosigkeit“?
Es ist ein psychologischer Zustand, in dem Menschen aufgrund negativer Erfahrungen glauben, keine Kontrolle über ihre Lebensumstände zu haben, was Empowerment-Prozesse blockiert.
Welche Rolle spielt die Salutogenese beim Empowerment?
Die Salutogenese fragt nach den Faktoren, die Gesundheit erhalten. Empowerment nutzt dies, um durch Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit die Widerstandskraft zu stärken.
Was beinhaltet das Phasenmodell von Kieffer?
Kieffer beschreibt die Entwicklung von Empowerment in vier Phasen: vom Stadium der Hilflosigkeit über den Kompetenzaufbau bis hin zur aktiven Mitgestaltung der Umwelt.
Wie kann Biografiearbeit Empowerment unterstützen?
Durch die Reflexion der eigenen Lebensgeschichte können Klienten verborgene Ressourcen entdecken und ein neues Verständnis für ihre eigene Handlungsfähigkeit entwickeln.
- Citar trabajo
- Stefanie Schulz (Autor), 2012, Empowerment in der psychosozialen Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189310