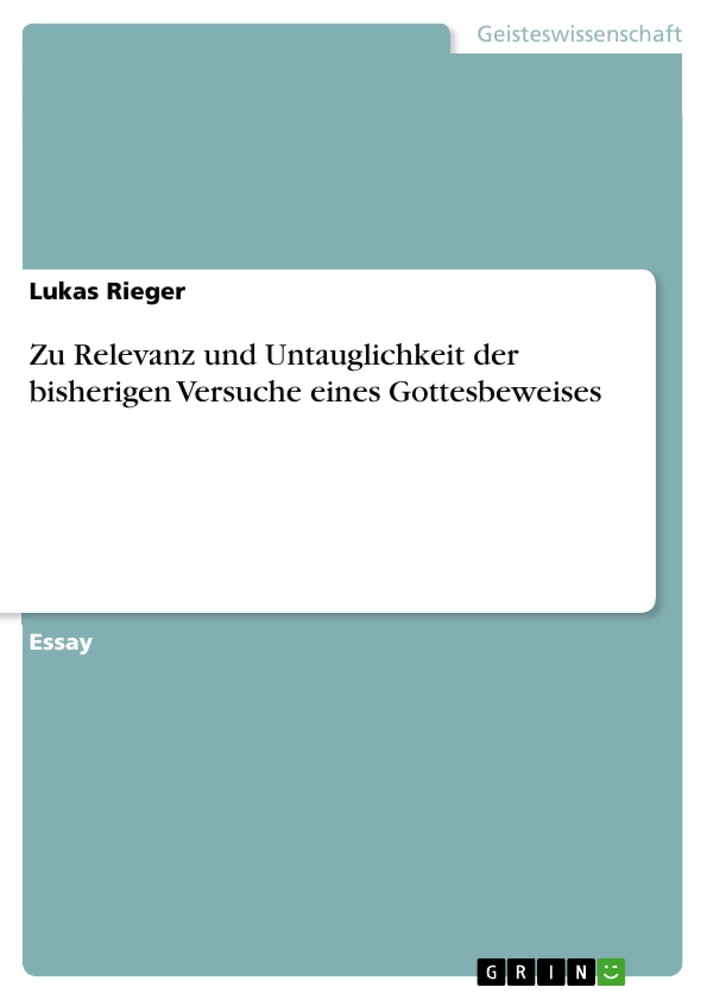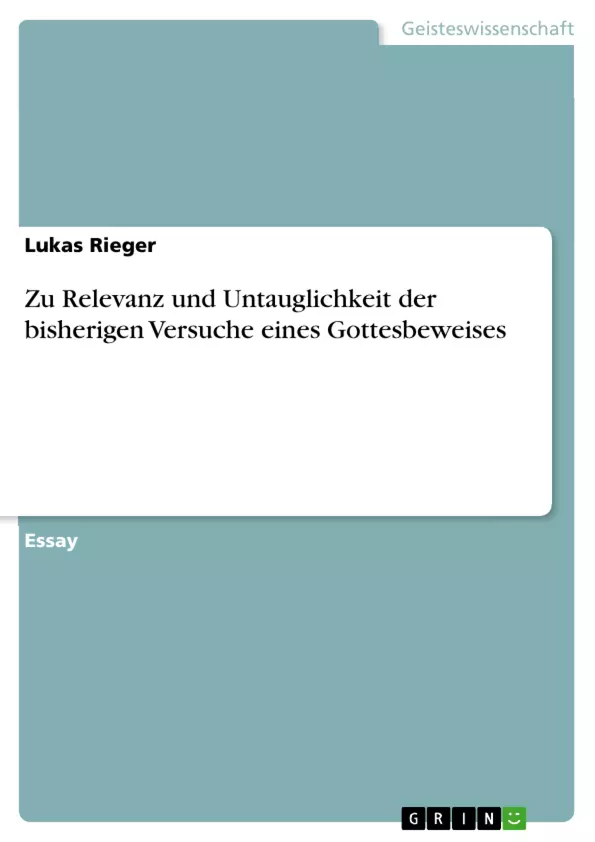Der kurze Essay im Rahmen einer EPG II-Veranstaltung plausibilisiert einführend, weshalb es im Interesse des demokratischen Diskurses relevant ist, den Begriff "Gott" als intersubjektiv nachvollziehbar zu belegen und führt sodann die drei prominentesten Grundfiguren des Gottesbeweises auf, um sie, orientiert an der kantischen Auseinandersetzung, einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Zur gesellschaftlichen und ethischen Relevanz eines Gottesbeweises
- II. Zur Untauglichkeit der bisherigen Versuche eines Gottesbeweises
- Der ontologische Gottesbeweis.
- Argumentationslinie
- Kritik
- Der kosmologische Gottesbeweis.
- Argumentationslinie
- Kritik
- Der physiko-theologische Gottesbeweis.
- Argumentationslinie
- Kritik
- Der ontologische Gottesbeweis.
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die Relevanz und Untauglichkeit bisheriger Versuche eines Gottesbeweises. Er argumentiert, dass ein Gottesbeweis notwendig ist, um das christliche Wertesystem zu legitimieren und ethische Debatten auf einer intersubjektiv zugänglichen Grundlage zu führen. Der Essay beleuchtet die Problematik des christlichen Verständnisses von Menschenwürde und zeigt, wie die Frage nach der Existenz Gottes in aktuellen Debatten der Bioethik relevant wird.
- Die gesellschaftliche und ethische Relevanz eines Gottesbeweises
- Die Untauglichkeit bisheriger Gottesbeweise
- Der Einfluss des Gottesbeweises auf ethische Debatten
- Die Problematik des christlichen Verständnisses von Menschenwürde
- Die Rolle des Gottesbeweises in der Bioethik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Zur gesellschaftlichen und ethischen Relevanz eines Gottesbeweises
Dieses Kapitel argumentiert, dass ein Gottesbeweis notwendig ist, um den Anspruch des christlichen Wertesystems auf Universalität zu legitimieren. Es wird betont, dass in einer pluralistischen Gesellschaft ethische Entscheidungen auf intersubjektiv zugänglichen Argumenten basieren müssen, um eine normativen Einigung zu ermöglichen. Der Essay verdeutlicht die Relevanz der Frage nach der Existenz Gottes in aktuellen Debatten der Bioethik, insbesondere in Bezug auf die Definition der Menschenwürde und die ethische Bewertung der Embryonenforschung.
II. Zur Untauglichkeit der bisherigen Versuche eines Gottesbeweises
Dieses Kapitel analysiert die drei gängigen Gottesbeweise - den ontologischen, den kosmologischen und den physiko-theologischen - und stellt deren argumentative Schwächen und Kritikpunkte dar. Der Essay argumentiert, dass die bisherigen Versuche eines Gottesbeweises nicht in der Lage sind, die Existenz Gottes auf eine zwingende und intersubjektiv zugängliche Weise zu belegen. Die Argumentationslinien werden detailliert erläutert und mit kritischen Einwänden konfrontiert.
Schlüsselwörter
Gottesbeweis, christliches Wertesystem, ethische Debatten, Menschenwürde, Bioethik, Embryonenforschung, ontologischer Gottesbeweis, kosmologischer Gottesbeweis, physiko-theologischer Gottesbeweis, Kritik, Argumentationslinie, intersubjektiv zugänglich.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Gottesbeweis gesellschaftlich relevant?
Ein Gottesbeweis könnte das christliche Wertesystem legitimieren und ethische Debatten (z. B. Bioethik) auf eine intersubjektiv nachvollziehbare Basis stellen.
Was ist der ontologische Gottesbeweis?
Ein Argument, das die Existenz Gottes allein aus dem Begriff eines vollkommenen Wesens herleiten will.
Warum kritisierte Kant die Gottesbeweise?
Kant argumentierte, dass die theoretische Vernunft die Existenz Gottes weder beweisen noch widerlegen kann, da Gott kein Gegenstand möglicher Erfahrung ist.
Was besagt der kosmologische Gottesbeweis?
Er schließt von der Existenz der Welt und der Kausalität auf eine „erste Ursache“ (Gott), die selbst nicht verursacht wurde.
Was ist der physiko-theologische Gottesbeweis?
Dieser Beweis schließt aus der Ordnung und Zweckmäßigkeit der Natur auf einen intelligenten Urheber oder Schöpfer.
- Citar trabajo
- Lukas Rieger (Autor), 2012, Zu Relevanz und Untauglichkeit der bisherigen Versuche eines Gottesbeweises, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189342