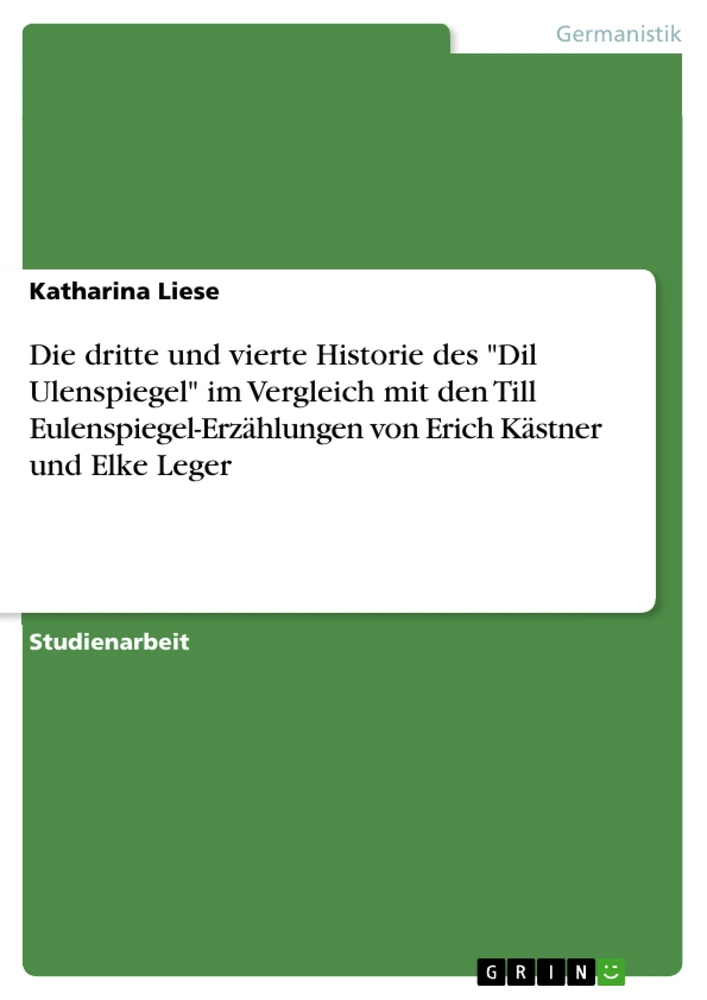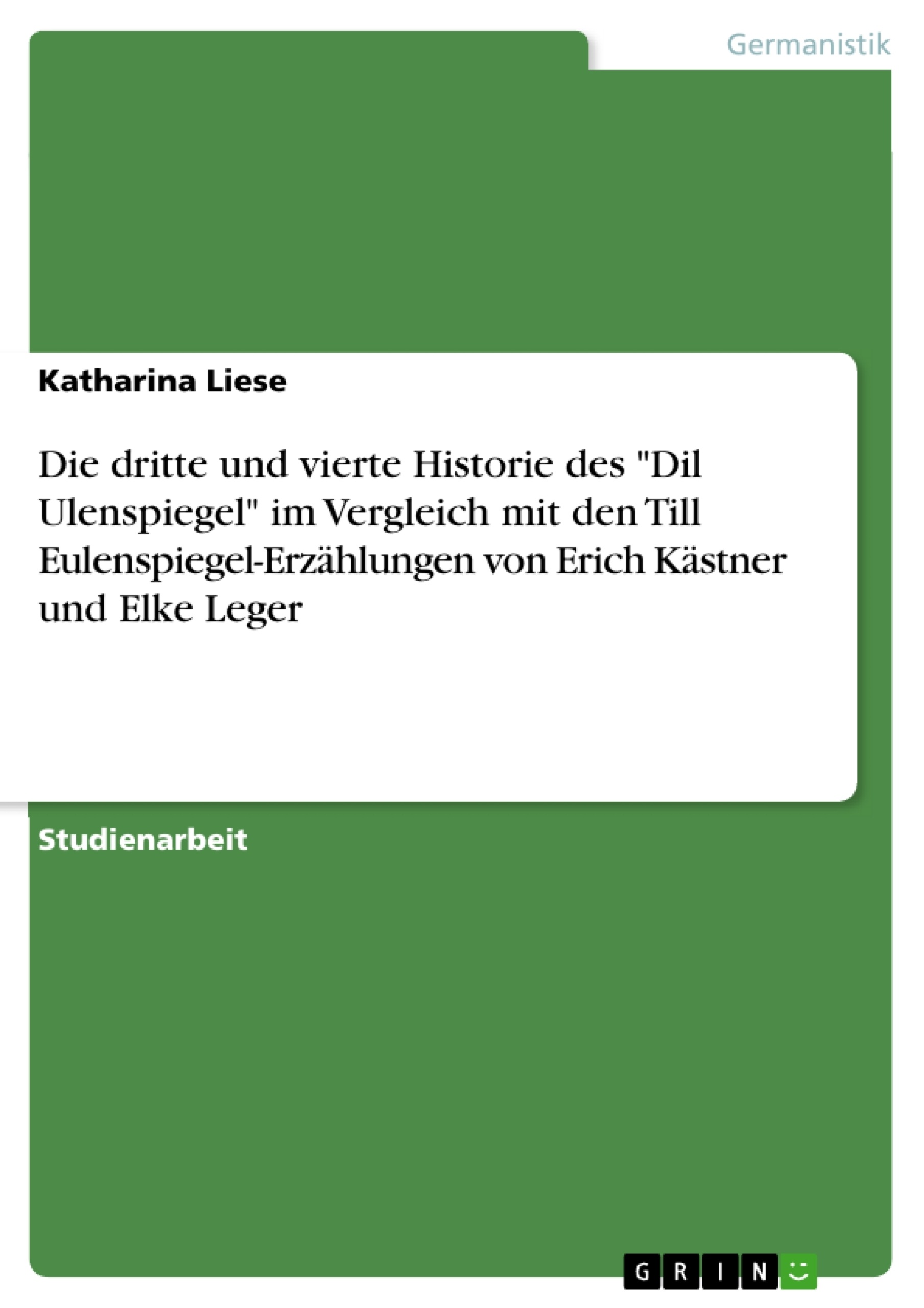Die Till Eulenspiegel-Erzählung von Erich Kästner provoziert in vielerlei Hinsicht. Provozieren (lat. 'provocare') kann mit „herausfordern“ übersetzt werden und genau das ist es, was Till tut, er fordert sein soziales Umfeld heraus. Doch provoziert nicht nur Till Eulenspiegel seine Mitmenschen innerhalb der Geschichten, auch Erich Kästner provoziert seinen Leser. Er wird regelrecht dazu herausgefordert sich eine Meinung über Till Eulenspiegel und seine Schandtaten zu bilden, wobei diese häufig mit den eigenen Moralvorstellungen zu kollidieren scheint. Dennoch empfindet der Leser Mitleid, sowie Sympathien für Till und kann mit ihm über die Opfer seiner Streiche lachen. Hierbei bewegt sich der Leser auf einem schmalen Grat zwischen der Verurteilung Tills für seine moralisch nicht vertretbaren Taten und der Empathie für diesen Schelm. Dieser Gratwanderung, die Erich Kästner, sowie auch Elke Leger in ihren Eulenspiegel-Erzählungen vollziehen, werde ich mich im Folgenden zuwenden. Hierbei wird die Frage zentral sein, wodurch es den Autoren gelingt die Lesersympathien für Till Eulenspiegel zu wecken. Dazu werde ich die Historien von Dil Ulenspiegel mit der Eulenspiegel-Erzählung von Erich Kästner und einer weiteren Bearbeitung von Elke Leger vergleichen. Aufgrund der Vielfalt an Historien werde ich mich hauptsächlich auf die dritte und vierte Historie, beziehungsweise auf die Geschichte Wie Eulenspiegel auf dem Seil tanzte beziehen. Zu diesem Zweck werde ich mich zunächst mit Tills Rache an den Kneitlingern befassen und aufzeigen, wodurch es den Autoren gelingt, Sympathien für Till zu schaffen, obwohl dieser unmoralisch handelt. In einem nächsten Punkt werde ich mich der, bei Kästner anzutreffenden, Verbindung von Till Eulenspiegels Streichen mit dem Tod seines Vaters zuwenden und unter einem weiteren Punkt aufzeigen, dass sowohl die Version von Elke Leger, wie auch die von Erich Kästner eine Lehre intendieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tills Rache an den Kneitlingern
- Der Tod des Vaters
- Die Moral von der Geschicht'
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Provokation und der Lesersympathie, die durch die Till Eulenspiegel-Erzählung von Erich Kästner erzeugt werden. Sie untersucht, wie Kästner und Elke Leger in ihren Bearbeitungen des Stoffes die Lesersympathie für Till Eulenspiegel trotz seiner unmoralischen Taten wecken.
- Analyse der Provokation in Kästners Eulenspiegel-Erzählung
- Vergleich der Historien von Dil Ulenspiegel mit der Bearbeitung von Kästner und Leger
- Untersuchung des Einflusses von Tills Rache auf die Lesersympathie
- Verbindung zwischen Tills Streichen und dem Tod seines Vaters
- Die Intention der Autoren, eine Lehre in ihren Erzählungen zu vermitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die zentralen Fragestellungen dar. Sie analysiert die Provokation, die sowohl Till Eulenspiegel in Kästners Erzählung als auch Kästner selbst gegenüber dem Leser ausüben. Die Arbeit widmet sich insbesondere dem Vergleich der Historien von Dil Ulenspiegel mit den Bearbeitungen von Erich Kästner und Elke Leger.
Tills Rache an den Kneitlingern
Dieser Abschnitt untersucht, wie Kästner durch die Konstruktion der Figuren und die Darstellung des Verhaltens der Kneitlinger die Lesersympathie für Till Eulenspiegel trotz seiner Rachemotive weckt. Er vergleicht Kästners Bearbeitung mit der Version von 1515 und zeigt auf, wie Kästner durch negative Konnotationen der Kneitlinger den Leser für Till einnimmt.
Häufig gestellte Fragen
Warum weckt Till Eulenspiegel trotz seiner Taten Sympathie?
Autoren wie Kästner nutzen negative Charakterisierungen der Opfer (z.B. die Kneitlinger), wodurch Tills Streiche als gerechtfertigte Rache oder Entlarvung von Heuchelei wahrgenommen werden.
Was unterscheidet Kästners Eulenspiegel von der Originalfassung (1515)?
Kästner modernisiert die Sprache, mildert teilweise die Grausamkeit und fügt psychologische Elemente hinzu, wie etwa die Verbindung von Tills Verhalten zum Tod seines Vaters.
Was ist die "Moral von der Geschicht'" in den modernen Fassungen?
Sowohl Kästner als auch Leger intendieren eine Lehre: Till hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und fordert den Leser heraus, über eigene Moralvorstellungen nachzudenken.
Worum geht es in der Geschichte "Wie Eulenspiegel auf dem Seil tanzte"?
Es ist eine zentrale Historie, in der Till durch seine Geschicklichkeit und Schadenfreude die Schaulustigen provoziert und sich an denen rächt, die ihn zuvor verspottet haben.
Was bedeutet Provokation im Kontext von Till Eulenspiegel?
Till fordert sein soziales Umfeld heraus (lat. 'provocare'), indem er Normen bricht und die Dummheit oder Gier seiner Mitmenschen bloßstellt.
- Quote paper
- Katharina Liese (Author), 2009, Die dritte und vierte Historie des "Dil Ulenspiegel" im Vergleich mit den Till Eulenspiegel-Erzählungen von Erich Kästner und Elke Leger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189373