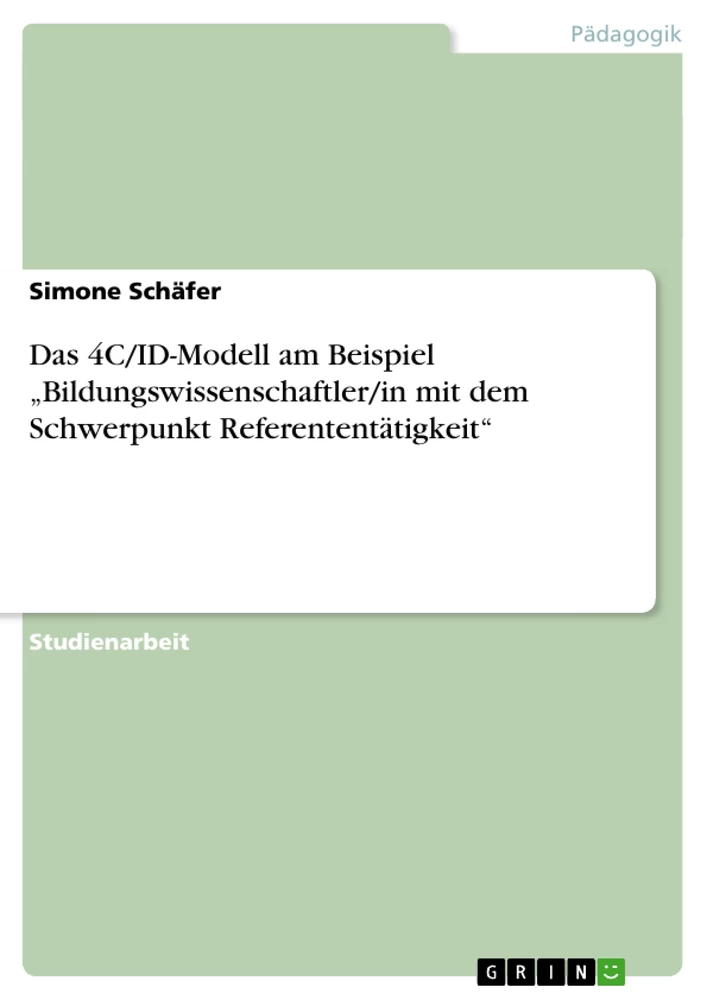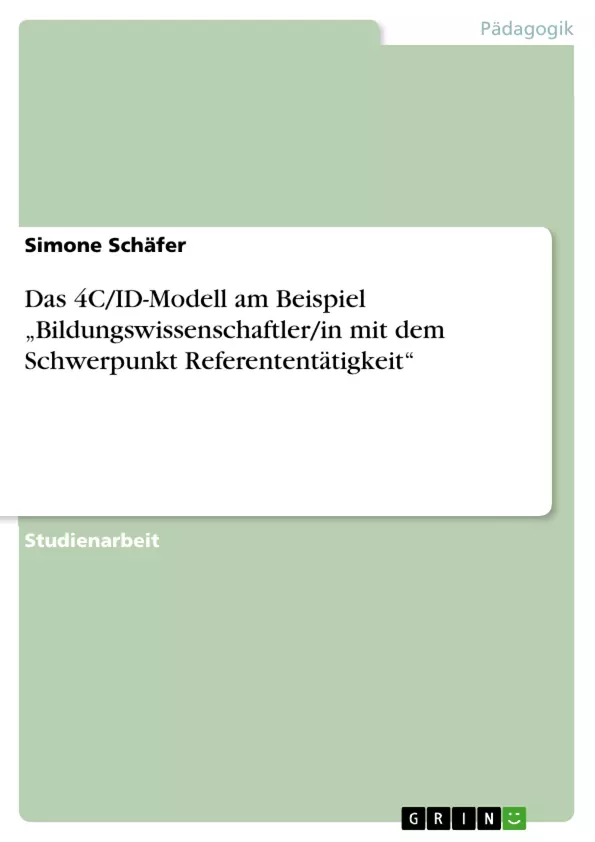Lebenslanges Lernen, Informationsgesellschaft, technischer Fortschritt - dies
sind nur einige wenige Schlagworte, die abbilden, welch tiefgreifende Veränderungen
nicht nur unsere westlichen Gesellschaften in den letzten Dekaden
erfahren haben. Die Folgen zeigen sich zwangsläufig besonders im Bereich
der Bildung, deren Aufgabe sich ja nicht in der Vermittlung einer zunächst
zweckfreien Geistesbildung erschöpft. Insbesondere die Berufsaus- und Fortbildung
sollen es dem Menschen ermöglichen, mit der Entwicklung der beruflichen
Lebenswelt Schritt zu halten, die mehr und mehr ganzheitliche Problemlösungsstrategien
sowie selbstgesteuerten Transfer erlernten Wissens auf unterschiedliche
Aufgabenstellungen erfordert.
Die vorliegende Arbeit stellt ein Instruktionsdesign-Modell vor, das aus diesen
Anforderungen hervorgegangen ist und darauf abzielt, durch den Einsatz authentischer
Lernumgebungen und -aufgaben das Erlernen komplexer kognitiver
Fähigkeiten zu unterstützen.
Es werden im Folgenden die Grundannahmen des Four Component Instructional
Design Models (4C/ID-Modell) dargelegt, um daran anschließend einen
Lehrplan für einen Bildungswissenschaftler1 mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit
zu entwerfen. Fertigkeitenhierarchie, vereinfachende Annahmen,
Lernaufgaben sowie unterstützende und Just-in-time-Informationen werden
anhand dieses Berufsbildes konkretisiert. Der zweite Teil stellt einige lerntheoretische
Überlegungen an und geht auf didaktische Szenarien und Medien ein.
Zusammenfassung und eigenes Fazit schließen die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundannahmen zum 4C/ID Modell
- 3 Das 4C/ID-Modell in der praktischen Anwendung: Bildungswissenschaftler/in mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit
- 3.1 Analyse der Kompetenz: Die Fertigkeitenhierarchie
- 3.2 Sequenzprinzip: Vereinfachende Annahmen und Aufgabenklassen
- 3.3 Praktische Umsetzung: Entwurf der Lernaufgaben
- 3.4 Hilfestellungen im Lernprozess
- 3.4.1 Unterstützende Informationen
- 3.4.2 Just-in-time-Informationen
- 4 Das 4C/ID-Modell in der Theorie
- 4.1 Lerntheoretische Überlegungen und Aspekte des situierten Lernens
- 4.2 Didaktische Szenarien zur Integration in das 4C/ID-Modell
- 4.3 Geeignete Medien zur Unterstützung des Blueprints
- 5 Fazit: Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert das Four Component Instructional Design Model (4C/ID-Modell) und wendet es auf die Ausbildung von Bildungswissenschaftlern mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit an. Ziel ist es, die Anwendung des Modells zur Vermittlung komplexer kognitiver Fähigkeiten in einer authentischen Lernumgebung zu demonstrieren.
- Anwendung des 4C/ID-Modells in der beruflichen Bildung
- Analyse und Zerlegung komplexer Kompetenzen in Teilfertigkeiten
- Gestaltung authentischer Lernaufgaben und -umgebungen
- Integration unterstützender und Just-in-time-Informationen
- Lerntheoretische Grundlagen des situierten Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, der sich mit den Herausforderungen des lebenslangen Lernens und der Notwendigkeit zur Vermittlung komplexer Problemlösungsstrategien in der beruflichen Bildung auseinandersetzt. Sie führt das 4C/ID-Modell als ein geeignetes Instruktionsdesign-Modell ein, welches den Fokus auf authentisches Lernen und die Integration von Fertigkeiten legt und dessen Anwendung anhand des Berufsbildes eines Bildungswissenschaftlers mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit illustriert wird.
2 Grundannahmen zum 4C/ID Modell: Dieses Kapitel stellt die vier Kernkomponenten des 4C/ID-Modells vor: authentische Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen und Part-task Practice. Es erklärt, wie diese Komponenten zusammenwirken, um den Erwerb komplexer kognitiver Fähigkeiten zu fördern. Der Fokus liegt auf dem ganzheitlichen Lernen und der Integration verschiedener Fertigkeiten im Kontext realitätsnaher Aufgaben.
3 Das 4C/ID-Modell in der praktischen Anwendung: Bildungswissenschaftler/in mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit: Dieses Kapitel demonstriert die praktische Anwendung des 4C/ID-Modells anhand des Beispiels eines Bildungswissenschaftlers mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit. Es erläutert die Analyse der Kompetenz, das Sequenzprinzip, den Entwurf von Lernaufgaben und die Bereitstellung von unterstützende und Just-in-time-Informationen. Der Schwerpunkt liegt auf der Zerlegung der komplexen Kompetenz in Teilfertigkeiten und deren Integration in einem authentischen Lernszenario.
4 Das 4C/ID-Modell in der Theorie: Dieses Kapitel vertieft die lerntheoretischen Grundlagen des 4C/ID-Modells, insbesondere Aspekte des situierten Lernens. Es diskutiert geeignete didaktische Szenarien und Medien zur Unterstützung des Lernprozesses. Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis des 4C/ID-Modells wird hier hergestellt.
Schlüsselwörter
4C/ID-Modell, Instruktionsdesign, Handlungswissen, Kompetenzanalyse, Fertigkeitenhierarchie, authentische Lernaufgaben, situiertes Lernen, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen, Part-task Practice, Bildungswissenschaft, Referententätigkeit, komplexe kognitive Fähigkeiten.
Häufig gestellte Fragen zum 4C/ID-Modell in der Ausbildung von Bildungswissenschaftlern
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit präsentiert das Four Component Instructional Design Model (4C/ID-Modell) und dessen Anwendung auf die Ausbildung von Bildungswissenschaftlern mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit. Der Fokus liegt auf der Vermittlung komplexer kognitiver Fähigkeiten in authentischen Lernumgebungen.
Was ist das 4C/ID-Modell?
Das 4C/ID-Modell ist ein Instruktionsdesign-Modell, das auf vier Kernkomponenten basiert: authentische Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen und Part-task Practice. Diese Komponenten fördern den Erwerb komplexer kognitiver Fähigkeiten durch ganzheitliches Lernen und die Integration verschiedener Fertigkeiten in realitätsnahen Aufgaben.
Welche Kompetenzen werden im Rahmen des 4C/ID-Modells vermittelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Vermittlung komplexer kognitiver Fähigkeiten im Kontext der Referententätigkeit von Bildungswissenschaftlern. Dies beinhaltet die Analyse und Zerlegung komplexer Kompetenzen in Teilfertigkeiten und deren Anwendung in authentischen Lernszenarien.
Wie wird das 4C/ID-Modell in der Praxis angewendet?
Die praktische Anwendung wird anhand des Beispiels eines Bildungswissenschaftlers mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit demonstriert. Dies beinhaltet die Kompetenzanalyse, die Entwicklung von Lernaufgaben nach dem Sequenzprinzip und die Bereitstellung von unterstützenden und Just-in-time-Informationen.
Welche lerntheoretischen Grundlagen liegen dem 4C/ID-Modell zugrunde?
Das Modell basiert auf Aspekten des situierten Lernens. Die Arbeit diskutiert geeignete didaktische Szenarien und Medien zur Unterstützung des Lernprozesses und stellt die Verbindung zwischen Theorie und Praxis des 4C/ID-Modells her.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des 4C/ID-Modells?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: 4C/ID-Modell, Instruktionsdesign, Handlungswissen, Kompetenzanalyse, Fertigkeitenhierarchie, authentische Lernaufgaben, situiertes Lernen, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen, Part-task Practice, Bildungswissenschaft, Referententätigkeit, komplexe kognitive Fähigkeiten.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundannahmen zum 4C/ID-Modell, praktische Anwendung des Modells bei Bildungswissenschaftlern (inkl. Kompetenzanalyse, Sequenzprinzip, Lernaufgabendesign und Hilfestellungen), theoretische Grundlagen des Modells (Lerntheorie, didaktische Szenarien, Medien), und ein Fazit mit Bewertung und Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendung des 4C/ID-Modells zur Vermittlung komplexer kognitiver Fähigkeiten in einer authentischen Lernumgebung zu demonstrieren und dessen Nutzen in der beruflichen Bildung aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Simone Schäfer (Autor:in), 2012, Das 4C/ID-Modell am Beispiel „Bildungswissenschaftler/in mit dem Schwerpunkt Referententätigkeit“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189462