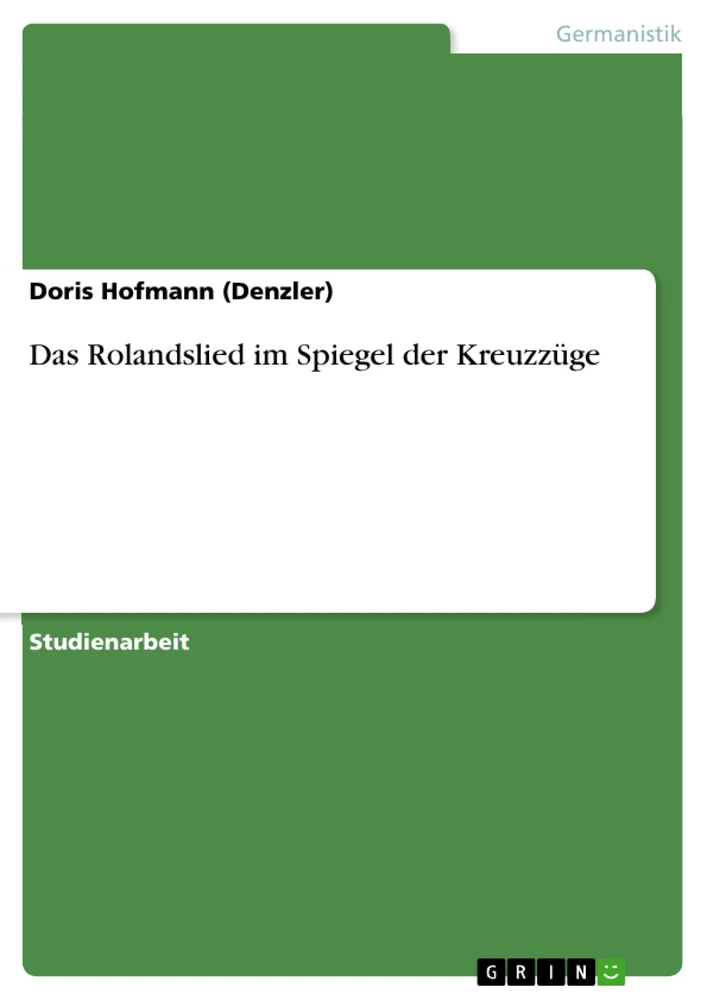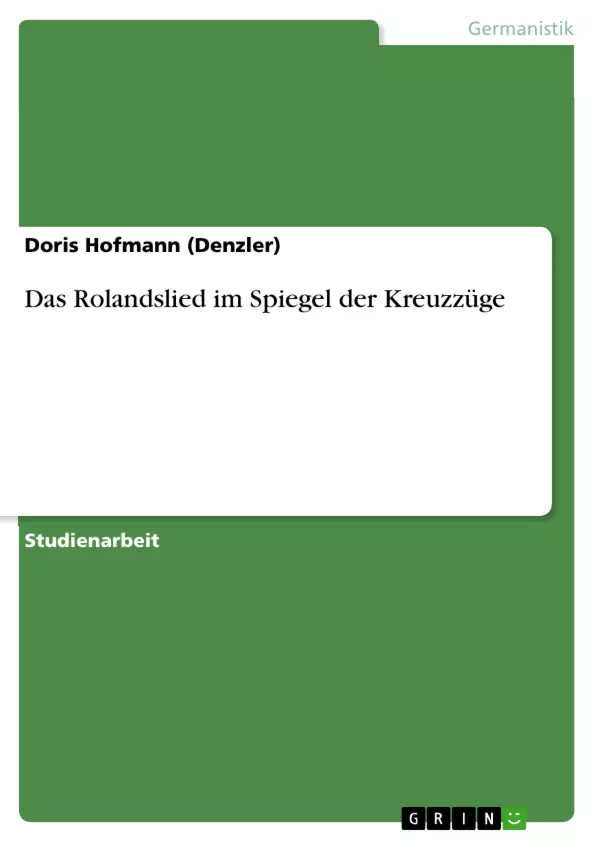Die Kreuzzugsbewegung, die Ende des 11.Jhs einsetzte und bis weit ins 16.Jh. andauerte, war kein seltsames oder kurioses Randphänomen des Hochmittelalters, sondern [...]„die kennzeichnendste Erscheinung des Mittelalters“. So waren alle bedeutenden Persönlichkeiten der Zeit [...] in sie involviert: z.B. Papst Gregor VII [...], Bernhard von Clairvaux [...], Kaiser Friedrich Barbarossa [...] oder Papst Innozenz III.
Aber nicht nur die „Großen“ ließen sich von den Kreuzzügen begeistern. Unzählige Menschen, unabhängig von Nationalität und Standeszugehörigkeit, verließen mit großer Be-geisterung ihre Heimat, um in den Orient zu ziehen. Was beseelte diese Menschen? Sie begaben sich in Gefahr, Besitz und Leben in der Welt zu verlieren, gemäß Joh 12,25:
Wer sein Leben lieb hat, der wird’s verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s erhalten zum ewigen Leben. Oder gemäß Mt 19,29:
Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker ver-lässt um meines Namens willen, der wird’s hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben.
In dieser Haltung findet sich eine Abwertung alles Irdischen zugunsten einer jenseitigen Welt, einer Überordnung des Geistigen über das Weltliche, die durch die clunianzensische Reformbewegung seit dem 10. Jh. in allen Bereichen des christlichen Abendlandes Eingang gefunden hat. In den Kreuzzügen wird den Menschen in diesem Zusammenhang ein großes Ziel vor Augen geführt: der Kampf gegen die Feinde der Christenheit. Um alle Christen von der Dringlichkeit der Befreiung der heiligen Stätten zu überzeugen, hielt Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont 1095 die erste Kreuzpredigt und verhieß allen Kreuzrittern einen Sündenablass. Seitdem wurden die Menschen fast zwei Jahrhunderte lang in unzähligen Kreuzpredigten und etlichen päpstlichen Bullen immer wieder zum Kreuzzug aufgerufen und dafür begeistert.
Der Niederschlag der in diesen Predigten und Bullen enthaltenen Vorstellungen und Ge-danken entwickelte sich zum Allgemeingut und lässt sich in einer großen Anzahl literari-scher Werke der Zeit finden. Als eines der hervorragendsten Beispiele dafür gilt das RL des Pfaffen Konrad, von dem MERTENS behauptet, dass es sich hier um „die geschlossenste mhd. Darstellung der Kreuzzugsideologie im 12. Jh.“ handelt.
Inhaltsverzeichnis
- A: Vorwort
- B: Hauptteil
- 1. ChR und RL: Das historische Fundament und die Karlsverehrung ab dem 9. Jh.
- 1.1 Das historische Fundament der ChR und des RL
- 1.2 Überblick über die Karlsverehrung vom 9. Jh. bis ins 12. Jh.
- 1.2.1 Von der frühen Karlsverehrung hin zur Chanson de geste
- 1.2.2 Herrschaftsthema und Kreuzzugsthema in der ChR
- 1.2.3 Die Karlsverehrung unter Friedrich Barbarossa
- 1.2.4 Die Karlsverehrung im RL durch Heinrich d. Löwen
- 2. Die Kreuzzugsthematik in der ChR und im RL
- 2.1 Fragen zu Datierung, Verfasserschaft und Entstehung der ChR
- 2.2 Kreuzzugsthematik und Patriotismus in der ChR
- 2.2.1 Die Gottesfriedensbewegung
- 2.2.2 Die Darstellung der miles Christi
- 2.2.3 Die Darstellung des Spanienfeldzugs
- 2.2.4 Parallelen zum Kreuzzugsaufruf Urban II in Clermont 1095
- 2.2.5 Der fränkische Imperialismus und die französische Heimatliebe
- 2.3 Datierung und Verfasserschaft des RL
- 2.4 Konrads religiöse Umgestaltung der ChR
- 2.4.1 Die Erweiterung des Karlsbildes als miles Christi
- 2.4.2 Gottesstreiter und Helden
- 2.4.3 Die Befreiung der ChR vom fränkischen Imperiumsgedanken
- 3. Die historische Kreuzzugsideologie in den vier Predigten des RL
- 3.1 Karls erste Predigt (VV.87–106)
- 3.2 Rolands Predigt (VV.146-156)
- 3.3 Karls zweite Predigt (VV.181–221)
- 3.4 Turpins Predigt (VV.243–272)
- 4. Konrads Verhältnis zum Kreuzritterideal des 12. Jh.s
- 4.1 Der innere und äußere Kampf der miles Christi
- 4.2 Der religiöse Antrieb der Gottesstreiter
- 4.3 Die Umsetzung des idealen Kreuzfahrers durch Konrad
- C: Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Rolandslied des Pfaffen Konrad im Kontext der Kreuzzugsbewegung. Sie befasst sich mit der Frage, wie weit das Werk die Kreuzzugsidee widerspiegelt und die Ideen aus den Kreuzpredigten und schriftlichen Zeugnissen seiner Zeit aufgreift. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Konrads Verhältnis zum Kreuzritterideal des 12. Jahrhunderts und der Frage, wie sich sein Werk von der französischen Chanson de Roland unterscheidet.
- Die Rolle der Chanson de Roland als Quelle für das Rolandslied
- Die Darstellung der Kreuzzugsideologie im Rolandslied
- Konrads Verhältnis zum Kreuzritterideal des 12. Jahrhunderts
- Die historische und literarische Bedeutung des Rolandsliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Erörterung des historischen Fundaments der Chanson de Roland und des Rolandsliedes. Dabei werden die historischen Ereignisse, die den Hintergrund der beiden Werke bilden, beleuchtet, sowie die Entwicklung der Karlsverehrung vom 9. bis ins 12. Jahrhundert. Im zweiten Kapitel widmet sich die Arbeit der Kreuzzugsthematik in der Chanson de Roland und dem Rolandslied, wobei die Darstellung des Kreuzzugsgedankens und die Parallelen zu den Kreuzzugsaufrufen des Papstes Urban II im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel befasst sich mit der historischen Kreuzzugsideologie in den vier Predigten des Rolandsliedes. Im vierten Kapitel wird Konrads Verhältnis zum Kreuzritterideal des 12. Jahrhunderts beleuchtet und untersucht, wie er das ideale Kreuzfahrerbild in seinem Werk umsetzt.
Schlüsselwörter
Rolandslied, Chanson de Roland, Kreuzzugsbewegung, Kreuzzugsideologie, Karl der Große, miles Christi, Gottesstreiter, Pfaffe Konrad, historische Quellen, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Rolandslied" des Pfaffen Konrad?
Es ist eine mittelhochdeutsche Adaption der französischen "Chanson de Roland", die als eine der geschlossensten Darstellungen der Kreuzzugsideologie des 12. Jahrhunderts gilt.
Wie hängen das Rolandslied und die Kreuzzüge zusammen?
Das Werk spiegelt die Ideale der Kreuzzugsbewegung wider, insbesondere den Kampf gegen die Feinde der Christenheit und die Verheißung des Seelenheils für die Kämpfer.
Was bedeutet der Begriff "miles Christi"?
Er bezeichnet den "Ritter Christi" oder Gottesstreiter, ein Ideal des christlichen Kriegers, das im Rolandslied auf Karl den Großen und seine Helden projiziert wird.
Welche Rolle spielt Karl der Große in diesem Werk?
Karl wird als idealer christlicher Herrscher und Anführer eines Kreuzzugs dargestellt, dessen Handeln religiös legitimiert ist.
Wie unterscheidet sich Konrads Fassung vom französischen Original?
Konrad nimmt eine religiöse Umgestaltung vor, indem er den fränkischen Imperialismus zugunsten einer universellen christlichen Kreuzzugsideologie zurückstellt.
- Arbeit zitieren
- Doris Hofmann (Denzler) (Autor:in), 2011, Das Rolandslied im Spiegel der Kreuzzüge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189481