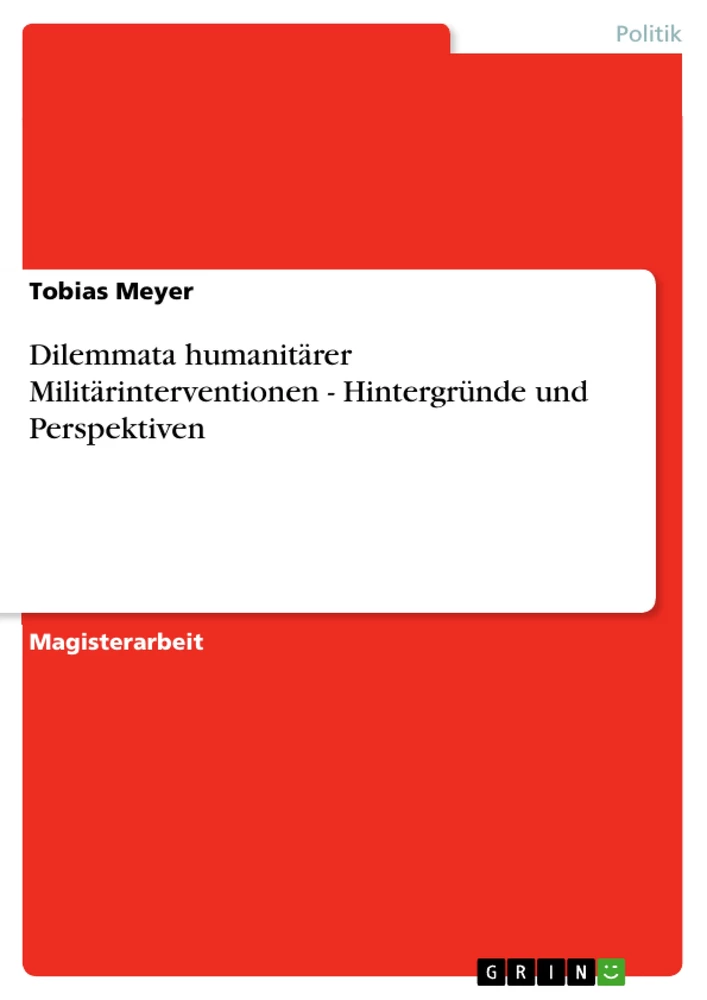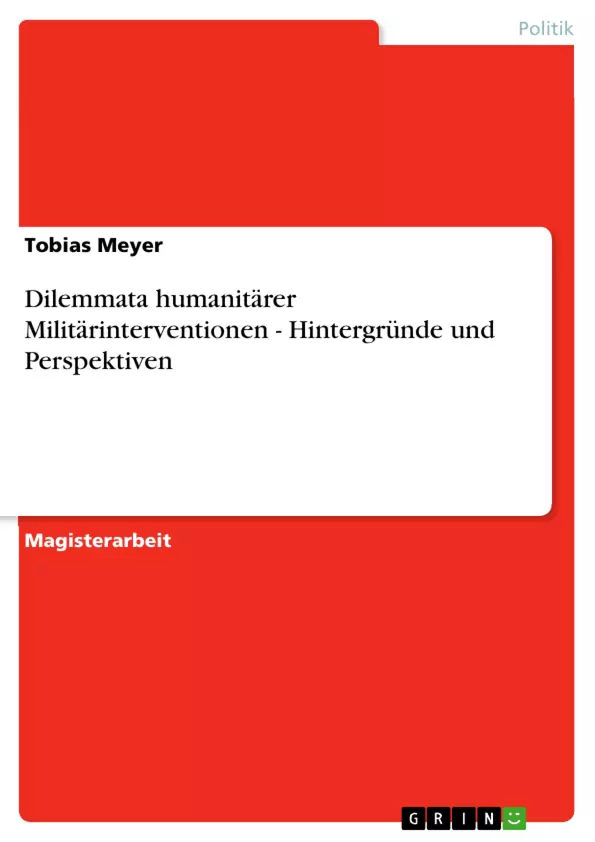Das Thema der vorliegenden Arbeit ist der Einsatz von Militärgewalt zum Schutz von Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen: die humanitäre Militärintervention.
Unbestreitbar ist „[d]ie Anwendung von Gewalt […] in jedem Falle ein Ausdruck für das Scheitern der Politik, die bei der vorbeugenden Konfliktverhütung versagt hat“ (Vogt 1997, S13), aber wie Hinsch und Janssen gleichzeitig feststellen, „[d]en Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen zu sagen, man dürfe sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Gewalt schützen, weil man sie bei rechtzeitiger Konfliktprävention zu einem früheren Zeitpunkt auch ohne Gewalt hätte schützen können, erscheint uns als eine makabre Kasuistik des politischen Pazifismus.“ (Hinsch/Janssen 2006, S.39) Eine solche Situation, in der eine Möglichkeit gefunden werden muss, schwere Menschenrechtsverletzungen aufzuhalten, zwingt den Akteuren eine klare Entscheidung auf, da auch das Ausweichen einer Antwort einer verneinenden Antwort zum Handeln insgesamt und damit auch zur Auseinandersetzung mit dem Konzept der humanitären militärischen Intervention gleichkommt. Wer sich für eine solche Intervention ausspricht, der trägt die Verantwortung für einen Militäreinsatz mit all seinen Folgen. Wer sich dagegen ausspricht, der lässt möglicherweise zu, dass die Menschenrechtsverletzungen ungehindert weitergehen. Jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist gefangen im Dilemma zwischen der Schuld durch eigenes Handeln (durch Zustimmung zum Einsatz von Militärgewalt) und der Schuld durch Unterlassen einer Handlung (durch Tatenlosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen).
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit soll jedoch nicht auf der Debatte liegen, ob humanitäre militärische Intervention grundsätzlich erlaubt oder verboten sein sollte, sondern auf den faktischen Problemen, die dem Konzept innewohnen, sobald man die Intervention als Mittel zum Menschenrechtsschutz gewählt hat. Der zweite Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer Untersuchung der Möglichkeiten zur Auflösung der vorher aufgezeigten Dilemmata, um damit schließlich zu einem umfassenden Gesamtbild der humanitären militärischen Intervention als Konzept zum Schutz der Menschenrechte in der Gegenwart und näheren Zukunft zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Idee der humanitären militärischen Intervention
- Definition: Humanitäre militärische Intervention
- Konzeptionelle Debatten
- Der gerechte Grund: Moralische Argumente zur Intervention
- Die rechte Intention: Absichten und Hintergedanken der Intervention
- Die Intervention als letztes Mittel: Verschiedene Sichten
- Die Verhältnismäßigkeit der Mittel: Angemessen handeln
- Die Chancen auf Erfolg: Abwägung der Interventionsziele
- Die rechte Autorität: Intervention und internationales Recht
- Dilemmata humanitärer militärischer Interventionen: Darstellung und Einordnung
- Moralische Dilemmata
- Gewalt vs. Gegengewalt
- Töten gewähren lassen vs. Töten um zu retten
- Rechtliche Dilemmata
- Völkerrecht vs. moralisch gerechte Handlung
- Staatssouveränität vs. universelle Menschenrechte
- Anerkannte rechte Autorität vs. legitime rechte Autorität
- Politische Dilemmata
- Schutzauftrag vs. internationale Stabilität
- Nicht-Handeln vs. Missbrauch der Intervention
- Gleichbehandlung moralisch identischer Interventionsgründe vs. machtpolitische Realitäten
- Fragwürdige Präventivintervention vs. gerechtfertigte verspätete Intervention
- Extraterritorialer Schutzauftrag vs. Schutz eigener BürgerInnen
- Nicht-Handeln vs. Paternalismus
- Einordnung: Hierarchien und Verknüpfungen
- Moralische Dilemmata
- Auflösung der Dilemmata: Konzepte und Ideen
- Lösungen: Gewaltkomplex
- Lösungen: Autoritätskomplex
- Lösungen: Schutzauftragskomplex
- Zusammenführung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Thematik der humanitären militärischen Intervention und beleuchtet die komplexen Herausforderungen und Dilemmata, die mit diesem Konzept verbunden sind. Sie analysiert die konzeptionellen Debatten und untersucht die moralischen, rechtlichen und politischen Aspekte der Intervention.
- Definition und Abgrenzung der humanitären militärischen Intervention
- Moralische Argumente und Rechtfertigungen für den Einsatz von Gewalt
- Die Rolle des Völkerrechts und der Staatssouveränität
- Die politischen Implikationen und Dilemmata der Intervention
- Mögliche Lösungen und Konzepte zur Bewältigung der Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der humanitären militärischen Intervention anhand des Völkermords in Ruanda 1994 dar. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, Menschenrechtsverletzungen zu stoppen, auch wenn präventive Maßnahmen versagt haben. Die Arbeit fokussiert auf die humanitäre militärische Intervention als ein Mittel zur Beendigung von Gewalt und zum Schutz der Menschenrechte.
Die Idee der humanitären militärischen Intervention
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den konzeptionellen Debatten rund um die humanitäre militärische Intervention. Es werden die moralischen, rechtlichen und politischen Argumente für und gegen Interventionen diskutiert. Die Aspekte der Intervention als letztes Mittel, der Verhältnismäßigkeit der Mittel, der Erfolgschancen und der rechtlichen Autorität werden beleuchtet.
Dilemmata humanitärer militärischer Interventionen: Darstellung und Einordnung
Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Dilemmata, die mit humanitären militärischen Interventionen einhergehen. Es untersucht die moralischen, rechtlichen und politischen Spannungsfelder, die bei Interventionen auftreten. Zu den behandelten Themen gehören die Abwägung von Gewalt und Gegengewalt, die Konflikte zwischen Völkerrecht und moralischen Handlungsgrundsätzen, die Balance zwischen Staatssouveränität und universellen Menschenrechten sowie die politischen Herausforderungen der Intervention.
Auflösung der Dilemmata: Konzepte und Ideen
In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte und Ideen zur Auflösung der Dilemmata der humanitären militärischen Intervention vorgestellt. Es werden Lösungsansätze für die Bereiche des Gewaltkomplexes, des Autoritätskomplexes und des Schutzauftragskomplexes präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie humanitäre militärische Intervention, Menschenrechte, Völkerrecht, Staatssouveränität, Gewaltprävention, Dilemma, Konflikt, Schutzauftrag, Moral, Recht, Politik, sowie Konzepte wie Präventivintervention, Verhältnismäßigkeit, Legitimität, Erfolgschancen und die Rolle internationaler Organisationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine humanitäre Militärintervention?
Es handelt sich um den Einsatz militärischer Gewalt durch externe Akteure, um Menschen innerhalb eines Staates vor schweren Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord zu schützen.
Welches zentrale moralische Dilemma besteht bei solchen Interventionen?
Akteure stehen vor der Wahl zwischen der „Schuld durch Handeln“ (Gewaltanwendung) und der „Schuld durch Unterlassen“ (Tatenlosigkeit angesichts von Gräueltaten).
Wie steht die humanitäre Intervention im Konflikt mit dem Völkerrecht?
Es gibt ein Spannungsfeld zwischen der staatlichen Souveränität (Nichteinmischungsgebot) und dem Schutz universeller Menschenrechte.
Was versteht man unter der „rechten Autorität“?
Dies betrifft die Frage, wer legitimiert ist, eine Intervention anzuordnen (z. B. der UN-Sicherheitsrat), und ob eine moralisch gerechte Handlung auch ohne völkerrechtliches Mandat zulässig sein kann.
Wann gilt eine Intervention als „letztes Mittel“ (Ultima Ratio)?
Eine Intervention darf erst in Betracht gezogen werden, wenn alle friedlichen Mittel der Konfliktprävention und Diplomatie ausgeschöpft sind und gescheitert sind.
- Quote paper
- Tobias Meyer (Author), 2009, Dilemmata humanitärer Militärinterventionen - Hintergründe und Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189538