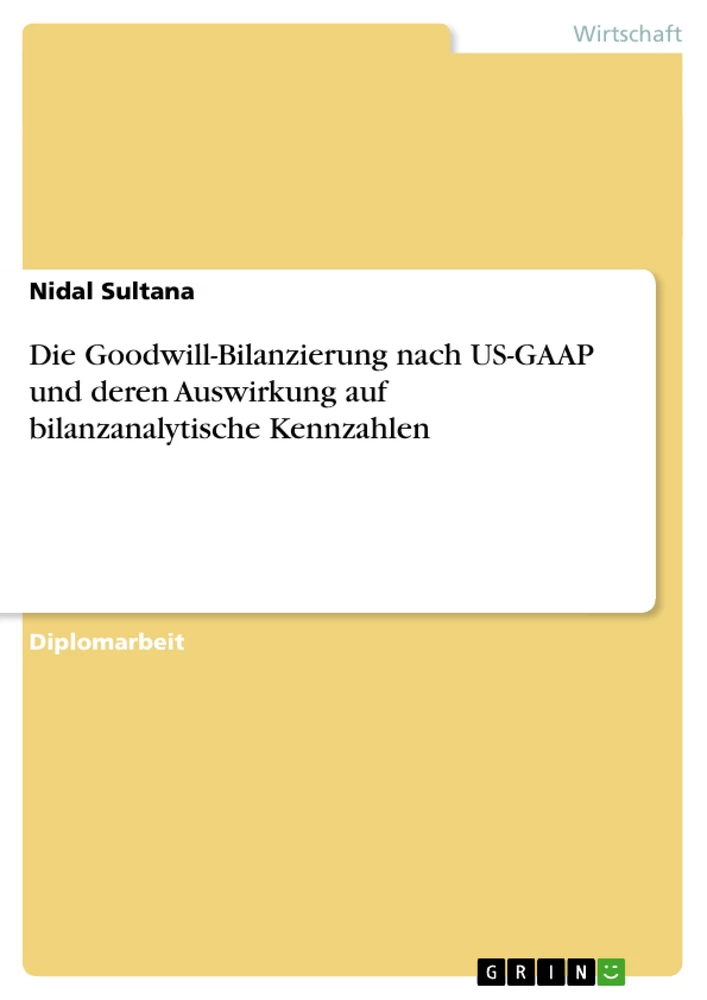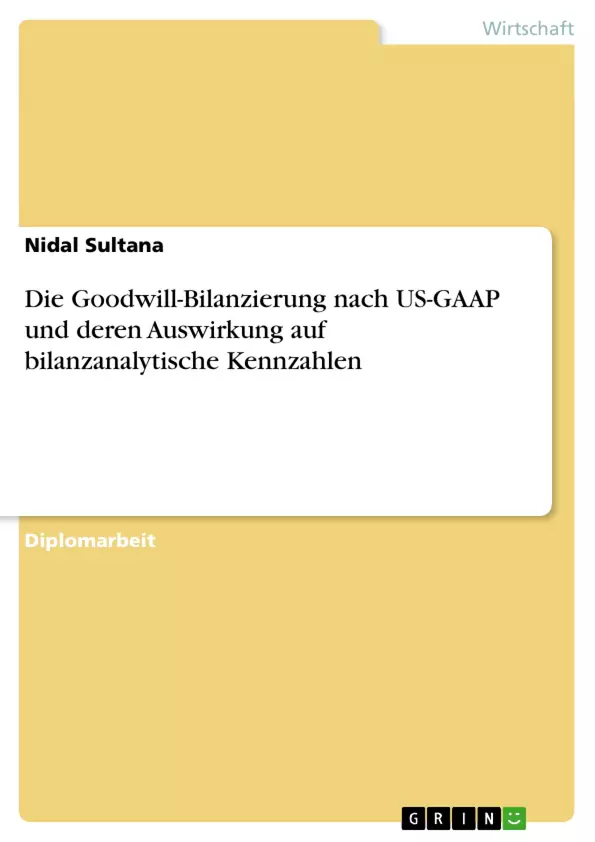Aufgrund der immensen und immer weiter steigenden Bedeutung des Firmenwertes
in den Jahresabschlüssen können schon geringfügige Änderungen
von geltenden Standards die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage erheblich
beeinflussen. Nach der Veröffentlichung der Standards SFAS 141 und
142 zur Bilanzierung des Goodwill durch das FASB am 29.06.2001 folgte eine
Welle der Kritik sowohl durch Theorie als auch durch die Praxis. Das Ziel
des FASB ist es, mittels der neu geschaffenen Regelungen den Informationswert
der Jahresabschlüsse zu erhöhen. Dem Abschlussadressaten soll eine verbesserte
Vergleichbarkeit von Finanzinformationen ermöglicht werden.
Die Standards wirken sich negativ auf bilanzanalytische Kennzahlen aus. Die
Abschreibung des Firmenwerts wurde durch die Reform in Großen Teilen in
das Ermessen des Bilanzierenden gestellt. Weit auslegbare Formulierungen
und hohe Ermessensspielräume lassen die scharfe Kritik von allen Seiten zu.
Wichtige Kennzahlen der Bilanzanalyse wurden auf ihre Einflussmöglichkeiten
und mögliche Einflussszenarien hin untersucht. Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass zur Messung der operativen Geschäftstätigkeiten, zahlungsstromorientierte
Kennzahlen von der Bilanzierung und Bewertung des
Geschäftswerts unberührt bleiben. Aufgrund des nicht monetären Charakters
der Goodwill-Abschreibungen bleibt auch die finanzielle Lage des Unternehmens,
ausgedrückt durch die Kapitalflussrechnung, von dem impairment-onlyapproach
unbeeinflusst. Die durch den Übernahmeboom der vergangenen Jahre
aufgebauten Geschäftswerte drohen das bilanzanalytische Eigenkapital zu
eliminieren. Bei mehreren DAX-30 Unternehmen übersteigt der Goodwill das
wichtige Eigenkapital und gefährdet damit die Sicherheitsreserven der Unternehmen.
Gleichzeitig werden Kennzahlen, die das bilanzanalytische Eigenkapital
zur Berechnung heranziehen in Mitleidenschaft gezogen. Der Jahresüberschuss
wird künftig volatile Trends aufweisen. Fallweise impairments lassen
den Jahresüberschuss dramatisch schmelzen, entsprechende Auslegungen der
Standards lassen den Jahresüberschuss unbelastet von Goodwill Amortisationen. Sämtliche erfolgswirtschaftliche Kennzahlen werden im Zeitverlauf
durch volatilere Jahresüberschüsse unvergleichbar. Analysten empfehlen
daher den Goodwill zwar in der Kapitalstruktur zu belassen, seine Abschreibung
allerdings auszuklammern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Grundlagen und Ziele der Analyse von US-GAAP - Abschlüssen
- 1.1 Begriff der Jahresabschlussanalyse
- 1.2 Allgemeine Grundsätze der internationalen Bilanzanalyse
- 1.2.1 Motivation einer internationalen Bilanzanalyse
- 1.2.2 Ausrichtung der internationalen Bilanzanalyse
- 1.2.3 Grenzen der internationalen Bilanzanalyse
- 1.3 Ausrichtung der Analyse von HGB - Abschlüssen
- 1.4 Ausrichtung der Analyse von US-GAAP – Abschlüssen
- 1.5 Die Datenbasis für die Jahresabschlussanalyse in der US-amerikanischen Rechnungslegung
- 1.6 Bilanzpolitische Spielräume in der US-amerikanischen Rechnungslegung
- 2 Der Goodwill als Problem der Jahresabschlussanalyse
- 2.1 Begriffliche Abgrenzung
- 2.2 Grundzüge der Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP
- 2.2.1 Ansatz und Bewertung bei Erstbilanzierung
- 2.2.2 Ansatz und Bewertung bei Folgebilanzierung
- 2.2.3 Abgrenzung zur handelsrechtlichen Bilanzierung
- 2.3 Der Goodwill in der Jahresabschlussanalyse
- 2.3.1 Bilanzpolitische Ermessensspielräume durch die Goodwill-Bilanzierung
- (1) Ermessensbehaftete Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen
- (2) Ermessensbehaftete Bildung der reporting units
- (3) Ermessensbehaftete Allokation von Vermögensgegenständen und Schulden auf die reporting units
- (4) Ermessensbehaftete Allokation des Goodwill auf die reporting units
- (5) Ermessensbehaftete fair value-Bewertung
- 2.3.2 Ausweis der Behandlung des Goodwill im Jahresabschluss
- 2.3.3 Empirische Studien
- 2.3.4 Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung für die Jahresabschlussanalyse
- 2.3.5 Ansätze für Aufbereitungsmaßnahmen hinsichtlich der Goodwill-Bilanzierung für die Jahresabschlussanalyse
- (1) Verrechnung mit dem Eigenkapital
- (2) Schätzmethodik
- (3) Ausklammerung der Goodwill-Abschreibung
- 2.3.1 Bilanzpolitische Ermessensspielräume durch die Goodwill-Bilanzierung
- 3 Auswirkungen auf zahlungsstromorientierte Kennzahlen
- 3.1 Begriffliche Eingrenzung und Definition des ökonomischen Gewinns
- 3.2 Einflussfaktoren auf den ökonomischen Gewinn
- 3.3 Analyse der Auswirkungen auf den ökonomischen Gewinn durch die neue Goodwill-Bilanzierung
- 3.4 Auswirkungen auf ausgesuchte Kennzahlen zur Messung der Business Performance
- 3.4.1 Begriff und Ermittlung des Cashflow
- 3.4.2 Ansätze der Discounted Cashflow-Verfahren
- 3.4.3 Die Grundkonzeption des Cashflow Return on Investment
- 3.4.4 Das Economic Value Added-Konzept
- 3.4.5 Zusammenfassende Darstellung und Beurteilung der Auswirkungen
- 3.5 Auswirkungen auf klassische finanzwirtschaftliche Kennzahlen
- 3.5.1 Auswirkungen auf die Finanzlage
- 3.5.2 Auswirkungen auf das bilanzanalytische Eigenkapital
- 4 Auswirkungen auf erfolgswirtschaftliche Kennzahlen
- 4.1 Darstellung des operativen Ergebnisses
- 4.2 Die Eigenkapitalrentabilität
- 4.3 Die Gesamtkapitalrentabilität
- 4.4 Das Return on Investment-Konzept
- 4.5 Die Berechnung der Earnings per Share
- 4.6 Zusammenfassende Darstellung und Beurteilung der Auswirkungen
- 5 Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Goodwill nach US-GAAP und den Auswirkungen auf bilanzanalytische Kennzahlen. Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede zwischen der Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP und der handelsrechtlichen Bilanzierung zu beleuchten und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Jahresabschlussanalyse zu untersuchen.
- Die Bedeutung von Goodwill in der Jahresabschlussanalyse
- Die Bilanzierungsvorschriften für Goodwill nach US-GAAP
- Die Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung auf zahlungsstromorientierte Kennzahlen
- Die Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung auf erfolgswirtschaftliche Kennzahlen
- Die Bedeutung der Goodwill-Bilanzierung für die internationale Bilanzanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Grundlagen und Ziele der Analyse von US-GAAP-Abschlüssen. Es werden die allgemeine Motivation, die Ausrichtung und die Grenzen der internationalen Bilanzanalyse dargestellt. Darüber hinaus wird auf die Besonderheiten der US-amerikanischen Rechnungslegung im Vergleich zur deutschen Rechnungslegung eingegangen. Kapitel 2 konzentriert sich auf den Goodwill als Problem der Jahresabschlussanalyse. Es wird eine begriffliche Abgrenzung des Goodwills vorgenommen und die Grundzüge der Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP erläutert. Im weiteren Verlauf werden die Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung auf die Jahresabschlussanalyse und mögliche Ansätze für Aufbereitungsmaßnahmen diskutiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung auf zahlungsstromorientierte Kennzahlen. Hierbei werden die Begriffliche Eingrenzung und Definition des ökonomischen Gewinns sowie die Einflussfaktoren auf den ökonomischen Gewinn betrachtet. Anschließend wird die Analyse der Auswirkungen auf den ökonomischen Gewinn durch die neue Goodwill-Bilanzierung vorgestellt. Kapitel 4 behandelt die Auswirkungen der Goodwill-Bilanzierung auf erfolgswirtschaftliche Kennzahlen. Es werden verschiedene Kennzahlen, wie die Eigenkapitalrentabilität, die Gesamtkapitalrentabilität und das Return on Investment-Konzept, im Hinblick auf die Goodwill-Bilanzierung betrachtet.
Schlüsselwörter
Goodwill-Bilanzierung, US-GAAP, Jahresabschlussanalyse, bilanzanalytische Kennzahlen, zahlungsstromorientierte Kennzahlen, erfolgswirtschaftliche Kennzahlen, ökonomischer Gewinn, Cashflow, Discounted Cashflow-Verfahren, Economic Value Added.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Goodwill (Firmenwert) in der Bilanzierung?
Goodwill ist der Betrag, den ein Käufer bei einer Unternehmensübernahme über den Marktwert der identifizierbaren Vermögenswerte hinaus zahlt, oft basierend auf Synergieerwartungen oder Markenreputation.
Wie hat sich die Goodwill-Bilanzierung durch SFAS 141 und 142 verändert?
Unter US-GAAP wurde die planmäßige Abschreibung des Goodwills abgeschafft und durch den „impairment-only-approach“ ersetzt, bei dem nur bei tatsächlicher Wertminderung abgeschrieben wird.
Welche Kritik gibt es am „impairment-only-approach“?
Kritisiert werden die hohen Ermessensspielräume der Manager, die Abschreibungen hinauszögern oder durch subjektive Bewertungen der „reporting units“ beeinflussen können.
Wie wirkt sich Goodwill auf die Eigenkapitalrentabilität aus?
Da Goodwill das bilanzielle Eigenkapital erhöht, sinkt bei gleichbleibendem Gewinn die Rentabilitätskennzahl, was die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen erschweren kann.
Warum bleiben zahlungsstromorientierte Kennzahlen vom Goodwill unberührt?
Da Goodwill-Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind (nicht-monetärer Charakter), haben sie keinen direkten Einfluss auf den Cashflow oder die Kapitalflussrechnung.
Was empfehlen Analysten im Umgang mit Goodwill in der Bilanzanalyse?
Oft wird empfohlen, den Goodwill zwar in der Kapitalstruktur zu belassen, seine Abschreibungen jedoch bei der Erfolgsrechnung auszuklammern, um die operative Leistung besser beurteilen zu können.
- Quote paper
- Nidal Sultana (Author), 2003, Die Goodwill-Bilanzierung nach US-GAAP und deren Auswirkung auf bilanzanalytische Kennzahlen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18953