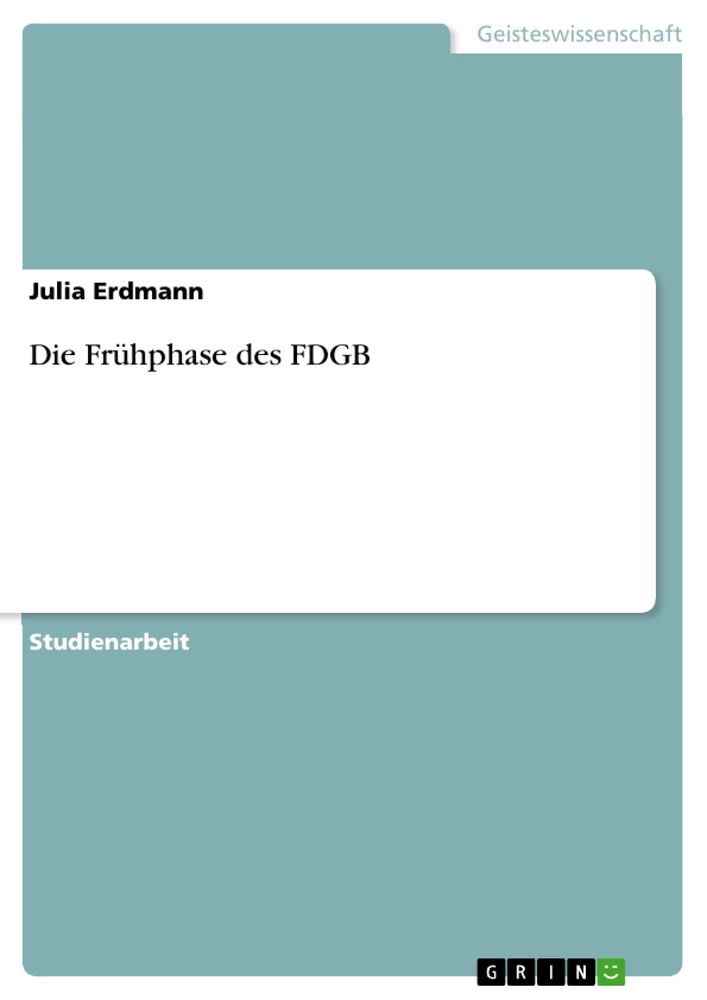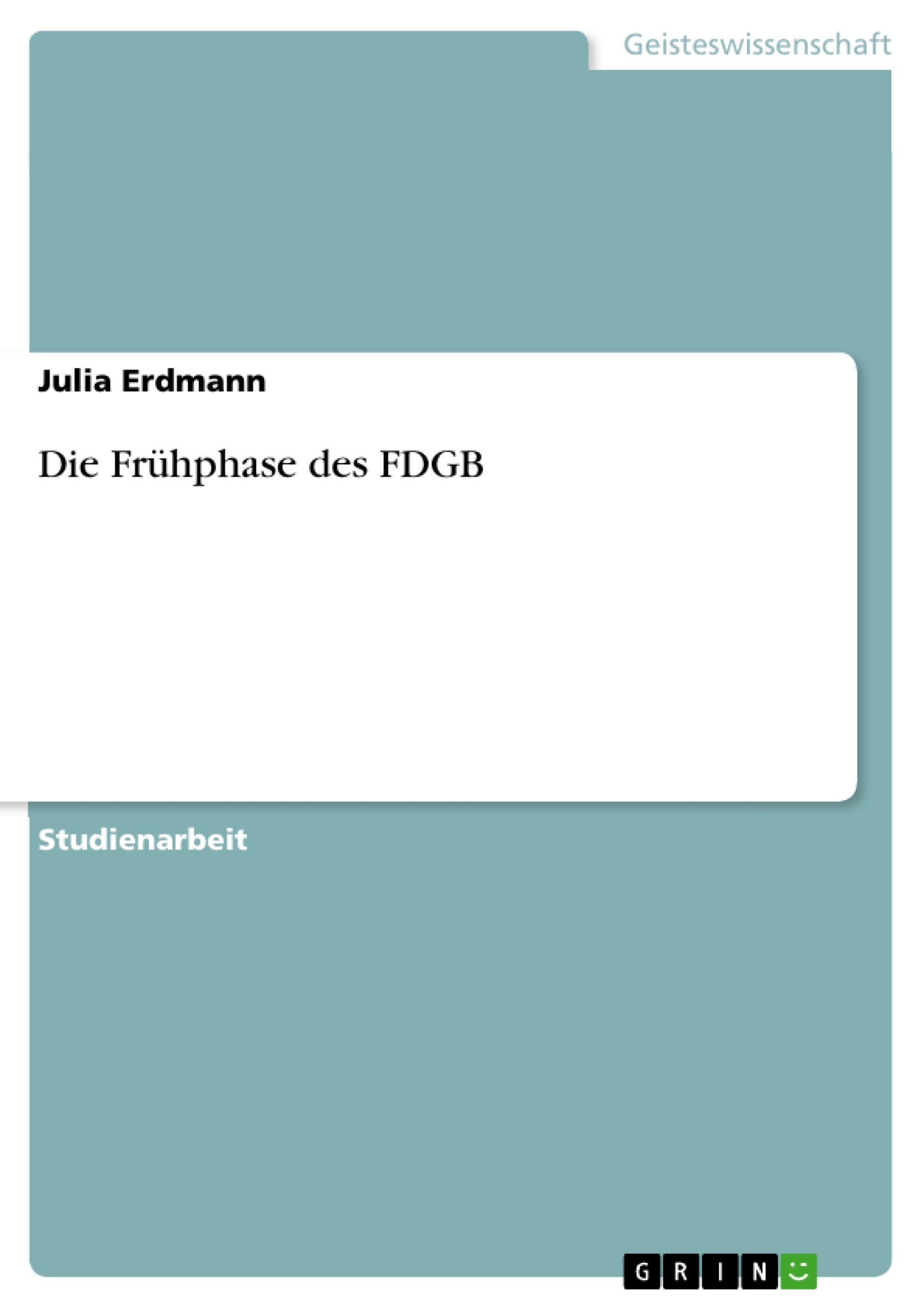Der 17. Juni 1953, der Tag des Juni-Aufstandes der Arbeiter in der DDR, ist bis heute ein Datum, um das sich viele Legenden ranken. Die Adenauerregierung der BRD erklärte dieses Datum schon am 4. August 1953 zum gesetzlichen Feiertag, zum „Tag der deutschen Einheit“, als „Festtag nationaler Selbstfindung“ (Eckelmann 1990, S. 20). Die SED-Regierung der DDR hingegen machte für die Geschehnisse dieses Tages den „Staatsfeind“ (ebd.) ver-antwortlich, der einen „faschistischen Putsch“ (ebd.) durchführen wollte. Dieser Vorgabe folgte man auch in der offiziellen Darstellung der Ereignisse in der „Geschichte des FDGB“: „Die Feinde des Sozialismus im Innern der DDR nutzen Unzufriedenheit und Mißstimmung [sic!] von Werktätigen für einen konterrevolutionären Putschversuch aus; sie erhalten operative Anleitung durch in Westberlin und in der BRD stationierte imperialistische Geheimdienste und Agentenzentralen“ (Deutschland 1985, S. 83). Die SED propagierte eine von außen ange-zettelte Verschwörungstheorie. Doch die Realität und die Hintergründe dieses Aufstandes sahen anders aus, denn letztendlich war dieser Aufstand der Arbeiter der DDR der erste und letzte Versuch, bis zur Wende 1989, einen gesellschaftlichen und politischen Umbruch in der DDR herbeizuführen.
Welche Entwicklung der „Freie Deutschen Gewerkschaftsbund“, kurz FDGB, bis zu diesem Arbeiteraufstand 1953 durchlaufen hatte und warum er, anders als von einer Gewerkschaft aus heutiger Sicht erwartet, eben gerade nicht mit an diesem Aufstand beteiligt war, soll in dieser Arbeit dargelegt werden. Dazu soll die Rolle der Gewerkschaften im Aufbau des Sozialismus in der sowjetisch besetzten Zone und in der späteren DDR genauer beleuchtet werden. Grundlegend für diese Arbeit ist dabei die These, dass der ursprüngliche Gründungsgedanke des FDGB, nämlich ein weltanschaulich pluralistischer Gewerkschaftszusammenschluss zu sein, bis 1953 zunehmend verloren gegangen war und das sich der FDGB schließlich als staatstragende Massenorganisation und als enger Erfüllungsgehilfe der Partei, ganz nach dem Gewerkschaftsgedanken Lenins, konstituierte. Es hat sich also im Sozialismus ein ganz anderer Gewerkschaftstypus herausgebildet der hier genauer dargestellt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken.
- Gewerkschaften und der Marxismus-Leninismus.
- Die Entstehung und frühe Entwicklung der Einheitsgewerkschaft FDGB.
- Historische Ausgangslage und Gewerkschaftsgründung
- Kurzer Exkurs: Der demokratische Zentralismus - das Ordnungsprinzip der DDR.
- Stalinisierung des FDGB.
- Die Beseitigung der Betriebsräte
- Der FDGB in den Anfängen der DDR.
- Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Frühphase des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) in der DDR, insbesondere die Entwicklung bis zum Juni-Aufstand 1953. Sie beleuchtet, wie der FDGB von einer ursprünglich pluralistischen Gewerkschaftsorganisation zu einer staatstragenden Massenorganisation und engem Erfüllungsgehilfen der SED wurde.
- Die Rolle der Gewerkschaften im Aufbau des Sozialismus in der DDR
- Der Wandel des FDGB vom pluralistischen Gewerkschaftsverband zur staatlichen Massenorganisation
- Der Einfluss des Marxismus-Leninismus auf das Gewerkschaftsverständnis in der DDR
- Die Bedeutung des „demokratischen Zentralismus“ für die Organisation von Partei, Betrieb und Gewerkschaft
- Die Auswirkungen der Stalinisierung des FDGB und die Beseitigung der Betriebsräte
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Frühphase des FDGB ein und stellt den historischen Kontext des Juni-Aufstandes 1953 dar. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse sowie die These der Arbeit vorgestellt: die Umwandlung des FDGB von einer pluralistischen zu einer staatstragenden Organisation.
Kapitel 2 analysiert die Rolle von Gewerkschaften im Marxismus-Leninismus als theoretischer Hintergrund des FDGB. Es werden die unterschiedlichen Auffassungen von Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin zur Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die Entstehung und frühe Entwicklung des FDGB in der DDR. Es beleuchtet die historische Ausgangslage, die Gründung des FDGB und die Einordnung in das System des „demokratischen Zentralismus“. Die Stalinisierung des FDGB, die Beseitigung der Betriebsräte und die Entwicklung des FDGB bis zum Juni 1953 werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Gewerkschaften, Marxismus-Leninismus, FDGB, DDR, „demokratischer Zentralismus“, Stalinisierung, Betriebsräte, Juni-Aufstand 1953. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel des FDGB von einer pluralistischen Gewerkschaftsorganisation zu einer staatstragenden Massenorganisation im Kontext des sozialistischen Aufbaus in der DDR.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Julia Erdmann (Author), 2010, Die Frühphase des FDGB , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189662