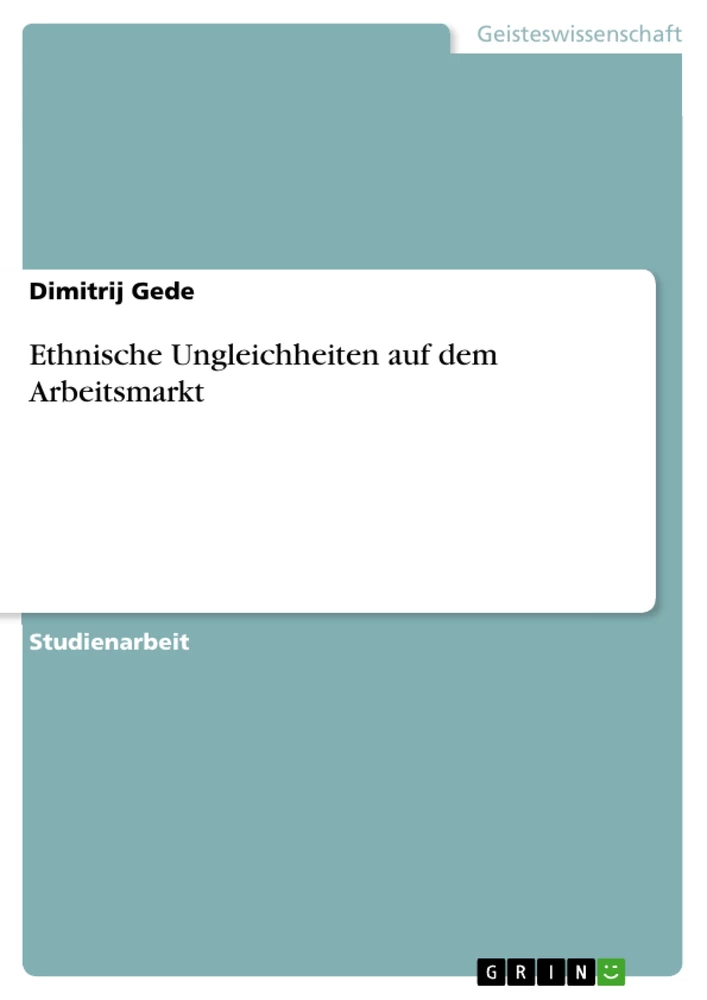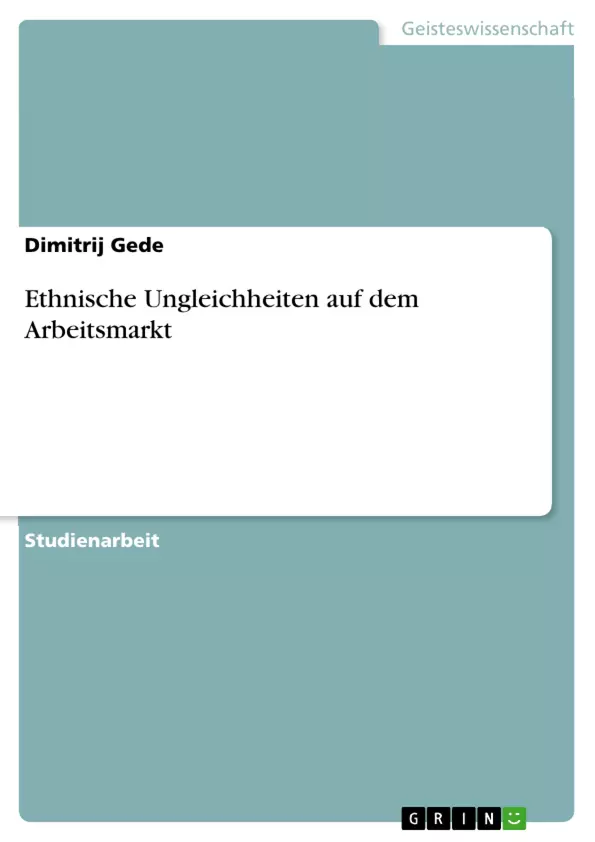1. Einleitung
Die folgende Hausarbeit entstand in Folge eines Seminars der Universität Trier mit dem Titel „Moderne Ungleichheitsforschung im Vergleich“, in dem wir in reger Diskussion Theorien bekannter Soziologen diskutierten. Im Zuge dieser Diskussion erwachte das Interesse des Autors an dem Thema des Arbeitsmarkts. Dieser ist nach der soziologischen Betrachtung eine „Maschine der Ungleichheitsproduktion“, da er die zentrale Instanz zur Distribution von sozialen Position, gesellschaftlichem Status und Lebenschancen darstellt. In der folgenden Hausarbeit werden theoretische Konzepte, die sich mit Ungleichheit von Migranten auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen vorgestellt. Hierbei dienen drei Grundfragen als Leitfaden:
1. Was sind die Gründe für den geringen Arbeitsmarkterfolg von Migranten?
2. Welche Erklärung gibt es für den unterschiedlichen Erfolg zwischen verschiedenen Migrantengruppen?
3. Gibt es Gruppen, die eine Sonderrolle spielen?
Da eine ausführliche Darstellung aller Theorien den Rahmen einer Hausarbeit sprengen würde konzentriert der Autor sich auf 3 grundliegende. Zum ersten gilt die Analyse der unterschiedlichen Ausstattung mit Humankapital. Verfügen jedoch 2 Akteure über die gleiche Menge eines solchen, bedeutet das jedoch nicht, dass beide dieselben Erträge erzielen. Daher wird im weiteren Verlauf die These der Diskriminierung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt untersucht. Um obige Theorien auf eine Wirkung im realen sozialen Raum zu prüfen, folgt die Darstellung einer empirischen Analyse, erhoben durch Frank Kalter. Hier werden die Chancen der ersten und zweiten Generation von Migranten mit denen der Deutschen verglichen. Die dritte Theorie (Signaling- Theorie) betrachtet weiterführend den Signalwert einer deutschen Ausbildung für Migranten. Als zentrale Fragestellung dient hier „Gleiche Chancen bei gleicher Ausbildung, auch für Migranten?“ Auch diese wird auf den empirischen Prüfstand gestellt. Schließlich werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst und in einem Fazit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theorien unterschiedlicher Ausstattung mit Humankapital
- 2.1 Die Entwertung spezifischen Kapitals
- 2.2 Die selektive Migration
- 2.3 Spezifische Präferenzen und Motive
- 3. Unterschiedliche Erträge trotz gleichem Humankapital
- 3.1 Das Präferenzmodell von Becker
- 3.2 Statistische Diskriminierung
- 4. Empirische Untersuchung ethnischer Ungleichheit
- 4.1 Die erste Generation der Migranten
- 4.2 Die zweite Generation der Migranten
- 5. Gleiche Chancen dank einer abgeschlossenen Ausbildung?.
- 5.1 Signaling- Theorie
- 5.2 Darstellung der Empirie..
- 5.3 Ergebnisse der Erhebung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Ursachen für ethnische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und beleuchtet verschiedene Theorien, die diese Diskrepanzen erklären. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Auswirkungen von Humankapital, Diskriminierung und der Rolle von Ausbildung auf den Arbeitserfolg von Migranten.
- Theorien zur unterschiedlichen Ausstattung mit Humankapital
- Diskriminierung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt
- Empirische Untersuchungen ethnischer Ungleichheiten
- Der Signalwert einer deutschen Ausbildung für Migranten
- Chancengleichheit für Migranten trotz abgeschlossener Ausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Diese Einleitung erläutert den Hintergrund der Hausarbeit und stellt die zentralen Forschungsfragen dar, die sich mit dem geringen Arbeitserfolg von Migranten, der unterschiedlichen Erfolgsrate verschiedener Migrantengruppen und der Existenz von Sondergruppen beschäftigen. Der Autor fokussiert sich auf drei grundlegende Theorien: die unterschiedliche Ausstattung mit Humankapital, Diskriminierung und die Signaling-Theorie.
Kapitel 2 (Theorien unterschiedlicher Ausstattung mit Humankapital): Dieses Kapitel analysiert verschiedene Theorien, die die Benachteiligung von Migranten aufgrund unterschiedlicher Humankapitalausstattung auf dem Arbeitsmarkt erklären. Dabei werden drei Haupttheorien betrachtet: die Entwertung spezifischen Kapitals, die selektive Migration und spezifische Präferenzen und Motive. Die Entwertung spezifischen Kapitals bezieht sich auf die Tatsache, dass Migranten ihr im Heimatland erworbenes Wissen und Können im Aufnahmeland nicht in gleicher Form anwenden können, da bestimmte Qualifikationen nicht anerkannt werden oder neue Kenntnisse im Aufnahmeland erforderlich sind. Die selektive Migration erklärt Ungleichheiten durch unterschiedliche Qualifikationsniveaus von Migranten, die entweder durch eine „negative Selektion“ (niedrigere Qualifikation der Migranten) oder durch gezielte Nachfrage des Aufnahmelandes nach spezifischen Arbeitskräften (z.B. Anwerbung von Fachkräften) zustande kommen. Spezifische Präferenzen und Motive beziehen sich auf die Rückkehrorientierung von Migranten, die Arbeitgebern zu Investitionen in ihre Humankapitalentwicklung zögern lässt.
Kapitel 3 (Unterschiedliche Erträge trotz gleichem Humankapital): Dieses Kapitel widmet sich der Frage, warum zwei Akteure mit gleichem Humankapital dennoch unterschiedliche Erträge auf dem Arbeitsmarkt erzielen können. Es werden zwei Theorien vorgestellt: das Präferenzmodell von Becker, das von unterschiedlichen Präferenzen der Arbeitgeber ausgeht, die Migranten gegenüber einheimischen Arbeitnehmern bevorzugen oder benachteiligen können, und die statistische Diskriminierung, die von der Verallgemeinerung von Vorurteilen über Migranten durch Arbeitgeber ausgeht.
Kapitel 4 (Empirische Untersuchung ethnischer Ungleichheit): Dieses Kapitel befasst sich mit einer empirischen Analyse, die den Arbeitserfolg von Migranten der ersten und zweiten Generation mit dem von Deutschen vergleicht. Die Untersuchung untersucht dabei die Auswirkungen von Humankapital und Diskriminierung auf den Arbeitsmarkterfolg von Migranten. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die erste als auch die zweite Generation von Migranten im Vergleich zu Deutschen einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, obwohl dies in geringerem Ausmaß für die zweite Generation gilt.
Kapitel 5 (Gleiche Chancen dank einer abgeschlossenen Ausbildung?): Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Frage, ob Migranten mit einer abgeschlossenen Ausbildung gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Hierbei werden die Signaling-Theorie, die besagt, dass bestimmte Abschlüsse als Signal für spezifische Fähigkeiten dienen und somit den Arbeitsmarkterfolg beeinflussen, und die empirische Analyse des Signalwerts einer deutschen Ausbildung für Migranten betrachtet. Die Untersuchung zeigt, dass eine deutsche Ausbildung zwar einen positiven Effekt auf den Arbeitserfolg von Migranten hat, aber die Chancenungleichheit zwischen Migranten und Deutschen dennoch besteht.
Schlüsselwörter
Ethnische Ungleichheit, Arbeitsmarkt, Humankapital, Diskriminierung, Migranten, Integration, Signaling-Theorie, Bildungsqualifikation, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Arbeitsmarkt als „Maschine der Ungleichheitsproduktion“ bezeichnet?
Weil er die zentrale Instanz für die Verteilung von sozialen Positionen, gesellschaftlichem Status und Lebenschancen darstellt.
Was besagt die Signaling-Theorie im Kontext von Migranten?
Sie untersucht den Signalwert einer Ausbildung. Ein deutscher Abschluss dient Arbeitgebern als Signal für bestimmte Fähigkeiten und soll die Ungewissheit verringern.
Was ist der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Migrantengeneration am Arbeitsmarkt?
Empirische Daten zeigen, dass beide Generationen Hürden haben, die zweite Generation jedoch oft besseren Zugang findet, wenngleich Ungleichheiten bestehen bleiben.
Was versteht man unter „statistischer Diskriminierung“?
Arbeitgeber übertragen dabei negative Vorurteile oder statistische Durchschnittswerte einer Gruppe auf das einzelne Individuum bei der Einstellungsentscheidung.
Führt eine gleiche Ausbildung automatisch zu gleichen Chancen für Migranten?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass trotz gleicher Qualifikation oft unterschiedliche Erträge erzielt werden, was auf Diskriminierung oder entwertetes spezifisches Kapital hindeutet.
- Quote paper
- Dimitrij Gede (Author), 2012, Ethnische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189690