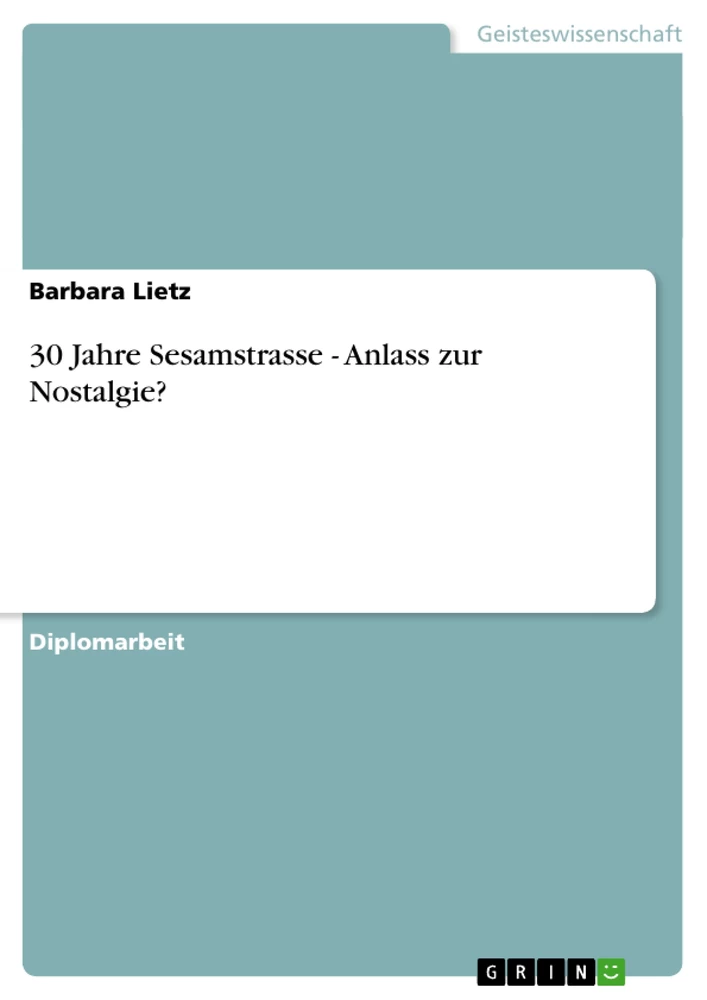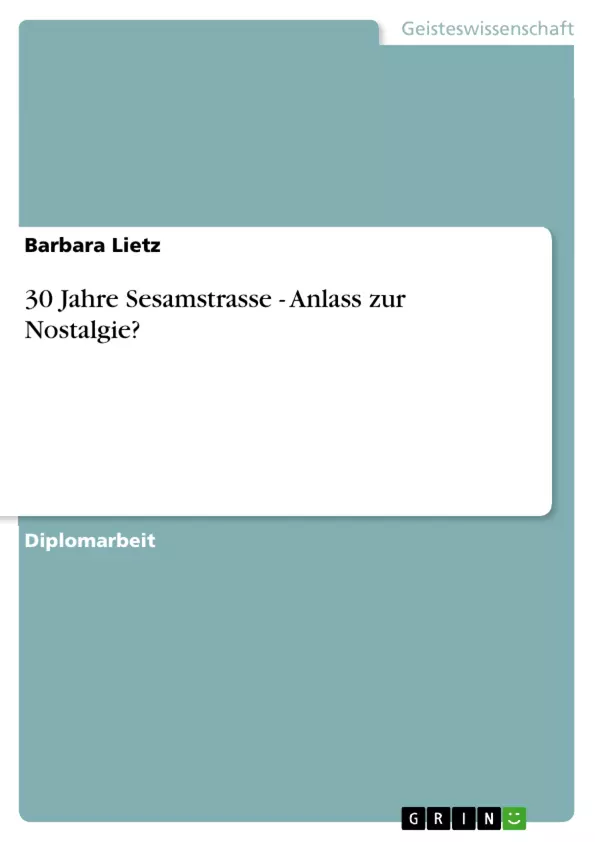„Ach, was für Zeiten. Manchmal, wenn Pferd und Wolle artig und angestrengt gängige TV-Formate parodieren, wünschen wir uns etwas vom ruppigen Charme der Anfangsjahre zurück, von Krümelmonsters gierigem „Ich will Keeeeekse!“, von Ernies und Berts nervtötenden Debatten und Oscars schepperndem Bekenntnis „Ich mag Müll!“ Aber was wissen wir in die Jahre gekommenen Nostalgiker schon, die wir jetzt abends ab 18 Uhr immer auf die Wiederholungen der alten Filmchen hoffen - heute sind wir die Eltern.“ (Helge Hopp in der „Berliner Zeitung“ vom 7. Januar 2003: „Ich will Keeeeekse!“ Vor 30 Jahren war die „Sesamstraße“ ein Aufruf zur Anarchie“)
Sesamstraßen-Nostalgie: gibt es sie wirklich, wie dieser und die folgenden Zeitungsartikel nahe legen? Das soll in dieser Studie untersucht werden.
„Die „Sesamstraße“ war auch ein Grund, mich besonders auf mein erstes eigenes Kind zu freuen. Denn so brauche ich keine Ersatzbefriedigung für Erwachsene wie „Emergency Room“ oder „Sex and the City“. Ich kann mit meinem Sohn einfach das Original ansehen. Naja, fast das Original. Im deutschen Viertel der „Sesamstraße“ haben heute leider völlig unausstehliche Erwachsene ihre Isomatten ausgebreitet. Dann gibt es dort den Würstchengemästeten Samson, ein wandelndes Plädoyer für das Wiederaussetzen von Bären in den tiefsten Weiten Alaskas. Hinzu kommen die unerträglich naseweis-zickige Tiffi und Herr von Bödefeld, schlecht gespielte Handpuppen (....). Im amerikanischen Viertel gibt es dagegen außer Bob und Linda auch noch Herrn Huber mit seinem kleinen Geschäft an der Ecke und den legendären Oskar aus der Mülltonne. Dorthin sollte die „Sesamstraße“ zurückziehen.“ (Jakob Hein in „Die Welt“ vom 4. Januar 2003: „Pssst...Gebt ihm ein „S“!“)
„So weit war das unsere gute alte „Sesamstraße“, in der sich manche junge Eltern dennoch nicht mehr recht zu Hause fühlen können, weil sich seit ihrer eigenen Kindheit grundlegendes verändert hat.“ (Frank Olbert in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2.April 2001: „Wieso? Weshalb? Warum? Wer fragt, bleibt manchmal dumm: Milosevic in der „Sesamstraße““)
Anlässlich der 2000. Sesamstraßensendung schreibt Meike Günzel am 13. Mai 2000 in „Die Welt“: „(...) Eine lange Zeit. Lang genug jedenfalls, damit Oscar aus der Mülltonne in aller Ruhe sein Comeback vorbereiten kann. Denn nicht alles war früher schlechter.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemstellung
- 2.1 Zweck und Nutzen der Sesamstraße: Das pädagogische Konzept der Vorschulsendung auf dem Prüfstand
- 2.1.1 Exkurs: Die Geschichte der Sesamstraße oder der Bildungsnotstand und die Geburt des Vorschulfernsehens
- 2.1.2 Warum aus der Sesame Street die Sesamstraße wurde - die Schwerpunktfrage
- 2.1.3 Unter der Lupe: die Sesamstraße als Forschungsobjekt
- 2.2 Die Rolle der Eltern beim Lernen mit der Sesamstraße
- 2.3 Eltern, Kinder, ihr Fernsehverhalten und die Frage nach der Nostalgie
- 2.3.1 Generationenbeziehungen beim Fernsehen
- 2.3.2 Die Frage nach der Nostalgie
- 3. Methode
- 3.1 Die Stichprobe: 31 Eltern mit Sesamstraßenkenntnissen
- 3.2 Die Erhebungsmethode: der Internetfragebogen
- 3.3 Die Auswertung: Kategorisierung, Kodierung und mathematische Operationen
- 3.3.1 Die Kategorisierung und Kodierung
- 3.3.2 Die mathematischen Operationen
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Überprüfung der ersten Hypothese, dass Eltern Sendungen für ihre Kinder auswählen, die sie in ihrer eigenen Kindheit selbst gern gesehen haben
- 4.2 Überprüfung der zweiten Hypothese, dass Eltern, die früher gern die Sesamstraße gesehen haben, der Sendung gegenüber auch heute noch positiv eingestellt sind
- 4.3 Überprüfung der dritten Hypothese, dass Eltern die alten Sesamstraßenfolgen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, lieber mögen als die neuen aktuellen Folgen.
- 5. Diskussion und Anregungen für weiterführenden Untersuchungen
- 5.1 Diskussion und Anregungen aus den Ergebnissen zur Überprüfung der ersten Hypothese, dass Eltern Sendungen für ihre Kinder auswählen, die sie in ihrer eigenen Kindheit selbst gern gesehen haben
- 5.2 Diskussion und Anregungen aus den Ergebnissen zur Überprüfung der zweiten Hypothese, dass Eltern, die früher gern die Sesamstraße gesehen haben, der Sendung gegenüber auch heute noch positiv eingestellt sind
- 5.3 Diskussion und Anregungen aus den Ergebnissen zur Überprüfung der dritten Hypothese, dass Eltern die alten Sesamstraßenfolgen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, lieber mögen als die neuen aktuellen Folgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Nostalgie im Zusammenhang mit der Sesamstraße. Ziel ist es, zu überprüfen, ob und inwiefern Eltern ihre eigenen Kindheitserfahrungen mit der Sendung auf ihre Kinder übertragen und wie sich dies auf ihre Wahrnehmung der aktuellen und früheren Folgen auswirkt. Die Studie basiert auf einer quantitativen Analyse von Daten, die mittels eines Internetfragebogens erhoben wurden.
- Einfluss der eigenen Kindheitserfahrungen auf die Medienwahl für Kinder
- Vergleich der Wahrnehmung von alten und neuen Sesamstraßenfolgen bei Eltern
- Der Zusammenhang zwischen Nostalgie und der Bewertung der Sesamstraße
- Die Rolle der Eltern bei der Mediensozialisation ihrer Kinder
- Methodische Aspekte der Erhebung und Auswertung von Nostalgie-Daten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Hintergrund der Untersuchung der Sesamstraßen-Nostalgie. Es skizziert die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Studie.
2. Problemstellung: Dieses Kapitel beleuchtet den pädagogischen Ansatz der Sesamstraße und ihren historischen Kontext. Es geht auf die Entwicklung der Sendung ein, untersucht die Rolle der Eltern bei der Mediensozialisation der Kinder und formuliert die zentralen Forschungsfragen, insbesondere die Frage nach dem Einfluss von Nostalgie auf die Eltern bei der Auswahl von Fernsehsendungen für ihre Kinder.
3. Methode: Hier wird die Methodik der Studie detailliert beschrieben. Es wird die Stichprobenselektion (31 Eltern mit Kindern im Sesamstraßen-Zielgruppenalter), die Erhebungsmethode (Internetfragebogen) und die Auswertungsmethode (Häufigkeitsanalysen und Korrelationsberechnungen mit dem Spearman-Rho-Koeffizienten) erläutert. Es wird auf die Kategorisierung und Kodierung der Daten eingegangen und die statistischen Verfahren detailliert dargestellt.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung zu den drei aufgestellten Hypothesen. Es werden die Daten zur Auswahl von Sendungen durch Eltern, die Einstellung zu alten und neuen Folgen, und die Präferenz für alte Folgen detailliert analysiert und präsentiert. Die Ergebnisse werden durch Tabellen und graphische Darstellungen visualisiert. Der Fokus liegt auf der quantitativen Auswertung der Daten.
5. Diskussion und Anregungen für weiterführenden Untersuchungen: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse im Detail und setzt sie in den Kontext der bestehenden Literatur. Es werden die Implikationen der Ergebnisse erörtert und Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten gegeben. Die Grenzen der Studie werden ebenfalls benannt und Vorschläge für Verbesserungen der Methodik gemacht.
Schlüsselwörter
Sesamstraße, Nostalgie, Eltern, Kinder, Fernsehen, Vorschulerziehung, Mediensozialisation, Medienwahl, Quantitative Forschung, Internetfragebogen, Spearman-Rho-Korrelation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Sesamstraßen-Nostalgie bei Eltern
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss von Nostalgie im Zusammenhang mit der Sesamstraße auf die Medienwahl von Eltern für ihre Kinder. Konkret wird geprüft, ob und wie die eigenen Kindheitserfahrungen mit der Sendung die Wahrnehmung und Auswahl aktueller und früherer Sesamstraßenfolgen beeinflussen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Studie untersucht folgende zentrale Fragen: Wie wirkt sich die eigene Kindheitserfahrung mit der Sesamstraße auf die Wahl von Fernsehsendungen für die eigenen Kinder aus? Unterscheiden sich die Einstellungen von Eltern zu alten und neuen Sesamstraßenfolgen? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Nostalgie und der Bewertung der Sesamstraße durch Eltern? Welche Rolle spielen Eltern bei der Mediensozialisation ihrer Kinder im Kontext der Sesamstraße?
Welche Methode wurde verwendet?
Es wurde eine quantitative Methode angewendet. Die Daten wurden mittels eines Online-Fragebogens bei 31 Eltern mit Kindern im Sesamstraßen-Zielgruppenalter erhoben. Die Auswertung erfolgte mittels Häufigkeitsanalysen und Korrelationsberechnungen (Spearman-Rho-Koeffizient). Die Daten wurden kategorisiert und kodiert, bevor die statistischen Verfahren angewendet wurden.
Welche Hypothesen wurden geprüft?
Die Studie überprüfte drei Hypothesen: 1) Eltern wählen Sendungen für ihre Kinder, die sie selbst in ihrer Kindheit gern gesehen haben. 2) Eltern, die früher gern die Sesamstraße geschaut haben, stehen der Sendung auch heute noch positiv gegenüber. 3) Eltern bevorzugen die alten Sesamstraßenfolgen aus ihrer Kindheit gegenüber den neuen Folgen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie zur Überprüfung der drei Hypothesen werden im Kapitel 4 detailliert präsentiert und graphisch visualisiert. Die quantitative Auswertung der Daten wird im Detail beschrieben. Die Ergebnisse werden im Kapitel 5 diskutiert und in den Kontext bestehender Literatur eingeordnet.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Problemstellung (inkl. historischem Kontext der Sesamstraße und Rolle der Eltern), Methode (Beschreibung der Stichprobe, Erhebungs- und Auswertungsmethoden), Ergebnisse (quantitative Analyse der Daten zu den drei Hypothesen) und Diskussion mit Anregungen für weiterführende Untersuchungen (Interpretation der Ergebnisse, Limitationen der Studie und Vorschläge für zukünftige Forschung).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Sesamstraße, Nostalgie, Eltern, Kinder, Fernsehen, Vorschulerziehung, Mediensozialisation, Medienwahl, Quantitative Forschung, Internetfragebogen, Spearman-Rho-Korrelation.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Mediensozialisation, Kindheit, Nostalgie und der Wirkung von Kinderfernsehen beschäftigen. Sie bietet auch Einblicke für Eltern und Pädagogen, die an der Mediennutzung von Kindern interessiert sind.
Wo finde ich die detaillierten Ergebnisse?
Die detaillierten Ergebnisse der Studie, inklusive Tabellen und Grafiken, sind im Kapitel 4 der vollständigen Arbeit zu finden.
Welche Limitationen hat die Studie?
Die Limitationen der Studie, wie z.B. die Stichprobengröße und die Methode der Datenerhebung, werden im Kapitel 5 ausführlich diskutiert und Vorschläge für Verbesserungen in zukünftigen Studien gemacht.
- Arbeit zitieren
- Barbara Lietz (Autor:in), 2003, 30 Jahre Sesamstrasse - Anlass zur Nostalgie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18981