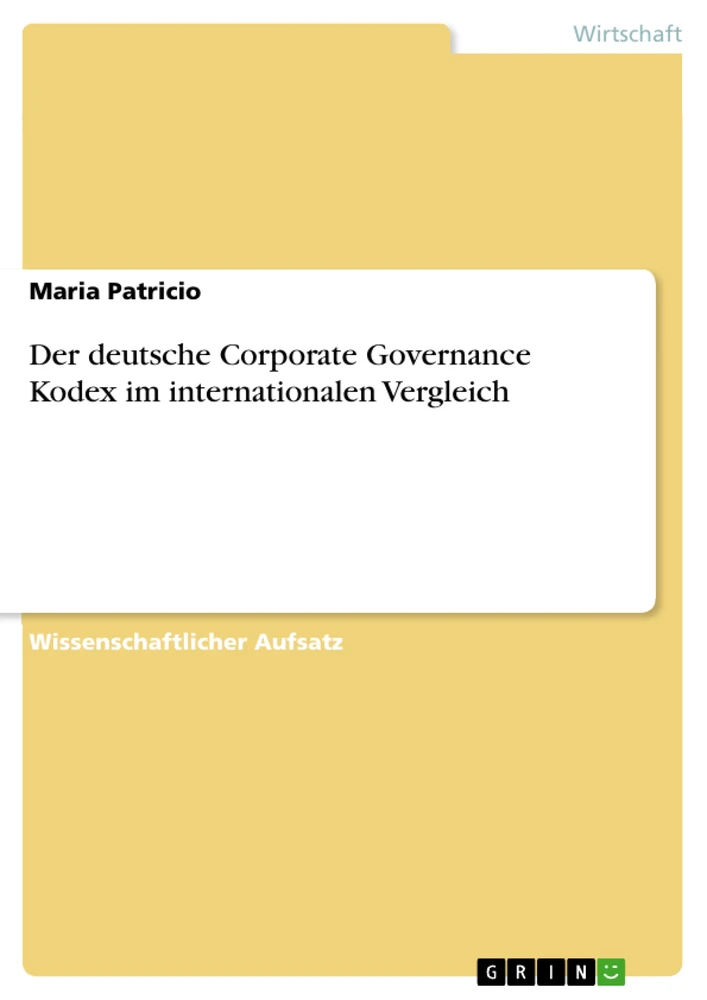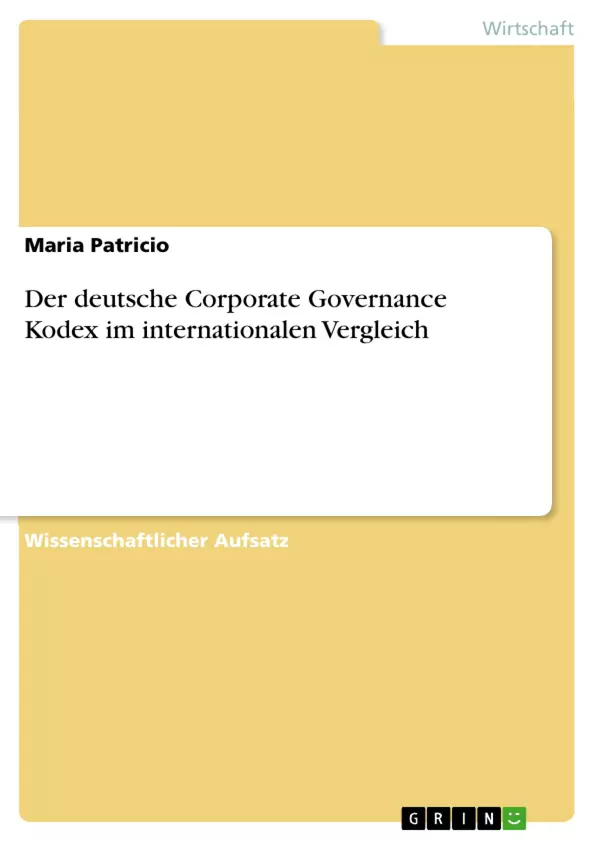Die Debatte um den deutschen Corporate Governance nimmt seit den 1990er
Jahren verstärkt kein Ende an. Die Notwendigkeit dieses Themas ist durch
zahlreiche Fälle von Missmanagement und diversen Wirtschaftsskandalen
begründet. Nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika ereigneten sich
unzählige Bilanzskandale, Unternehmenszusammenbrüche und Insolvenzen
über die letzten Jahre (Enron und WorldCom), sondern auch in Europa kam
es vermehrt zu Bilanzbetrügereien- und Manipulationen. Europäische
Gesellschaften wie, Balsam, Flowtex, Ahold, Adecco, Informatec, Comroad,
EM.TV und Parmalat sind nur einige Beispiele von EU-Bilanzskandalen.1
Ursachen für die gestiegene Wirtschaftskriminalität können die Auswirkungen
der zunehmenden Internationalisierung und Verflechtung der Unternehmen
sein. Der hohe internationale Wettbewerbsdruck, die Liberalisierung der
Kapitalmärkte und die Globalisierung der Wirtschaft bedeuten auch einen
höheren Druck und eine höhere Belastung für die Aufsichtsorgane, das
Management und die Mitarbeiter. Vor ca. 20 Jahren konnten sich in
Deutschland die Unternehmen nur aus einbehaltenen Gewinnen und Krediten
finanzieren. Heute finanzieren sich deutsche Unternehmen überwiegend auf
den ausländischen Kapitalmärkten und es herrscht ein konstanter
Wettbewerb um Kapital auf dem Markt.2
Um sich auf dem schnell wachsenden Markt dennoch behaupten zu können,
werden Bilanzen gefälscht, sowie Untreue- und Betrugsdelikte vermehrt
begangen. Verstärkt wird von den Marktteilnehmern mehr Transparenz in der
Unternehmenskontrolle- und Führung in Deutschland gefordert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporate Governance in Deutschland
- Der Begriff „Corporate Governance“
- Die Entstehung des DCGK
- Das Ziel des Kodexes
- Die drei Vorschriften des Kodexes zur Verwirklichung der Ziele
- Die rechtliche Einordnung des Kodexes
- Der DCGK im internationalen Vergleich
- Shareholder- und Stakeholdersysteme
- One Tier System
- Two-Tier System
- Corporate Governance in Großbritannien
- Die Rechtsnatur des Combined Code
- Der DCGK und der Combined Code
- Shareholder- und Stakeholdersysteme
- Ergebnis
- Der Unterschied
- Die Gemeinsamkeit
- Ein Blick nach Japan
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den deutschen Corporate Governance Kodex und setzt ihn in Beziehung zu internationalen Standards. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Umsetzung von Corporate Governance Prinzipien in verschiedenen Ländern.
- Entwicklung und Bedeutung von Corporate Governance in Deutschland
- Zielsetzung und rechtliche Einordnung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
- Vergleich des DCGK mit internationalen Standards, insbesondere dem britischen Combined Code
- Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kodexen
- Einblick in die Corporate Governance Praxis in Japan
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Corporate Governance ein und erläutert die Entstehung des DCGK. Kapitel zwei befasst sich mit dem DCGK in Deutschland und stellt die Ziele und die rechtliche Einordnung des Kodex vor. In Kapitel drei wird der DCGK im internationalen Vergleich betrachtet, wobei der Fokus auf dem britischen Combined Code liegt. Das Ergebnis der Vergleichsanalyse wird in Kapitel vier vorgestellt, und es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Kodexen aufgezeigt. Darüber hinaus wird ein Blick auf die Corporate Governance Praxis in Japan geworfen.
Schlüsselwörter
Der deutsche Corporate Governance Kodex, Corporate Governance, internationaler Vergleich, Combined Code, Shareholder- und Stakeholdersysteme, One Tier System, Two-Tier System, rechtliche Einordnung, Bilanzskandale, Transparenz, Unternehmensführung, Unternehmensüberwachung, Internationalisierung, Wettbewerbsdruck, Kapitalmärkte, Globalisierung.
- Arbeit zitieren
- LL. B. Maria Patricio (Autor:in), 2010, Der deutsche Corporate Governance Kodex im internationalen Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189897