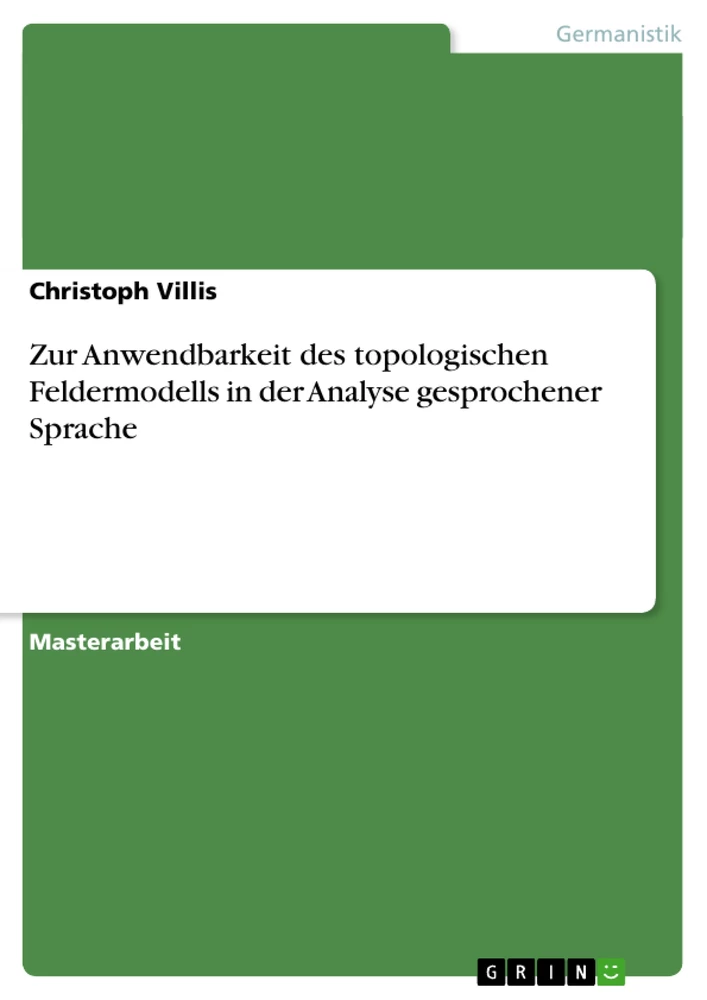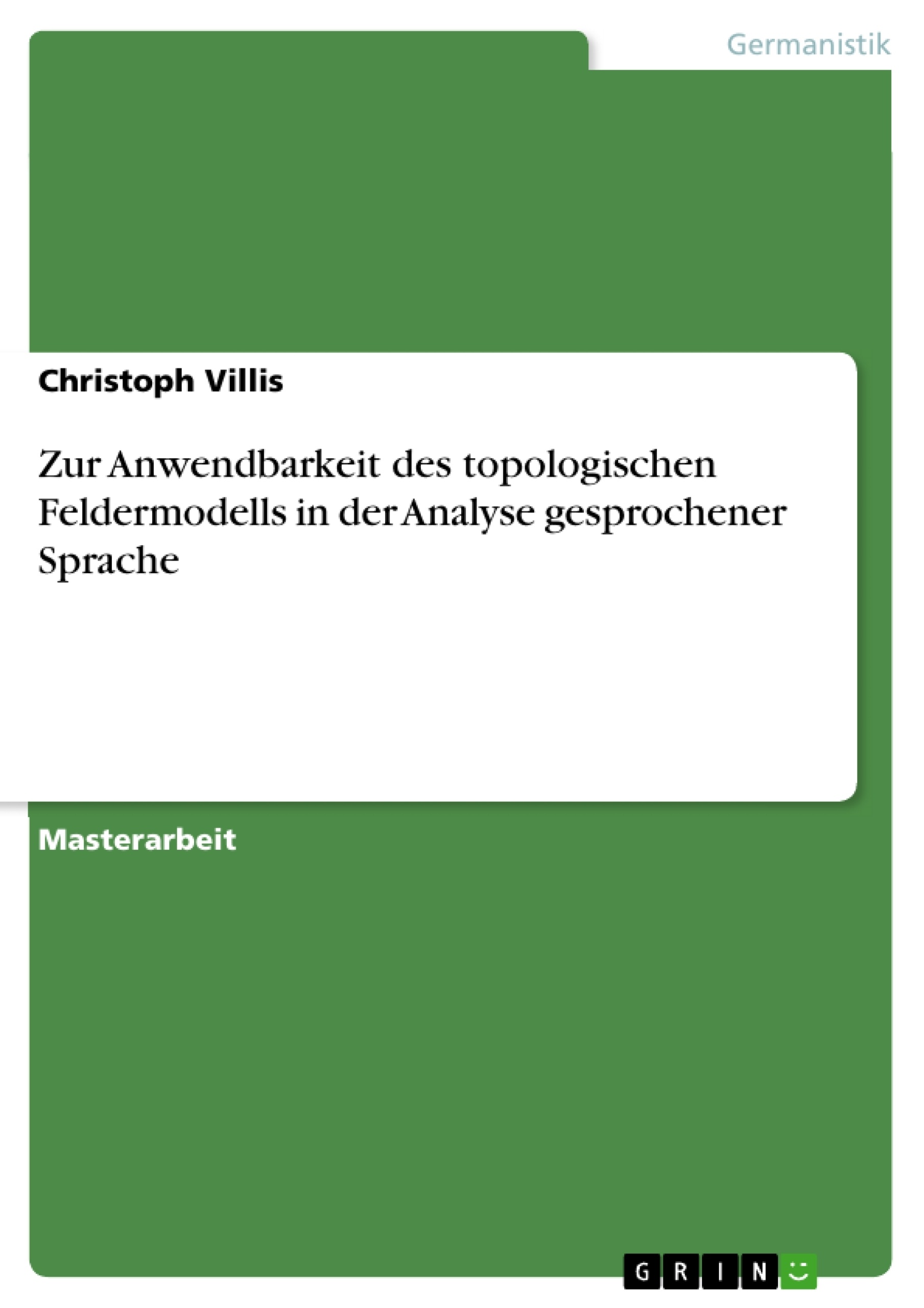Gesprochene und geschriebene Sprache unterscheiden sich nicht allein durch ihren medialen Charakter, also in Schallereignis und Zeichen. Entstand die gesprochene Sprache vorerst auf evolutionär-biologischem Wege, jedoch nicht ohne kulturellen Einfluss (vgl. Bayer 1994:159ff.; Haarmann 2006:27ff.), so ist das geschriebene Wort hingegen eine rein kulturelle und somit bewusst konstruierte Kommunikation, mit dem Ziel der Abbildung und Speicherung zuvor abstrakter und unmittelbarer Gedankenkonstrukte (vgl. Martinetz 2006). "Seit etwa dem 15. Jahrhundert wird in der Geschichte der deutschen Sprache deutlich, daß geschriebene Sprache nicht einfach ein 'Abbild' der gesprochenen Sprache ist - so die mehr traditionelle Auffassung in der Sprachwissenschaft -, sondern ein eigenes, von der gesprochenen Sprache weitgehend unabhängiges Kommunikationssystem." (von Po lenz 2000:114f.) Gesprochene Sprache weist ebenso deutliche Unterschiede in ihrer Struktur, also ihrem System, zur geschriebenen Sprache auf (vgl. Eisenberg 2006a; Fiehler et al. 2004:36ff.).
Aufgrund technischer Entwicklungen der letzten Jahrzehnte keimt die
sprachwissenschaftliche Betrachtung und Analyse der sprachlichen 'Urform' erst jetzt auf und setzt sich allmählich neben der klassischen Analyse von Texten und Schriftzeichen durch (vgl. BehagheI1927:1lff.). Auch wenn die Linguistik sich nicht erst seit Erfindung von Aufnahmegeräten, also der Möglichkeit der Archivierung von Schallereignissen, mit gesprochener Sprache auseinandersetzt, so sind detaillierte Analysen und gerade systemlinguistische Betrachtungen an sprachlichen Rohdaten in großem Umfang erst durch solche technischen Neuerungen möglich. "Gut erforscht ist die Sprachgeschichte im Grunde als Geschichte der geschriebenen Sprache, was geradezu zu einer gewissen Vorrangstellung der Schriftsprache geführt hat.
Gesprochene Sprache dagegen kann für die Zeit vor den ersten Tonaufzeichnungen, d.h. also auch noch für den größten Teil des 19. Jahrhunderts, nur indirekt erschlossen werden, entweder über schriftlich überlieferte Objektsprache oder über metasprachliche Äußerungen und andere 'subjektive' Sprachdaten." (Elspaß 2005:24)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Korpus
- Das topologische Feldermodell
- Exkurs: Gibt es Sätze in gesprochener Sprache?
- Kurzformen: Analepsen und Ellipsen
- Analepsen
- Subjekt-Analepsen
- Objekt-Analepsen
- Verb-Analepsen
- Auslassungen ganzer Sätze
- Ellipsen
- Subjektellipsen
- Objektellipsen
- Verbellipsen
- Satzellipsen
- Diskussionen zur Topologie von Kurzformen
- Verbauslassungen oder nichtverbale Sprachhandlung?
- Leeres Vorfeld
- Klitisierung als Zwischenstufe
- Auslassungen und Informationsstruktur
- Zwischenfazit: Kurzformen
- Diskontinuierliche Strukturen
- Prosodie und Syntax
- Herausstellungen
- Linksherausstellung
- Rechtsherausstellung
- Ausklammerung
- Satzverschränkung
- Anakoluthe
- Abbruch und Pause
- Abbruch und Wiederholung
- Abbruch und Korrektur/Neuanfang
- Abbruch, Parenthese, Fortsetzung
- Drehsatzkonstruktion (Apokoinu)
- Zwischenfazit: Diskontinuierliche Strukturen
- Sonstige syntaktische Phänomene
- Syntaktische Komplexität
- Verbale Sonderfälle
- Adjektive und Adverbien
- Pronomen
- Konjunktionen, Subjunktionen und das Außenfeld
- Zusammenfassung der Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des topologischen Feldermodells auf die Analyse gesprochener Sprache. Sie stellt die Frage, ob dieses Modell geeignet ist, die syntaktischen Strukturen der Spontansprache, insbesondere elliptische Konstruktionen, Herausstellungen und diskontinuierliche Strukturen, adäquat zu beschreiben.
- Analyse der Struktur gesprochener Sprache anhand des topologischen Feldermodells
- Bewertung der Anwendbarkeit des Modells auf elliptische Konstruktionen
- Untersuchung der Beschreibung von Herausstellungskonstruktionen im Feldermodell
- Diskussion der Darstellung diskontinuierlicher syntaktischer Strukturen im Modell
- Beurteilung der Grenzen des topologischen Feldermodells in der Analyse von Spontansprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Anschließend stellt sie das topologische Feldermodell und seine Relevanz für die Satzanalyse vor. Im ersten Kapitel werden Kurzformen wie Analepsen und Ellipsen anhand von Beispielen aus dem Korpus analysiert. Dabei wird die Anwendbarkeit des Feldermodells auf diese Strukturen diskutiert. Im zweiten Kapitel werden diskontinuierliche Strukturen, insbesondere Herausstellungen, Anakoluthe und Satzverschränkungen, im Hinblick auf ihre Beschreibung im topologischen Feldermodell untersucht. Schließlich behandelt das dritte Kapitel weitere syntaktische Phänomene wie verbale Sonderfälle, Adjektive und Adverbien, Pronomen und Konjunktionen, sowie deren Einordnung im Feldermodell.
Schlüsselwörter
Topologisches Feldermodell, gesprochene Sprache, Satzanalyse, Kurzformen, Ellipsen, Analepsen, Herausstellungen, Anakoluthe, Diskontinuierliche Strukturen, Spontansprache, Syntax, Korpuslinguistik.
- Arbeit zitieren
- Christoph Villis (Autor:in), 2011, Zur Anwendbarkeit des topologischen Feldermodells in der Analyse gesprochener Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189968