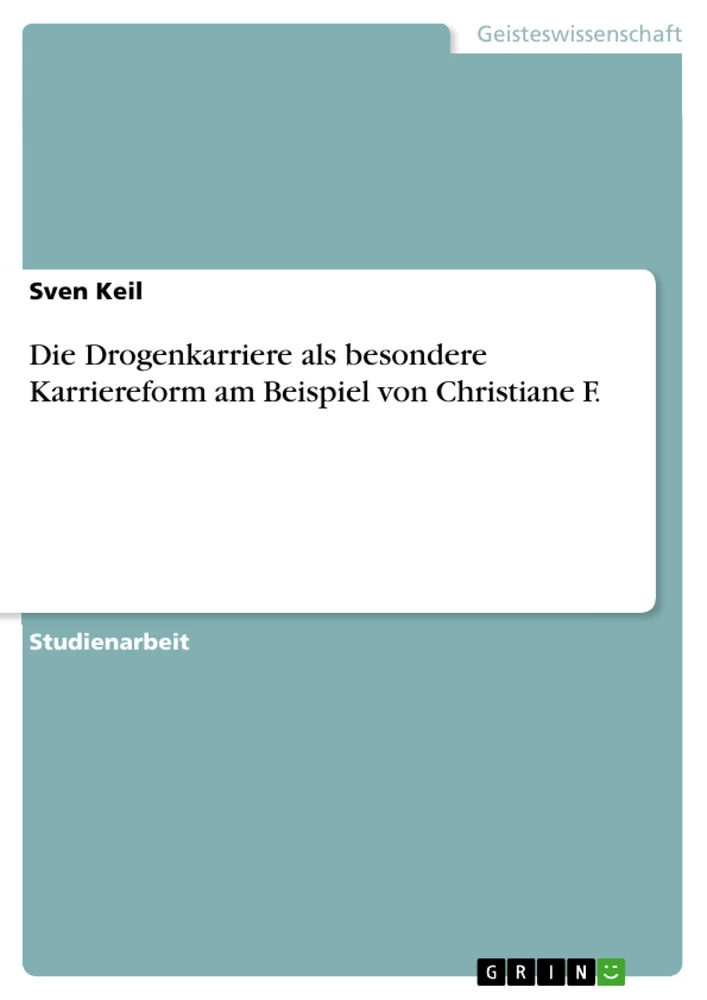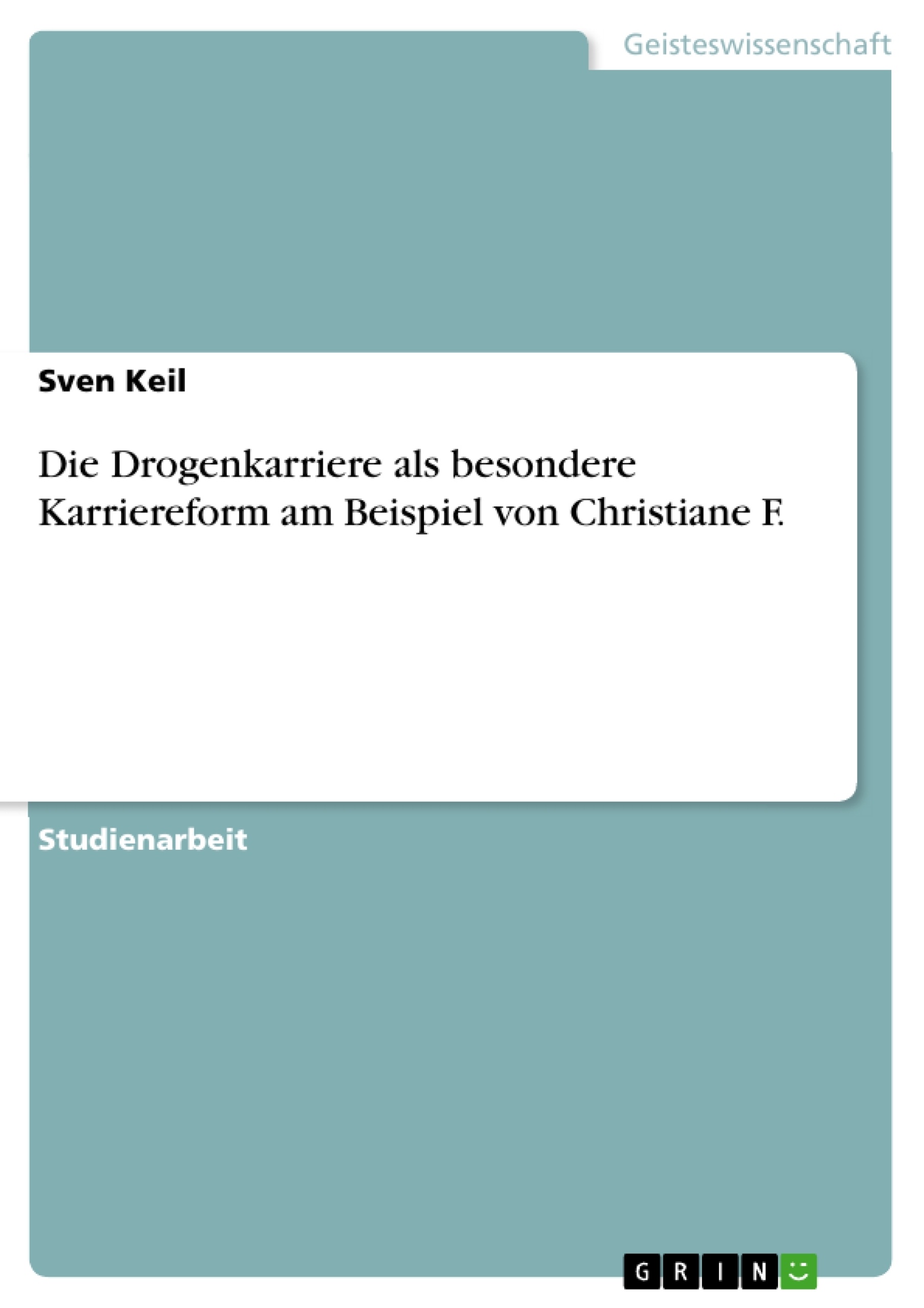1. Einleitung
Mit der 1978 erfolgten Veröffentlichung des Buches „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, rückte die bislang nur aus den USA bekannte Drogenproblematik in das Zentrum der Aufmerksamkeit der deutschen Bevölkerung. Das vom Stern herausgegebene Buch der Autoren Horst Rieck und Kai Hermann, erzählt die Geschichte der Christiane F., die bereits im Alter von 12 Jahren mit Drogen in Berührung kam. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Nachbearbeitung des ursprünglichen Wortprotokolls von Christiane hier und da eine bewusste Überzeichnung seitens der Autoren stattgefunden hat. Dennoch ist das Endprodukt eine sehr genaue Beschreibung von Vorgängen und Praktiken innerhalb der Drogenszene. Die Schilderung der Erlebnisse von Christiane F. bildet in ihrer Genauigkeit eine geeignete Ausgangsbasis für das Ziel dieser schriftlichen Arbeit. Unterstützt durch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sollen Strukturmerkmale der Drogenkarriere als besondere Devianzkarriere herausgearbeitet und aufgezeigt werden, inwiefern sich diese von der herkömmlichen Karriere unterscheidet. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: Um ein Bild des im Buch beschriebenen Lebensabschnitt von Christiane F. zu vermitteln, soll die Handlung des Romans zu allererst grob zusammengefasst werden. Im Anschluss daran wird der Begriff der Devianz erläutert werden, da dieser untrennbar mit einer Drogenkarriere verbunden scheint. Anschließend wird der Verlauf der Drogenkarriere, unterstützt durch Beispiele aus den Schilderungen von Christiane F., nachgezeichnet und auf Besonderheiten hingewiesen. Abgerundet wird die Arbeit durch eine Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven, durch die so eine Drogenkarriere wahrgenommen wird. Durch eine Zusammenfassung der Erkenntnisse wird die Arbeit abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsüberblick
- Devianz
- Der Einstieg in die Drogenkarriere
- Der Übergang zum regelmäßigen Drogenkonsum
- Das Erlernen des Drogenkonsums
- Die Überwindung sozialer Schranken
- Übergang zu harten Drogen und Abhängigkeit
- Reaktionen auf Drogenabhängigkeit
- Innerhalb der Szene
- Verwandte
- Staatliche Kontrollen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Drogenkarriere von Christiane F. anhand des Buches „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Strukturmerkmale der Drogenkarriere als besondere Form der Devianzkarriere aufzuzeigen und zu analysieren, inwiefern sie sich von traditionellen Karriereformen unterscheidet.
- Die Herausarbeitung der Strukturmerkmale der Drogenkarriere
- Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Drogenkarriere und Devianz
- Die Analyse des Verlaufs der Drogenkarriere von Christiane F.
- Die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven auf die Drogenkarriere
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der Handlung des Buches „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und zeichnet so ein Bild des Lebensabschnitts von Christiane F., der im Buch beschrieben wird. Anschließend wird der Begriff der Devianz erläutert, da dieser untrennbar mit einer Drogenkarriere verbunden ist.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Verlauf der Drogenkarriere anhand von Beispielen aus Christianes Schilderungen nachgezeichnet und auf Besonderheiten hingewiesen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Übergang zum regelmäßigen Drogenkonsum und der Überwindung sozialer Schranken, die mit diesem Schritt verbunden sind.
Die Arbeit schließt mit einer Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven auf die Drogenkarriere, die von der Szene selbst, von Verwandten und von staatlichen Kontrollorganen eingenommen werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Drogenkarriere, Devianz, sozialer Ausschluss, Abhängigkeit, Heroinkonsum, Jugendkultur, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und Christiane F. Die Arbeit analysiert die spezifischen Bedingungen und Faktoren, die zur Entwicklung einer Drogenkarriere beitragen können.
- Arbeit zitieren
- Sven Keil (Autor:in), 2011, Die Drogenkarriere als besondere Karriereform am Beispiel von Christiane F., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190018