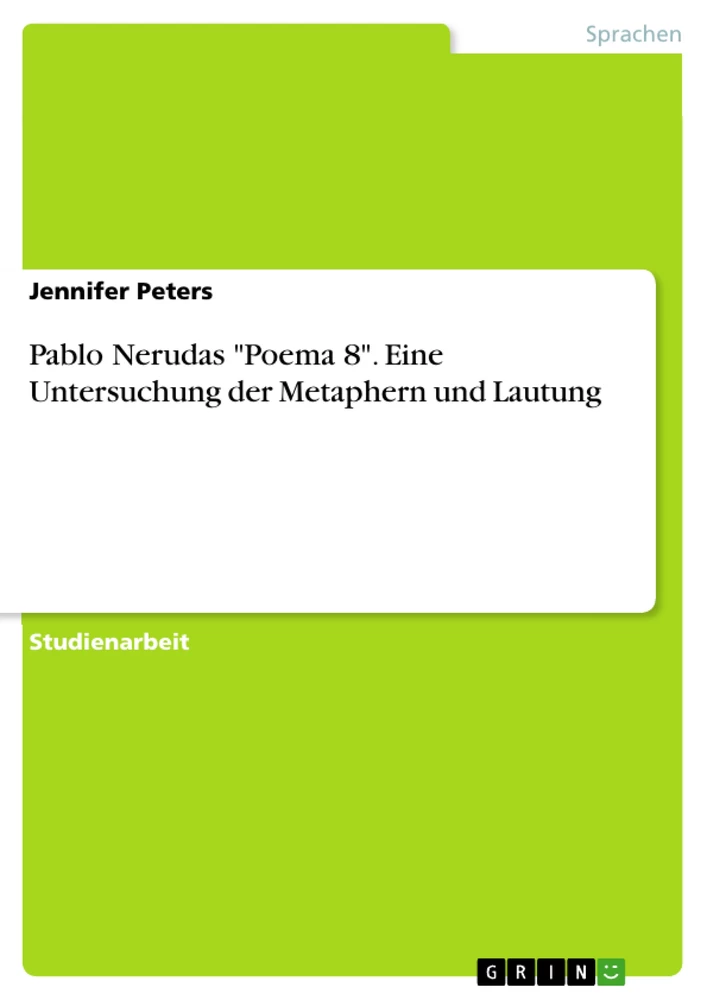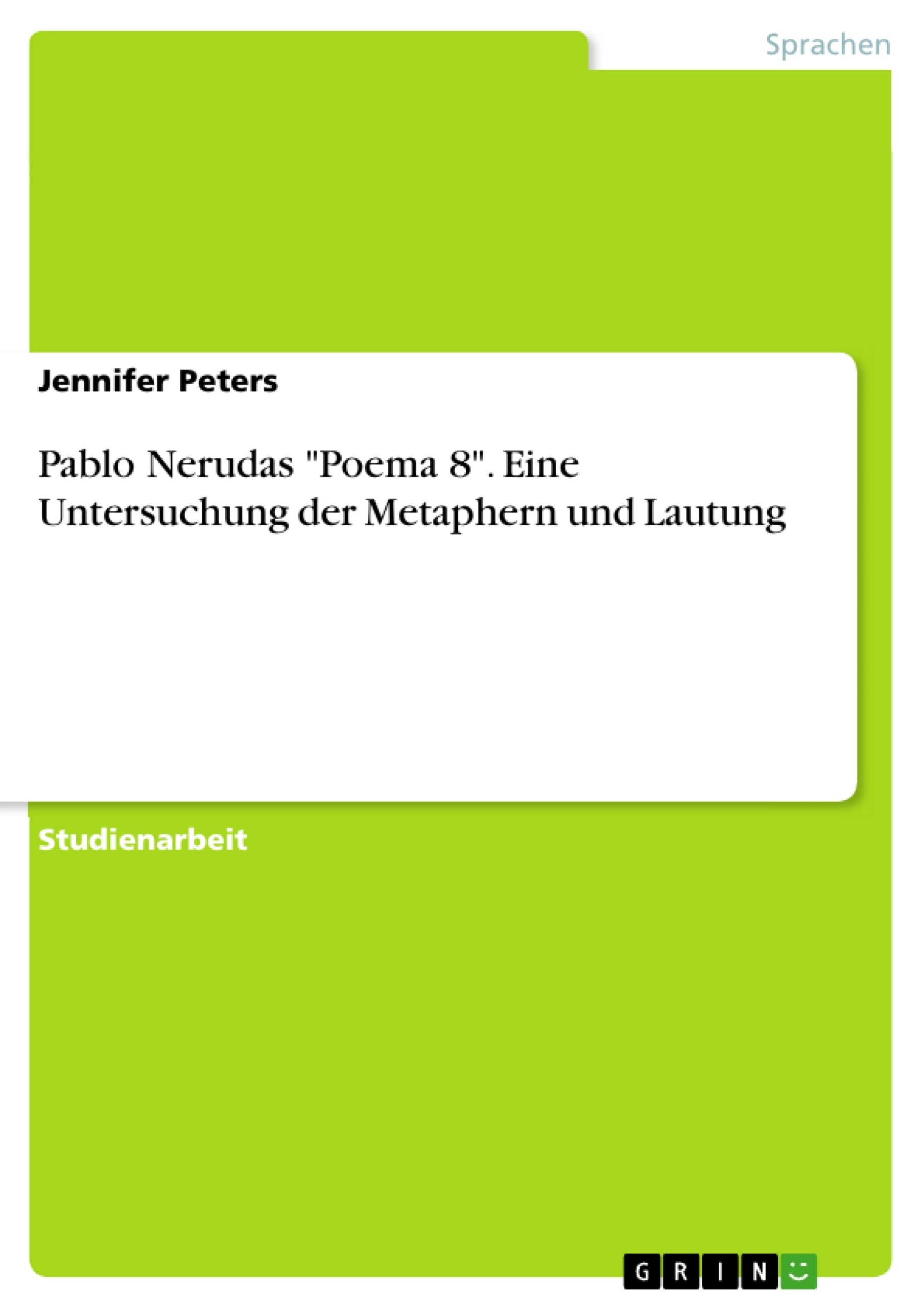Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gedicht “Poema 8“ aus der Gedichtreihe “Los Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada“ von Pablo Neruda. Im Besonderen soll sie sich mit der Vielfalt an Metaphern beschäftigen, für die Neruda im Allgemeinen bekannt ist und die auch das vorliegende Gedicht ausmacht. Zwar erscheinen die Vergleiche und Metaphern recht einseitig, allerdings ist es durchaus faszinierend, wie Neruda es schafft, auf so unterschiedliche Weisen stets dieselbe Situation, dieselben Gefühle auszudrücken: Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung werden auf die Natur übertragen, ohne dabei auch nur ein wenig an Bedeutung und Eindringlichkeit zu verlieren.
Auch Weiblichkeit und Sexualität spielen eine wichtige Rolle. Diese Punkte werden einerseits sehr deutlich und klar, andererseits dennoch nicht obszön oder anstößig thematisiert, wobei meist keinerlei Interpretationsmöglichkeit in eine andere Richtung offen bleibt.
Weiterhin soll eine Analyse der lautlichen Ebene in Nerudas Vortrag des Gedichts vorgenommen werden, die die in der inhaltlichen Interpretation gewonnenen Erkenntnisse unterstreicht und einen Einblick in die Gedanken und Gefühle Nerudas beim Verfassen und Vortragen gewähren kann.
Außerdem werden Analyse- und Interpretationsansätze anderer Autoren einbezogen, kritisch betrachtet und als Denkanstöße verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poema 8 aus “Los Veinte Poemas de Amor y una Canción desesperada”.
- Biographie
- Formanalyse
- Analyse Strophe 1
- Analyse Strophe 2
- Analyse Strophe 3
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gedicht „Poema 8“ aus der Gedichtreihe „Los Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada“ von Pablo Neruda. Im Fokus steht die Analyse der vielfältigen Metaphern, die Nerudas Werk prägen und insbesondere in diesem Gedicht deutlich werden. Die Arbeit untersucht, wie Neruda verschiedene Vergleiche verwendet, um dieselbe Situation und dieselben Gefühle auszudrücken – Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung – und dabei die Eindringlichkeit seiner Poesie zu verstärken.
- Metaphern und Vergleiche in „Poema 8“
- Darstellung von Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung
- Bedeutung der Natur als Metapher
- Analyse der lautlichen Ebene
- Einfluss anderer Autoren auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Werk „Los Veinte Poemas de Amor y una Canción desesperada“ ein und beleuchtet die Bedeutung des Bandes in Nerudas Schaffen. Die Biographie zeichnet den Lebensweg des chilenischen Dichters nach, mit Fokus auf Stationen, die seine literarische Entwicklung prägten. Die Formanalyse untersucht den formalen Aufbau des Gedichts „Poema 8“, wobei die Verwendung von Wiederholungen und die fehlende narrative Linie im Vordergrund stehen.
Die Analyse der ersten Strophe konzentriert sich auf die Darstellung von Sehnsucht und Verzweiflung, die durch die Verwendung von Naturmetaphern ausgedrückt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Pablo Nerudas Gedicht „Poema 8“, das Teil seiner Gedichtsammlung „Los Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada“ ist. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind Metaphern, Vergleiche, Liebe, Sehnsucht, Verzweiflung, Natur, Klang und Lautmalerei.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Pablo Nerudas "Poema 8"?
Das Gedicht thematisiert Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung, die Neruda durch kraftvolle Naturmetaphern zum Ausdruck bringt.
Welche Rolle spielt die Natur in Nerudas Metaphorik?
Die Natur dient als Projektionsfläche für menschliche Gefühle; Liebe und Verzweiflung werden auf natürliche Phänomene übertragen, um ihre Eindringlichkeit zu steigern.
Wie werden Weiblichkeit und Sexualität im Gedicht dargestellt?
Neruda thematisiert diese Punkte sehr klar und deutlich, ohne dabei obszön zu wirken, wobei er oft wenig Spielraum für andere Interpretationen lässt.
Was wird auf der lautlichen Ebene des Gedichts analysiert?
Die Arbeit untersucht Nerudas eigenen Vortrag des Gedichts, um durch Klang und Lautmalerei tiefere Einblicke in seine Gefühlswelt beim Verfassen zu gewinnen.
Aus welcher Gedichtsammlung stammt "Poema 8"?
Es ist Teil der berühmten Reihe „Los Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada“.
Welche formalen Merkmale weist das Gedicht auf?
Die Formanalyse zeigt eine Struktur mit vielen Wiederholungen und dem Verzicht auf eine klassische narrative Linie.
- Arbeit zitieren
- Jennifer Peters (Autor:in), 2008, Pablo Nerudas "Poema 8". Eine Untersuchung der Metaphern und Lautung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190050