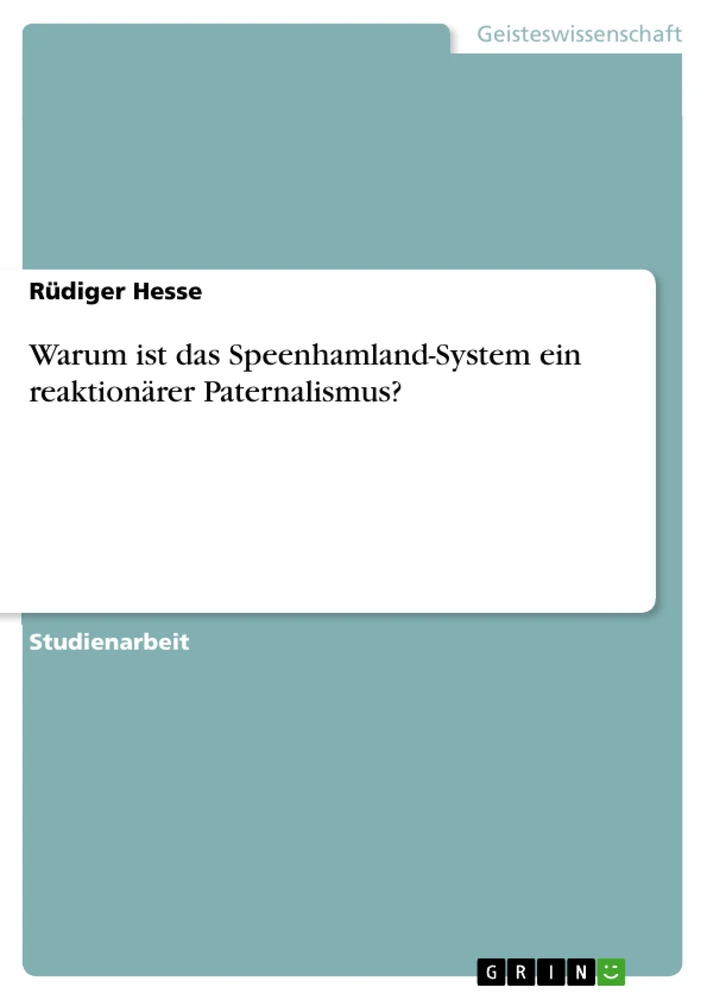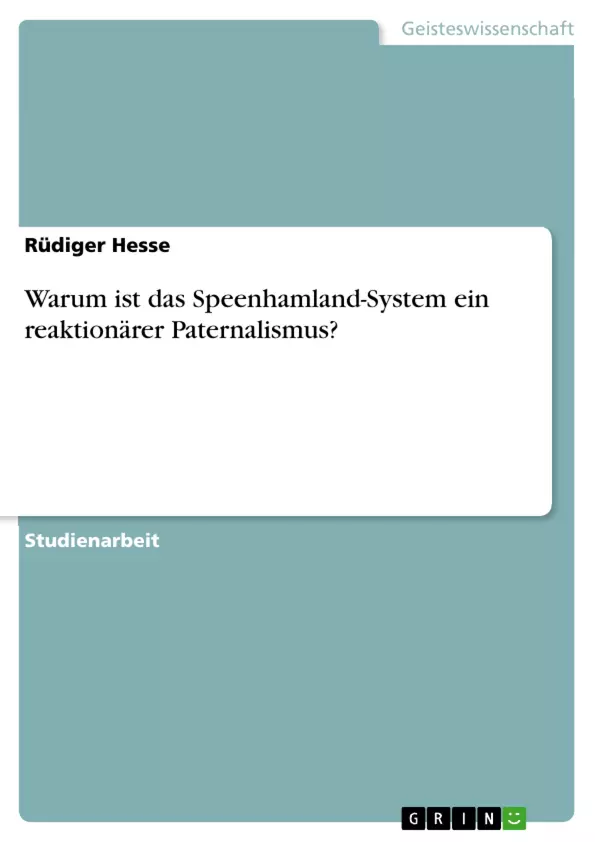Aktueller denn je ist die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehungsweise um die Einführung von bundesweit einheitlichen Mindestlöhnen. Nicht erst seit die Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen ist und auch den Trends zufolge bald bundesweit für Furore sorgen könnte. Doch die wenigsten Menschen wissen, dass es bereits in England um 1795 ein so genanntes „Recht auf Lebensunterhalt“ gab und folglich heutige Diskurse destruktiv verlaufen, wenn die Vorkenntnisse um dieses nach der Ortschaft seiner Entstehung bezeichnete Speenhamland-System außen vor bleiben. Nicht nur wir Sozialwissenschaftler sollten uns immer wieder mit dem Buch The Great Transformation von Karl Polanyi auseinander setzen, sondern auch jeder Politik interessierte wird durch das Studium dieses Werks neue Erkenntnissen erlangen und sich für zukünftige sozialpolitische Diskussionen wappnen.
Das Suhrkamp Taschenbuch bietet bereits im Klappentext einen Überblick über das Anliegen des Autors: The Great Transformation, erschienen 1944, geht von der These aus, dass erst die Herausbildung einer an Selbstregulierung glaubenden und folglich auf das „freie Spiel der Kräfte“ setzenden Marktwirtschaft zu jener charak-teristischen Herauslösung und Verselbständigung der Wirtschaft geführt hat, die histo-risch ein Novum darstellt und die bürgerliche Gesellschaft von allen anderen Gesell-schaften unterscheidet. The Great Transformation bezeichnet den Übergang von inte-grierten Gesellschaften, in denen die wirtschaftlichen Aktivitäten der Individuen in einen übergreifenden kulturellen Zusammenhang eingebettet waren, zur nicht integrierten Gesellschaft vom Typ der freien Marktwirtschaft. Während in nicht-marktwirtschaftlichen Gesellschaften „die Wirtschaftsordnung bloß eine Funktion der Gesellschaft“ , jene also von dieser abhängig ist, kehrt der Kapitalismus dieses Ver-hältnis um. Als Fiktion erscheine seine Wirtschaft autonom gegenüber allen übrigen sozialen Bereichen und Bedürfnissen. In dieser Verselbständigung der Wirtschaft ge-genüber der Gesellschaft sieht Polanyi den Grund dafür, dass die westlichen Industrie-gesellschaften dabei sind, ihre eigenen sozialen Voraussetzungen zu zerstören.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung des Speenhamland-Systems (1795-1834)
- Die reaktionäre und paternalistische Konstruktion des Speenhamland-Systems
- Das Speenhamland-System
- ,,Reaktionärer Paternalismus“
- Gründe für das Scheitern des Speenhamland-Systems
- Fiktion selbstregulierende Marktwirtschaft
- Warenfiktion Arbeitskraft
- Beschränkung des Arbeitsmarktes
- Absinken der Arbeitsproduktivität
- Lohnsubvention
- Lohnsystem
- Pauperismus
- Die Antikoalitionsgesetze
- Die Wirkungen und Folgen des Speenhamland-Systems
- Würdigung des Speenhamland-Systems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum das Speenhamland-System, ein System der Lohn- und Lebensunterhaltssubventionierung im England des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, als reaktionärer Paternalismus angesehen werden kann.
- Historische Einordnung des Speenhamland-Systems
- Analyse der reaktionären und paternalistischen Struktur des Systems
- Identifizierung der Gründe für das Scheitern des Systems
- Bewertung der Auswirkungen und Folgen des Speenhamland-Systems
- Bewertung des Systems im Kontext der historischen Entwicklung der Arbeitsbedingungen und Sozialpolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Speenhamland-Systems im Kontext der heutigen Debatten um bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlöhne hervorhebt. Anschließend wird das Speenhamland-System in den historischen Kontext des englischen Armenrechts und der Arbeitsgesetzgebung eingeordnet.
In Kapitel 3 wird die reaktionäre und paternalistische Struktur des Speenhamland-Systems herausgearbeitet. Es wird gezeigt, wie das System die Arbeitskraft ihrer natürlichen Wertigkeit und der Möglichkeit, ihren eigenen Unterhalt zu verdienen, beraubte.
Kapitel 4 widmet sich den Gründen für das Scheitern des Speenhamland-Systems. Hier werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie die Fiktion einer selbstregulierenden Marktwirtschaft, die Warenfiktion der Arbeitskraft, die Beschränkung des Arbeitsmarktes, das Absinken der Arbeitsproduktivität, Lohnsubventionierung, die Lohn-Preis-Kopplung, das Entstehen von Pauperismus und die Auswirkungen der Antikoalitionsgesetze.
In Kapitel 5 werden die Wirkungen und Folgen des Speenhamland-Systems näher betrachtet.
Die Arbeit endet mit einer kurzen Würdigung des Speenhamland-Systems.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Paternalismus, reaktionäre Politik, Speenhamland-System, Armut, Arbeitslosigkeit, Lohnentwicklung, Arbeitsrecht, historische Entwicklung der Arbeitsbedingungen, Karl Polanyi und The Great Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Speenhamland-System?
Ein System der Armenfürsorge in England (1795-1834), das den Lohn von Arbeitern durch öffentliche Zuschüsse auf ein Existenzminimum aufstockte.
Warum wird es als 'reaktionärer Paternalismus' bezeichnet?
Weil es die Arbeiter in Abhängigkeit hielt und die Entstehung eines freien Arbeitsmarktes verhinderte, während es gleichzeitig die alte Sozialstruktur zementierte.
Welche Rolle spielt Karl Polanyi in dieser Arbeit?
Die Arbeit basiert auf Polanyis Werk 'The Great Transformation', das den Übergang zur Marktwirtschaft und das Scheitern von Systemen wie Speenhamland analysiert.
Warum scheiterte das Speenhamland-System?
Es führte zu einem Absinken der Arbeitsproduktivität, zur Verarmung (Pauperismus) und dazu, dass Arbeitgeber die Löhne drückten, da der Staat die Differenz zahlte.
Was ist die 'Warenfiktion der Arbeitskraft'?
Polanyis These, dass Arbeit, Boden und Geld im Kapitalismus wie Waren behandelt werden, obwohl sie keine Produkte sind, was soziale Gefüge zerstört.
Welchen Bezug hat das System zur heutigen Grundeinkommens-Debatte?
Es dient als historisches Warnbeispiel dafür, wie Lohnsubventionen ohne Mindestlohn negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben können.
- Arbeit zitieren
- Rüdiger Hesse (Autor:in), 2011, Warum ist das Speenhamland-System ein reaktionärer Paternalismus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190075