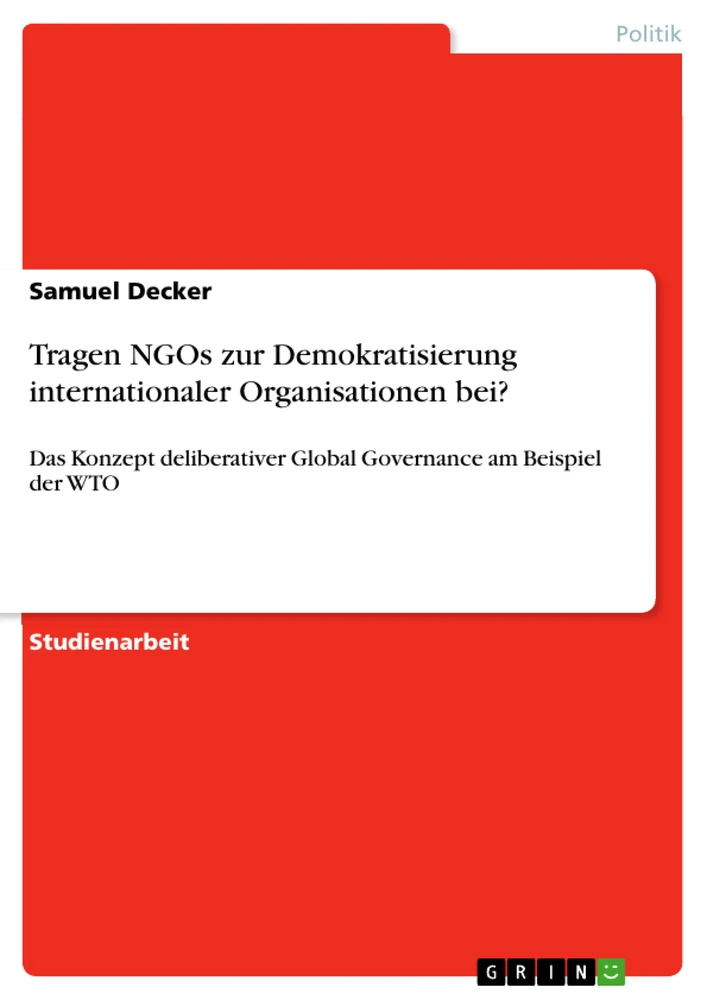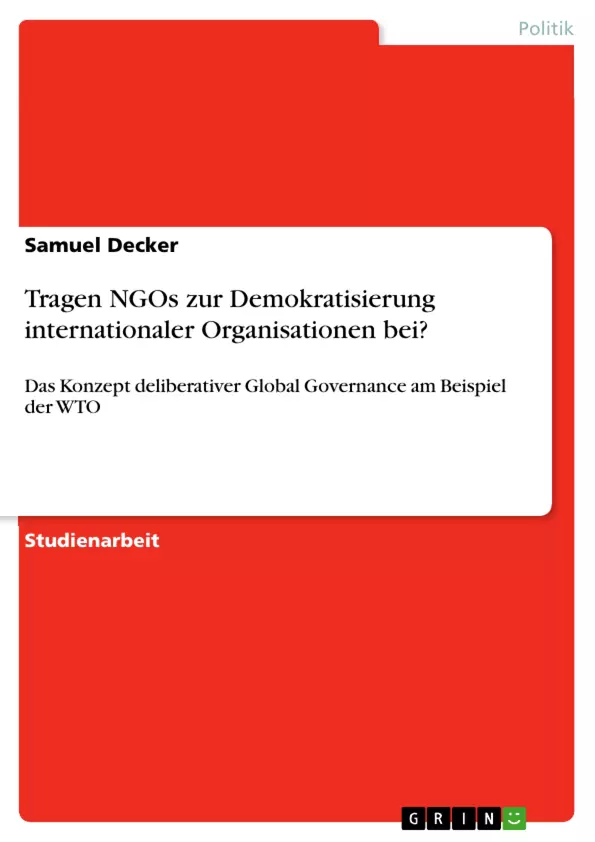Diese Arbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Streitfrage innerhalb der Internationalen Beziehungen, ob und wie die transnationale Zivilgesellschaft zur Demokratisierung internationalen Regierens beitragen kann. Konzeptionelle Grundlage dabei ist das auf Jürgen Habermas zurückgehende deliberative Demokratiemodell, das sich von der Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Akteure und der Institutionalisierung verständigungsorientierter Diskurse mehr demokratische Legitimität verspricht. Nanz und Steffek haben aus den Instruktionen der deliberativen Demokratietheorie die vier Analysekriterien Transparenz, Zugang, Responsivität und Inklusion abgeleitet, die in dieser Hausarbeit in Rezeption einer Fallstudie an die Willensbildungsprozesse der WTO angelegt werden. Dabei kommen strukturelle Defizite zum Vorschein, wie etwa unzureichende Partizipationschancen für NGOs und eklatante Machtasymmetrien zwischen zivilgesellschaftlichen und gouvernmentalen Akteuren. Die WTO kann ohne demokratische Reformen dem voraussetzungsreichen deliberativen Programm nicht gerecht werden, doch auch die NGOs weisen in demokratietheoretischer Hinsicht Mängel auf. Schlussfolgernd wird die Brauchbarkeit des deliberativen Steuerungskonzeptes an sich in Frage gestellt, da es auf Voraussetzungen gründet, die an der Realität der internationalen Politik vorbeigehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Demokratie durch Deliberation
- 3. Das Beispiel der WTO.
- 3.1. Einführung
- 3.2. Transparenz
- 3.3. Zugang
- 3.4. Responsivität.
- 3.5. Inklusion...
- 4. Fazit und Ausblick.
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie transnationale Zivilgesellschaft zur Demokratisierung internationaler Governance beitragen kann. Grundlage ist das deliberative Demokratiemodell nach Jürgen Habermas, das durch die Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Akteure und verständigungsorientierte Diskurse demokratische Legitimität erreichen soll.
- Analyse der Möglichkeiten und Grenzen transnationaler NGOs bei der Demokratisierung internationaler Organisationen.
- Anwendung des deliberativen Demokratiemodells auf die Welthandelsorganisation (WTO).
- Bewertung der Rolle von NGOs als „Transmissionsriemen“ zwischen internationalen Organisationen und der Gesellschaft.
- Untersuchung von Kriterien wie Transparenz, Zugang, Responsivität und Inklusion.
- Beurteilung des Demokratiedefizits in internationalen Organisationen und der Rolle der NGOs bei dessen Behebung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Das Thema wird im Kontext des Demokratiedefizits internationaler Organisationen eingeführt. Die Rolle von NGOs in der internationalen Politik wird thematisiert, und die Forschungsfrage nach der Demokratisierungsleistung transnationaler NGOs wird aufgestellt.
- Kapitel 2: Demokratie durch Deliberation: Der normative Ansatz des deliberativen Demokratiemodells wird vorgestellt und als theoretischer Rahmen für die Analyse der Rolle von NGOs genutzt.
- Kapitel 3: Das Beispiel der WTO: Die WTO dient als Fallstudie für die empirische Überprüfung des deliberativen Demokratiemodells im Kontext von internationalen Organisationen. Die Kapitel 3.1 bis 3.5 analysieren die WTO hinsichtlich der Kriterien Transparenz, Zugang, Responsivität und Inklusion.
Schlüsselwörter
Internationale Beziehungen, transnationale Zivilgesellschaft, NGOs, Demokratie, Deliberation, Legitimität, Welthandelsorganisation (WTO), Transparenz, Zugang, Responsivität, Inklusion, Demokratiedefizit.
Häufig gestellte Fragen
Können NGOs internationale Organisationen demokratisieren?
Theoretisch ja, als „Transmissionsriemen“ zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Die Praxis (z. B. bei der WTO) zeigt jedoch strukturelle Defizite und Machtasymmetrien.
Was ist deliberative Demokratie?
Ein Modell nach Jürgen Habermas, das demokratische Legitimität durch verständigungsorientierte Diskurse und die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure erreichen will.
Welche Kriterien werden zur Analyse der WTO genutzt?
Die Arbeit nutzt die vier Kriterien nach Nanz und Steffek: Transparenz, Zugang, Responsivität und Inklusion.
Warum wird die Rolle der NGOs in der WTO kritisch gesehen?
Weil NGOs oft selbst Legitimationsmängel aufweisen und ihre Partizipationschancen gegenüber staatlichen Akteuren sehr begrenzt sind.
Was ist das Hauptproblem internationaler Governance?
Das sogenannte Demokratiedefizit, da Entscheidungen oft fernab von direkter demokratischer Kontrolle durch die Bürger getroffen werden.
Ist das deliberative Modell für die Weltpolitik praxistauglich?
Die Arbeit stellt dies infrage, da die realen Machtverhältnisse in der internationalen Politik oft den idealen Voraussetzungen der Deliberationstheorie widersprechen.
- Arbeit zitieren
- Samuel Decker (Autor:in), 2011, Tragen NGOs zur Demokratisierung internationaler Organisationen bei?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190119