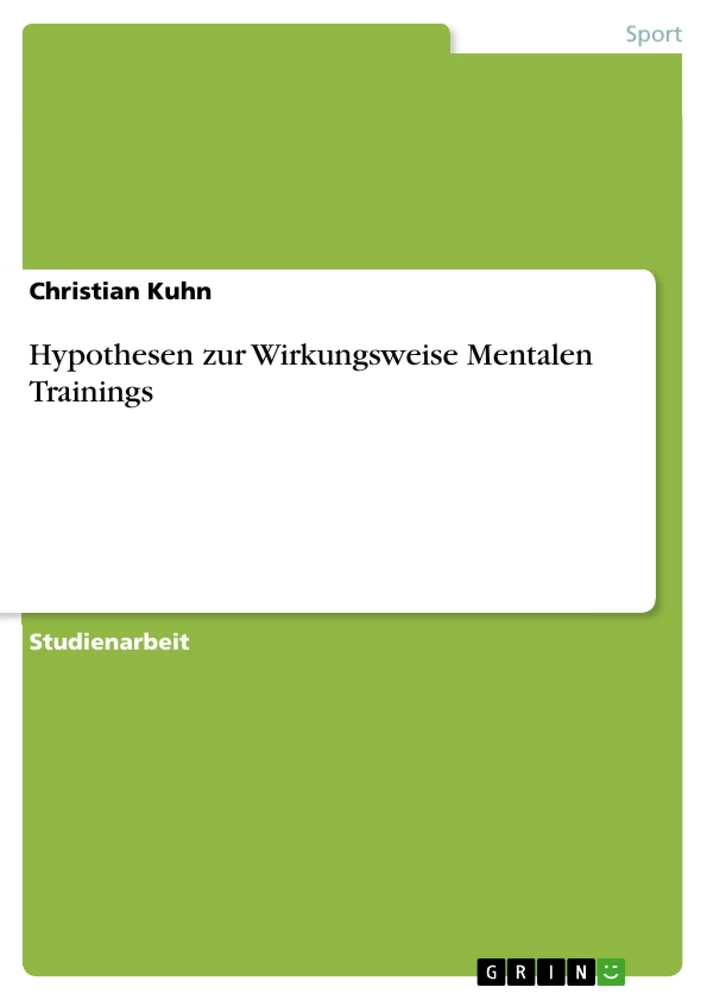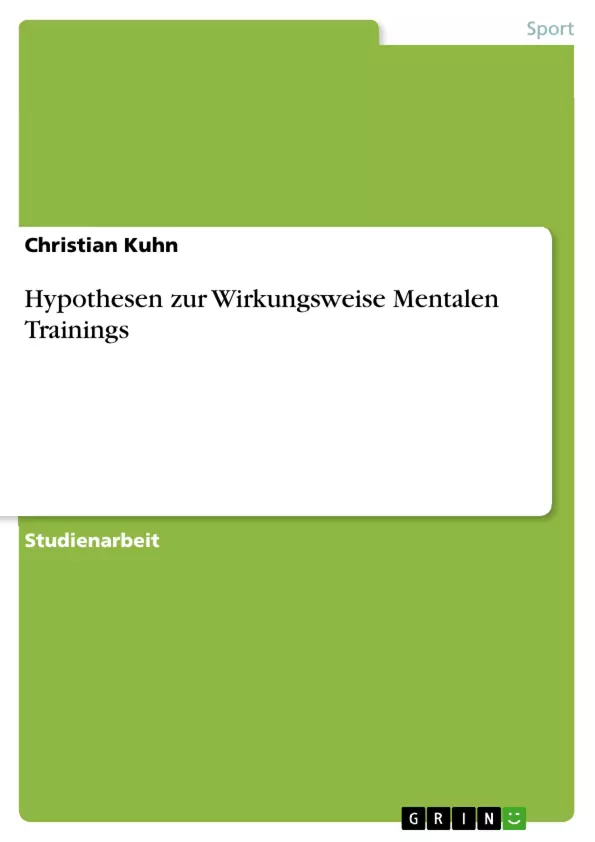Neben dem Lehren allgemeiner psychologischer Aspekte des Sports und der Forschungstätigkeit hat die Sportpsychologie besonders auch eine beratende Rolle inne. Dabei soll die Anwendung psychologischer (und medizinischer) Kenntnisse für den Sport sowohl der Leistungssteigerung als auch der Rehabilitation dienen. Doch auch für eine optimale Gestaltung des Breitensports ist die Sportpsychologie in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, wobei heute ein Schwerpunkt der sportpsychologischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Leistungssteigerung liegt (vgl. Birbaumer et al., 1999). Im Rahmen der Sportpsychologie als anwendungsorientierte, empirische Wissenschaft ist also der praktische Nutzen von Erkenntnissen und den daraus abgeleiteten Methoden stets erforderlich. Nicht zuletzt für die Beschreibung und Erklärung sportmotorischer Lernprozesse gewinnt der Untersuchungsgegenstand des Zusammenhangs zwischen Bewegung und kognitiven Prozessen immer mehr an Bedeutung, geht es doch um die Frage, wie mentale Prozesse eine gegenständliche Bewegungshandlung beeinflussen oder diese gar strukturieren und organisieren (vgl. Munzert, 2001). Die Methode des Mentalen Trainings und der Begriff, der es umschreibt, stellen besonders im Hinblick auf den Erhalt oder die Zunahme einer Leistungsfähigkeit ein exemplarisches Untersuchungsfeld dar. So verwenden auch aktuelle Untersuchungen, beispielsweise zur Frage des Zusammenhangs zwischen den Bewegungsrepräsentationen technikprägender Merkmale und kinemetrischen Charakteristika ausgewählter sportlicher Bewegungen, theoretische Ansätze rund um Aspekte des Mentalen Trainings (Blaser et al., 1999). Derartige Studien werden am Institut für Sportwissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg auch weiterhin durchgeführt. Seine praktische Relevanz und die offensichtlich guten Möglichkeiten, sportmotorische Lernprozesse durch empirische Untersuchungen einzelner Aspekten des Mentalen Trainings zu beschreiben und zu erklären, rechtfertigen erneut die Frage nach der Wirkungsweise des Mentalen Trainings. Dies veranlasst mich daher im Rahmen dieser Arbeit, bestehende Hypothesen noch einmal grundlegend zu erläutern. Zu diesem Zwecke wird im Folgenden zunächst eine begriffliche Abgrenzung vorgenommen und das Mentale Training definiert. Über einige Grundgedanken zur den Erklärungsansätzen sollen die drei bedeutendsten Hypothesen erläutert und kurz diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeiner Teil
- Begriffsabgrenzung
- Definitionen des Mentalen Trainings
- Grundlegende Gedanken zu den Hypothesen
- Die kognitive Hypothese
- Die ideomotorische Hypothese
- Die Programmierungs-Hypothese
- Schlußdiskussion aus neurophysiologischer Sicht mit Fokus auf die Programmierungs-Hypothese
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wirkungsweise des Mentalen Trainings im sportlichen Kontext. Sie analysiert verschiedene Hypothesen, die die Mechanismen hinter dieser Methode erklären sollen, und untersucht deren Relevanz für die Leistungssteigerung und den sportmotorischen Lernprozess.
- Begriffsabgrenzung des Mentalen Trainings und Abgrenzung von ähnlichen Verfahren
- Definitionen des Mentalen Trainings und dessen Bedeutung für die Sportpsychologie
- Analyse verschiedener Hypothesen, die die Wirkungsweise des Mentalen Trainings erklären
- Diskussion der Hypothesen im Hinblick auf neurophysiologische Erkenntnisse
- Ausblick auf weitere Forschungsfragen im Bereich des Mentalen Trainings
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Mentalen Trainings im Sport und in der Sportpsychologie dar. Sie verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven Prozessen und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
- Allgemeiner Teil: In diesem Kapitel wird der Begriff des Mentalen Trainings abgegrenzt und definiert. Außerdem werden die grundlegenden Gedanken zu den verschiedenen Erklärungsansätzen des Mentalen Trainings vorgestellt.
- Die kognitive Hypothese: Dieses Kapitel stellt die kognitive Hypothese zur Wirkungsweise des Mentalen Trainings vor. Sie erklärt den Einfluss mentaler Prozesse auf die sportliche Leistung anhand von kognitiven Mechanismen.
- Die ideomotorische Hypothese: Hier wird die ideomotorische Hypothese vorgestellt, die die Verbindung zwischen mentalen Vorstellungen und motorischen Handlungen beleuchtet.
- Die Programmierungs-Hypothese: Dieses Kapitel fokussiert auf die Programmierungs-Hypothese. Sie beschreibt die mentale Programmierung von Bewegungsmustern und deren Einfluss auf die Ausführung der Bewegungen.
Schlüsselwörter
Mentales Training, Sportpsychologie, Leistungssteigerung, Lernprozess, Hypothesen, kognitive Prozesse, ideomotorische Hypothese, Programmierungs-Hypothese, neurophysiologische Sicht, Bewegungssteuerung, Bewegungsrepräsentationen, sportmotorische Lernprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Mentalem Training im Sport?
Mentales Training dient der Leistungssteigerung, der Optimierung sportmotorischer Lernprozesse sowie der Rehabilitation durch die bewusste Nutzung kognitiver Prozesse zur Bewegungssteuerung.
Was besagt die kognitive Hypothese?
Diese Hypothese erklärt die Wirkung des Mentalen Trainings durch kognitive Mechanismen, bei denen die geistige Vorwegnahme einer Handlung die spätere reale Ausführung verbessert.
Was versteht man unter der ideomotorischen Hypothese?
Die ideomotorische Hypothese besagt, dass allein die intensive Vorstellung einer Bewegung minimale muskuläre Impulse auslöst, die das motorische Lernen unterstützen.
Was ist der Kern der Programmierungs-Hypothese?
Diese Hypothese geht davon aus, dass durch Mentales Training motorische Programme im Gehirn erstellt oder gefestigt werden, die dann bei der physischen Ausführung abgerufen werden.
Welche Rolle spielt die Sportpsychologie hierbei?
Die Sportpsychologie liefert als empirische Wissenschaft die theoretischen Grundlagen und Erklärungsmodelle, um den praktischen Nutzen von mentalen Techniken für Athleten zu belegen.
- Quote paper
- Christian Kuhn (Author), 2002, Hypothesen zur Wirkungsweise Mentalen Trainings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19019