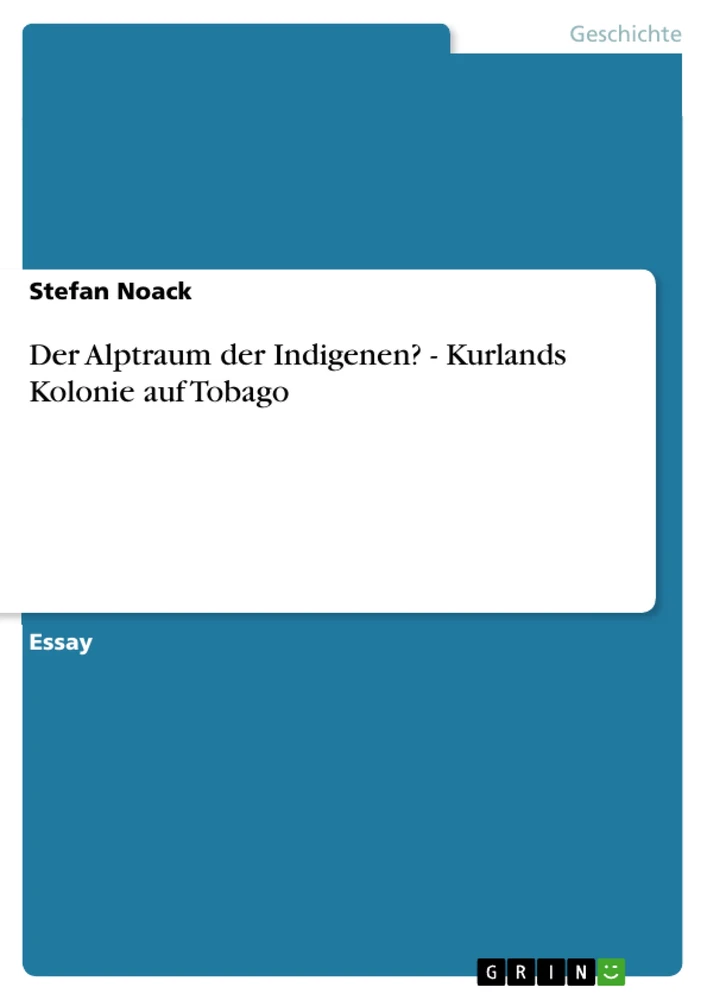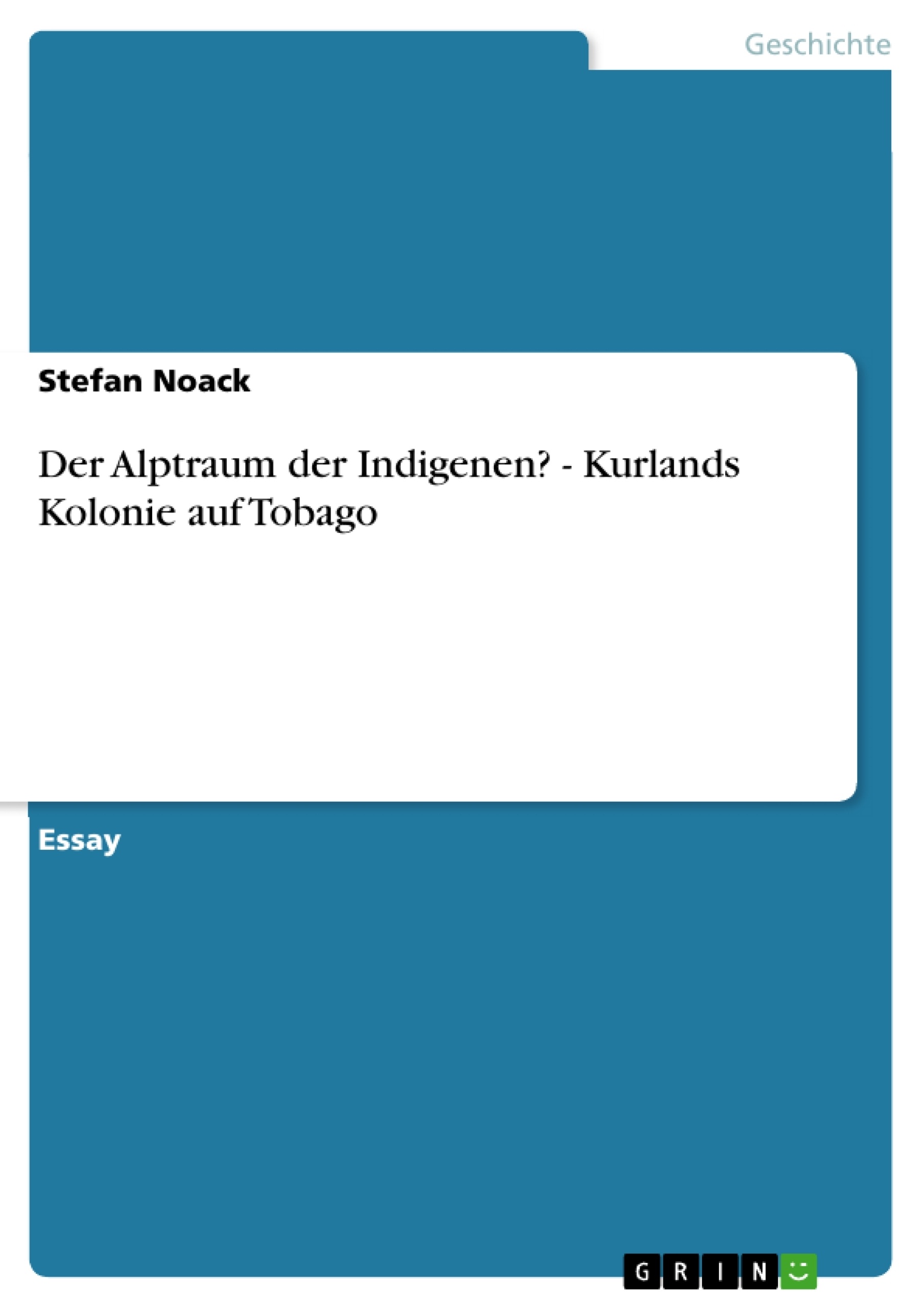„Das eben ist unsere einzige Pflicht der Geschichte gegenüber: Sie nochmals zu schreiben. [...] Haben wir einmal die wissenschaftlichen Gesetze, die das Leben beherrschen, ganz durchforscht, dann werden wir entdecken, dass der einzige Mensch, der mehr in Illusionen befangen ist, als der Träumer, der Tatmensch ist. [...] Jede Kleinigkeit, die wir tun, gerät in die große Maschine des Lebens, die unsere Tugenden zu Staub zermalmen kann und wertlos macht.“
Dieses Zitat aus Oscar Wildes Stück „Der Kritiker als Künstler“ veranschaulicht ein Problem, dem sich jeder Historiker früher oder später stellen muss. So meisterhaft ihm seine Arbeiten im Moment des Schreibens erscheinen: nach Jahren der fachlichen und persönlichen Entwicklung entpuppen sich viele der Wahrheiten, die er zu kennen glaubte, als Irrtümer. Auch wenn das Werk des Historikers dann immer noch als Standardwerk gelten sollte: um der Verantwortung gegenüber seiner Profession gerecht zu werden, muss er es überarbeiten.
Mit dem Mut des Unwissenden beschloss ich vor zwei Jahren eine Hausarbeit über das Herzogtum Kurland und seine Kolonie auf der Karibikinsel Tobago zu schreiben. Obwohl es mir an Zeit, Sprachkenntnissen, Quellen, Literatur und vor allem Hintergrundwis-sen mangelte, entstand eine Arbeit mit der ich damals sehr zufrieden war. Ich veröffentlichte sie im Grin-Verlag und war erfreut, als ein Online-Abdruck der Arbeit im Wikipedia-Artikel zur kurländischen Kolonialgeschichte verlinkt wurde. Seither habe ich mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt und neue Erkenntnisse gewonnen. Durch Lehrveranstaltungen, u.a. zu den Postcolonial Studies, hat sich mein Blick auf Geschichte im Allgemeinen und koloniale Geschichte im Besonderen gewandelt. In meiner Arbeit finde ich heute viele inhaltliche und methodische Fehler, die ich im Folgenden aufdecken und berichtigen möchte.
In den ersten beiden Abschnitten der vorliegenden Arbeit werden deshalb Quellenlage und Sekundärliteratur zum Thema Kurland und Tobago diskutiert. Danach folgen einige wichtige Korrekturen und Ergänzungen zu meiner Arbeit von 2009. Abschließend möchte ich auf zwei zentrale Problematiken aufmerksam machen, die bei Untersuchungen zur kurländischen Kolonialgeschichte beachtet werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Quellen
- Sekundärliteratur
- Korrekturen und Ergänzungen
- Zu Kurland und Tobago
- Zu den kurländischen Kolonien
- Die erste Phase
- Die zweite Phase
- Die Indigenen
- Das Erbe Kurlands
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Kolonialgeschichte des Herzogtums Kurland auf der Insel Tobago im 17. Jahrhundert zu revidieren und zu erweitern. Sie untersucht die Quellenlage, die Sekundärliteratur und identifiziert Korrekturen und Ergänzungen zu einer früheren Arbeit des Autors. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen den Kurländern, den indigenen Bewohnern Tobagos und dem Erbe der Kolonie.
- Die kurländische Kolonialgeschichte als Teil der Baltischen Geschichte
- Die Quellenlage und die Schwierigkeiten bei der Forschung
- Der Einfluss von Sekundärliteratur auf die Interpretation historischer Ereignisse
- Die Rolle der Indigenen in der kurländischen Kolonialgeschichte
- Das Erbe der kurländischen Kolonie auf Tobago
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Autor stellt die Notwendigkeit einer Überarbeitung seiner früheren Arbeit zur kurländischen Kolonialgeschichte dar, die durch neue Erkenntnisse und gewandelte Perspektiven motiviert ist.
- Zu den Quellen: Dieses Kapitel untersucht die Schwierigkeiten bei der Quellenrecherche zur kurländischen Kolonialgeschichte, die durch Verluste in Archiven und die sprachliche Vielfalt erschwert wird.
- Sekundärliteratur: Der Autor analysiert die vorhandene Sekundärliteratur und identifiziert wichtige Werke zur kurländischen Kolonialgeschichte, insbesondere die Arbeit von Otto Heinz Mattiesen.
- Korrekturen und Ergänzungen: Dieser Abschnitt präsentiert wichtige Korrekturen und Ergänzungen zur früheren Arbeit des Autors, die durch neuere Forschungsergebnisse und einen kritischen Umgang mit den Quellen ermöglicht werden.
- Die Indigenen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der indigenen Bewohner Tobagos in der kurländischen Kolonialgeschichte und analysiert die Interaktion zwischen Kolonialherren und indigener Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Kolonialgeschichte des Herzogtums Kurland, der Insel Tobago, den Beziehungen zwischen Kurländern und indigenen Bewohnern, den Herausforderungen der Quellenrecherche, der Rolle von Sekundärliteratur und dem Erbe der kurländischen Kolonie.
Häufig gestellte Fragen
Was war die kurländische Kolonie auf Tobago?
Im 17. Jahrhundert versuchte das Herzogtum Kurland (heutiges Lettland), eine Kolonie auf der Karibikinsel Tobago zu etablieren. Es war einer der kleinsten europäischen Staaten, die Kolonialpolitik betrieben.
Warum ist die Quellenlage zur Geschichte Kurlands auf Tobago schwierig?
Viele Quellen gingen durch Kriege und Archivverluste verloren. Zudem erschwert die sprachliche Vielfalt (Lettisch, Deutsch, Russisch, Englisch) die internationale Forschung.
Wie interagierten die Kurländer mit den Indigenen auf Tobago?
Die Beziehungen waren komplex und oft von Konflikten geprägt. Die Arbeit untersucht kritisch, wie die indigene Bevölkerung unter den kolonialen Ambitionen litt.
Wer war Otto Heinz Mattiesen in diesem Kontext?
Mattiesen verfasste ein Standardwerk zur kurländischen Kolonialgeschichte, das jedoch aufgrund seiner Entstehungszeit kritisch auf methodische Fehler und zeitgenössische Färbungen geprüft werden muss.
Was blieb vom Erbe Kurlands auf Tobago übrig?
Neben geografischen Bezeichnungen wie "Great Courland Bay" blieb vor allem ein Bewusstsein für diese ungewöhnliche Episode der baltischen und karibischen Geschichte zurück.
- Quote paper
- Stefan Noack (Author), 2011, Der Alptraum der Indigenen? - Kurlands Kolonie auf Tobago, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190191