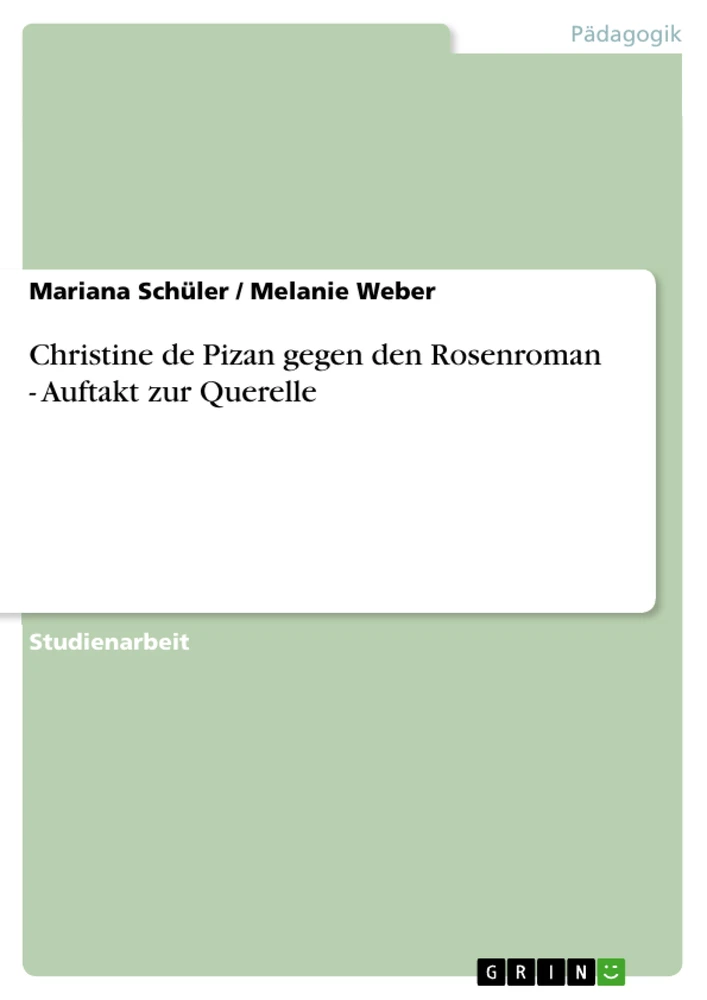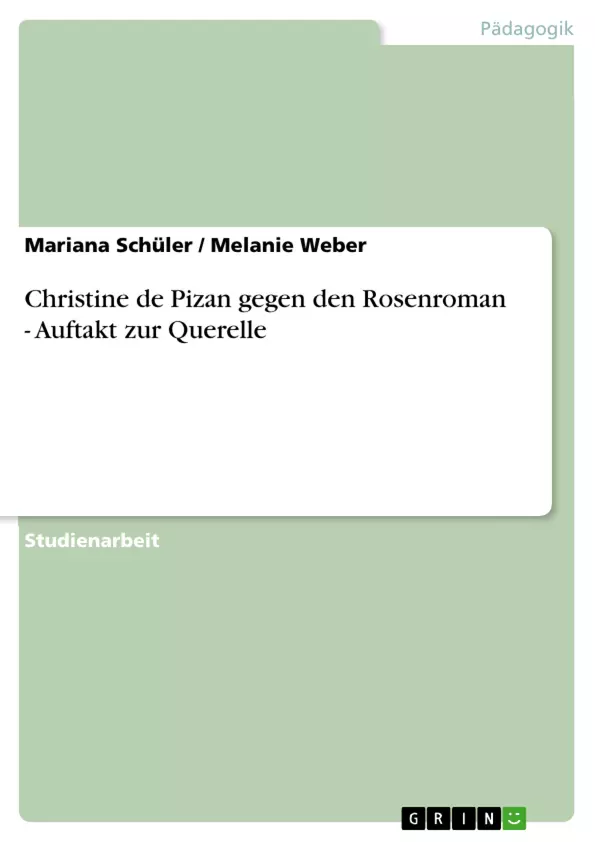Christine de Pizan gilt als Vorreiterin der Frauenrechtsbewegung und hat mit ihrem Rosenroman und dem Buch von der Stadt der Frauen entscheidende Grundlagen gelegt, auf die sich später Autorinnen wie J. Butler rückbeziehen. Die Debatten um die Gleichstellung von Mann und Frau sind auch heute noch von äußerster Brisanz und Aktualität. [...] Im Folgenden wird der Auftakt zur „Querelle des Femmes“ untersucht, indem
CHRISTINE DE PIZANs3 Werke betrachtet werden und ebenso das zweiteilige Werk
von GUILLAUME DE LORRIS und JEAN DE MEUN Le Roman de la Rose, der als Auslöser
jenes großen und bis heute andauernden literarischen Streits über die Stellung der
Frau in der Gesellschaft gilt. Die deutsche Entsprechung für Le Roman de la Rose ist
Der Rosenroman. CHRISTINE bezieht in mehreren Werken Stellung zur – später sogenannten
– „Querelle des Femmes“, unter anderem in Le Livre de la Cité des Dames,
auf das später noch eingegangen wird. Sie ist die erste Dichterin Frankreichs,
die mit dem Schreiben ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Ihre Werke, die teilweise
stark autobiografisch angelegt sind, fordern und beschreiben fortwährend die
Gleichwertigkeit von Frau und Mann und geben einen Einblick in Frankreichs Gesellschaft
zur Zeit des Hundertjährigen Krieges.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung (Mariana Schüler)
- 2. CHRISTINE DE PIZANS Kurzbiographie (Mariana Schüler)
- 3. Der Rosenroman << Le Roman de la Rose » (Melanie Weber)
- 3.1. Verfasser und Daten
- 3.2. Inhalt des ersten Teils
- 3.3. Inhalt des zweiten Teils
- 3.4. Das Werk
- 4. Der Streit um den Rosenroman (1401-1404)
- 4.1. CHRISTINE DE PIZANS Hinwendung zur Frauenthematik (Mariana Schüler)
- 4.2. Ansatzpunkte des Débats (Mariana Schüler)
- 4.3. Konkrete Auslöser für CHRISTINE DE PIZANS Widerspruch (Melanie Weber)
- 4.4. Beteiligte und Meinungen des Débats (Mariana Schüler)
- 4.5. Das vorläufige Ende des Débats (Melanie Weber)
- 5. Das Buch von der Stadt der Frauen << Le Livre de la Cité des Dames >>> (Melanie Weber)
- 5.1. Eine Schrift zur Rehabilitierung der Frau
- 5.2. Inhalt und Gestaltung
- 6. Weiterer Verlauf und heutige Bezüge (Mariana Schüler)
- 7. Fazit (Mariana Schüler)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die literarische Auseinandersetzung zwischen Christine de Pizan und dem Rosenroman << Le Roman de la Rose >>, die den Auftakt zur Querelle des Femmes markiert. Ziel ist es, die wichtigsten Argumente beider Seiten darzulegen und den historischen Kontext des Streits zu beleuchten.
- Die Rolle der Frau im Mittelalter
- Die Bedeutung des Rosenromans für die Frauenbilddebatte
- CHRISTINE DE PIZANS Kritik an der misogynen Darstellung von Frauen im Rosenroman
- Die literarische Strategie von CHRISTINE DE PIZANS Werke
- Die historische und gesellschaftliche Relevanz der Querelle des Femmes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel 1) führt in die Thematik der Frauenbilddebatte im Mittelalter ein und stellt den historischen und literarischen Kontext des Rosenromans vor. Kapitel 2 beleuchtet CHRISTINE DE PIZANS Biographie und stellt ihre wichtigsten Werke vor. Kapitel 3 befasst sich mit dem Rosenroman << Le Roman de la Rose >>, seinem Autor und seinen Inhalten. Es werden sowohl der erste Teil von GUILLAUME De Lorris als auch der zweite Teil von JEAN DE MEUN detailliert analysiert. Kapitel 4 beleuchtet den Streit um den Rosenroman, die wichtigsten Akteure und Argumente sowie die Entstehung der Querelle des Femmes. Abschließend werden in Kapitel 5 die wichtigsten Punkte von CHRISTINE DE PIZANS Werk << Le Livre de la Cité des Dames >> beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Querelle des Femmes, Christine de Pizan, dem Rosenroman << Le Roman de la Rose >>, Frauenbild, Misogynie, Mittelalter, Literatur, und dem Buch von der Stadt der Frauen << Le Livre de la Cité des Dames >>. Die Arbeit untersucht den Streit um die Rolle der Frau in der Gesellschaft und analysiert, wie CHRISTINE DE PIZANS Werke zu einer feministischen Sichtweise der Welt beitragen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Christine de Pizan?
Christine de Pizan (1364–1430) war die erste Berufsschriftstellerin Frankreichs und gilt als frühe Vorkämpferin für die Rechte der Frauen.
Was war der Anlass für den „Streit um den Rosenroman“?
Christine de Pizan kritisierte die frauenfeindliche (misogyne) Darstellung und die obszöne Sprache im zweiten Teil des populären „Roman de la Rose“ von Jean de Meun.
Was ist die „Querelle des Femmes“?
Es ist eine über Jahrhunderte andauernde literarische Debatte über die Natur, den Status und die Fähigkeiten der Frau in der Gesellschaft.
Worum geht es in ihrem Werk „Das Buch von der Stadt der Frauen“?
Christine entwirft eine symbolische Stadt, die von berühmten und tugendhaften Frauen der Geschichte erbaut wird, um die Gleichwertigkeit der Geschlechter zu beweisen.
Welche Rolle spielt der Rosenroman heute noch?
Er gilt als Auslöser für den ersten großen feministischen Diskurs der Literaturgeschichte und wird im Kontext mittelalterlicher Frauenbilder intensiv erforscht.
- Quote paper
- Mariana Schüler (Author), Melanie Weber (Author), 2009, Christine de Pizan gegen den Rosenroman - Auftakt zur Querelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190271