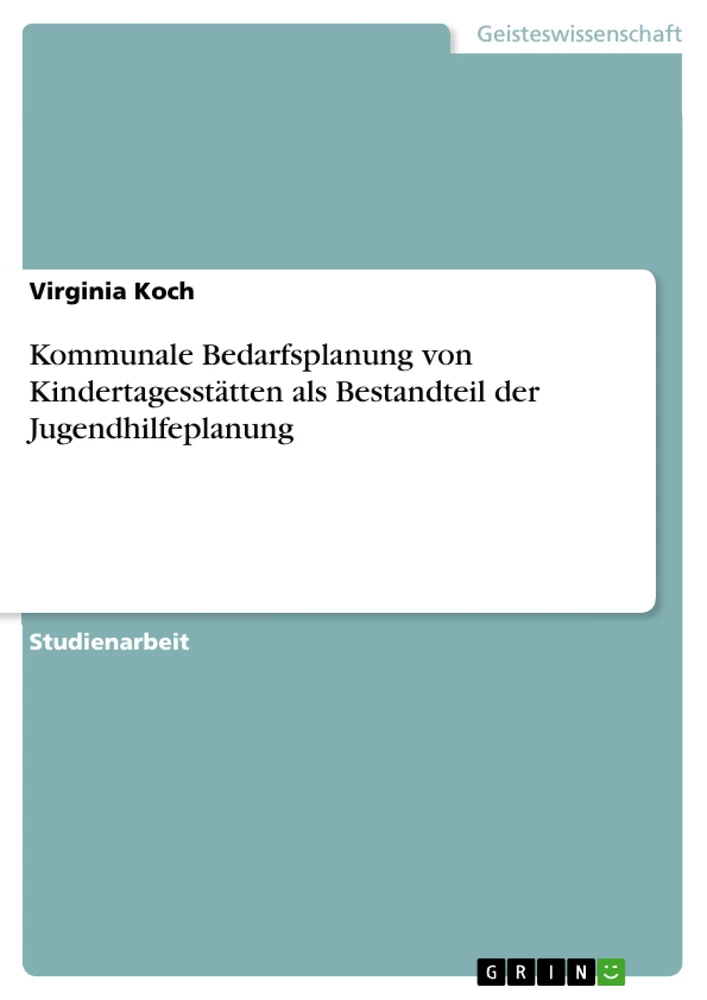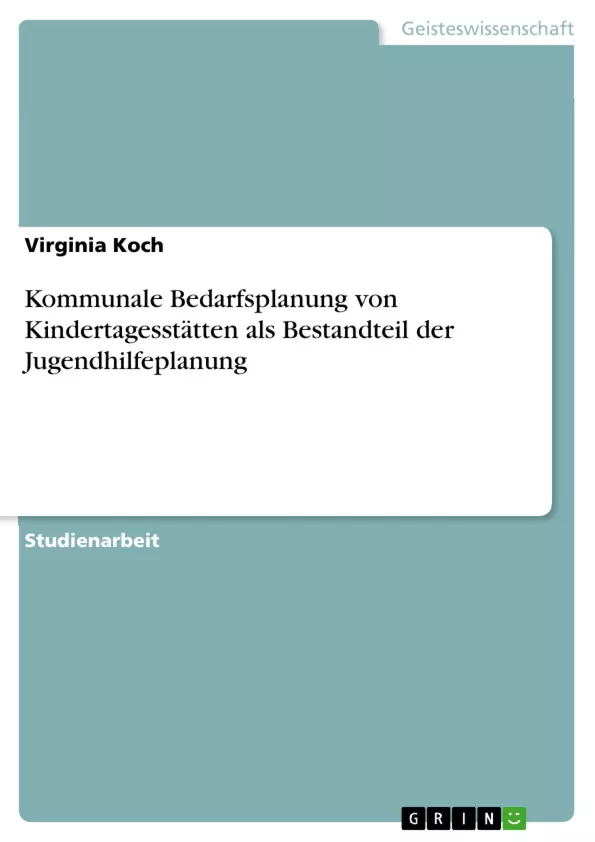Für die Jugendhilfeplanung ergeben sich im Zusammenhang mit dem durch das Kinderförderungsgesetz festgeschriebenen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ab August 2013 komplexe Aufgaben und Herausforderungen sowohl hinsichtlich des quantitativen als auch des qualitätsorientierten Ausbaus der Angebote.
Im Rahmen der Hausarbeit werden aus jugendhilfeplanerischer Perspektive die maßgeblichen Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren beschrieben, analysiert und eingeordnet, die sich den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung stellen, um diesen Rechtsanspruch umzusetzen. Bezogen auf den Freistaat Sachsen wird im Wesentlichen auf gesetzlich vorgegebene Rahmenbedingungen sowie das Gebot zur Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren und Kooperationspartnern eingegangen. Im Anschluss folgt die Darstellung und Würdigung der einzelnen Planungselemente. Die Hausarbeit endet mit einem Blick auf das grundsätzliche Problem der Finanzierbarkeit der durch die Jugendhilfeplanung gewonnenen Erkenntnisse und einem kritischen Fazit bezüglich dem theoretischen Anspruch an Jugendhilfeplanung im Lichte des Kinderförderungsgesetzes und der Realität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kommunale Planung von Kindertagesstätten als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Intention des Kinderförderungsgesetzes
- Gesetzliche Regelungen auf Bundesebene
- Jugendhilfeplanung im SGB VIII
- Förderung von Kindern in Tagesstätten und Kindertagespflege vor Inkrafttreten des Kifög
- Kinderförderungsgesetz
- Landesrechtliche Regelungen
- Jugendhilfeplanung im Landesjugendhilfegesetz Sachsen
- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Jugendhilfeplanung als kommunikativer und beteiligungsorientierter Prozess
- Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Gesetzliche Grundlagen der Zusammenarbeit
- Spannungsfeld zwischen den Interessen und Vorstellungen freier und öffentlicher Träger
- ,,Weil Kinder Zeit brauchen“ – ein Beispiel für die Vorstellungen freier Träger zur frühkindlichen Bildung
- Zusammenarbeit mit privat-gewerblichen Trägern und der Kindertagespflege
- Weitere Kooperationspartner
- Gremien
- Jugendhilfeausschuss
- Planungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII
- Planungselemente
- Zielentwicklung
- Bestandserhebung
- Daten zur Bevölkerungsstruktur
- Daten zur Sozialstruktur
- Bestands- und Belegungsstatistik der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege
- Bedarfsermittlung
- Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Bewertung
- Demografische Entwicklungen
- Bedürfnisse der Adressaten
- Politische Vorstellungen und öffentliche Relevanz der frühkindlichen Bildung
- Erkenntnisse der Wissenschaft und Fachöffentlichkeit im Lichte des Kifög
- Einschätzungen örtlicher Fachkräfte und Träger
- Maßnahmenplanung
- Handlungsbedarfe versus Finanzkraft der Kommunen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich aus jugendhilfeplanerischer Perspektive mit den Herausforderungen und Rahmenbedingungen, die sich durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren ab August 2013 ergeben. Sie analysiert die gesetzlichen Grundlagen, die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren und die einzelnen Planungselemente im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Die Arbeit betrachtet dabei insbesondere die Situation im Freistaat Sachsen und thematisiert abschließend das Problem der Finanzierbarkeit der durch die Jugendhilfeplanung gewonnenen Erkenntnisse.
- Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren
- Die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes in der Praxis
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern
- Die Herausforderungen der Bedarfsplanung und -ermittlung
- Die Finanzierung der Kindertagesstätten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Hintergrund der Hausarbeit und die Bedeutung der Jugendhilfeplanung im Zusammenhang mit dem Kinderförderungsgesetz. Kapitel 1 beleuchtet die kommunale Planung von Kindertagesstätten als Teil der Jugendhilfeplanung und stellt die Besonderheiten dieses Bereichs heraus. Kapitel 2 und 3 analysieren die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene, insbesondere das SGB VIII, das Kinderförderungsgesetz und das Sächsische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Kapitel 4 befasst sich mit der Jugendhilfeplanung als kommunikativem und beteiligungsorientiertem Prozess und untersucht die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern sowie weiteren Kooperationspartnern. Kapitel 5 beleuchtet die verschiedenen Gremien, die an der Jugendhilfeplanung beteiligt sind, und Kapitel 6 stellt die wichtigsten Planungselemente wie Zielentwicklung, Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung vor. Kapitel 7 beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Finanzierbarkeit der Kindertagesstätten und Kapitel 8 bietet ein kritisches Fazit zum theoretischen Anspruch der Jugendhilfeplanung im Lichte des Kinderförderungsgesetzes und der Realität.
Schlüsselwörter
Jugendhilfeplanung, Kindertagesstätten, Kinderförderungsgesetz, SGB VIII, Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Bedarfsplanung, Bedarfsermittlung, Qualitätssicherung, Zusammenarbeit, öffentliche und freie Träger, Finanzierbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Kinderförderungsgesetz (Kifög)?
Es schreibt seit August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr fest.
Was ist die Aufgabe der Jugendhilfeplanung?
Sie muss den Bestand an Betreuungsplätzen erheben, den zukünftigen Bedarf ermitteln und Maßnahmen planen, um den gesetzlichen Rechtsanspruch quantitativ und qualitativ zu erfüllen.
Wie arbeiten öffentliche und freie Träger zusammen?
Die Zusammenarbeit ist gesetzlich im SGB VIII vorgeschrieben; freie Träger (wie Kirchen oder Vereine) bringen ihre Expertise und Vielfalt in das kommunale Angebot ein.
Welche Daten werden für die Bedarfsermittlung benötigt?
Wichtig sind demografische Daten zur Bevölkerungsstruktur, Informationen zur Sozialstruktur sowie aktuelle Belegungsstatistiken der Kitas.
Warum ist die Finanzierung der Kitas ein Problem?
Oft klafft eine Lücke zwischen dem theoretischen Rechtsanspruch und der tatsächlichen Finanzkraft der Kommunen, was den Ausbau und die Qualitätssicherung erschwert.
- Citar trabajo
- Virginia Koch (Autor), 2011, Kommunale Bedarfsplanung von Kindertagesstätten als Bestandteil der Jugendhilfeplanung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190283