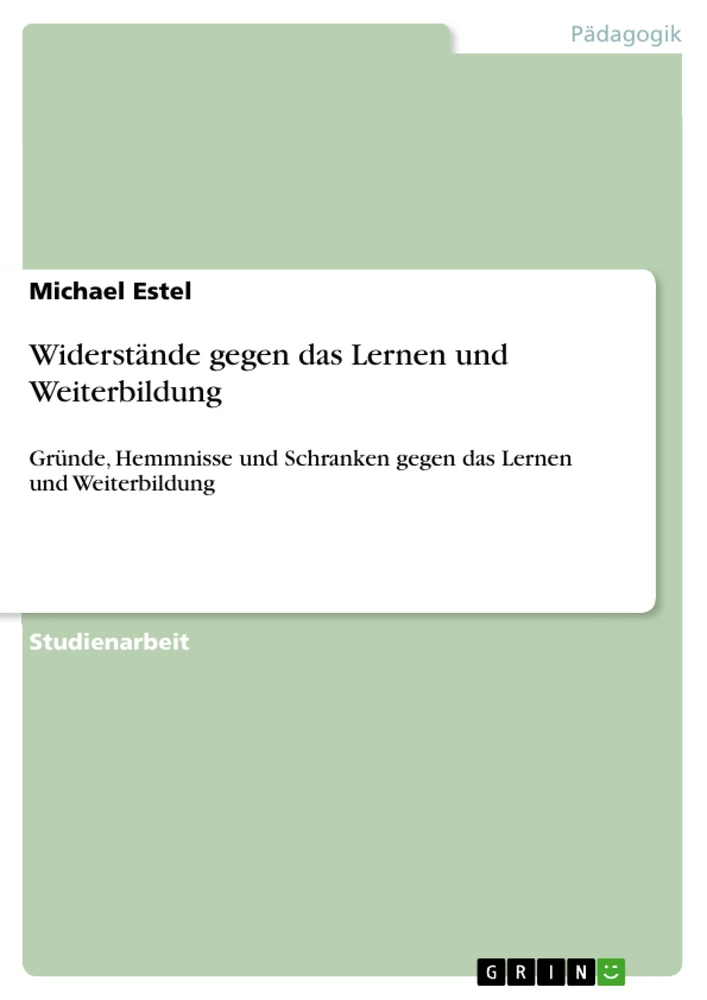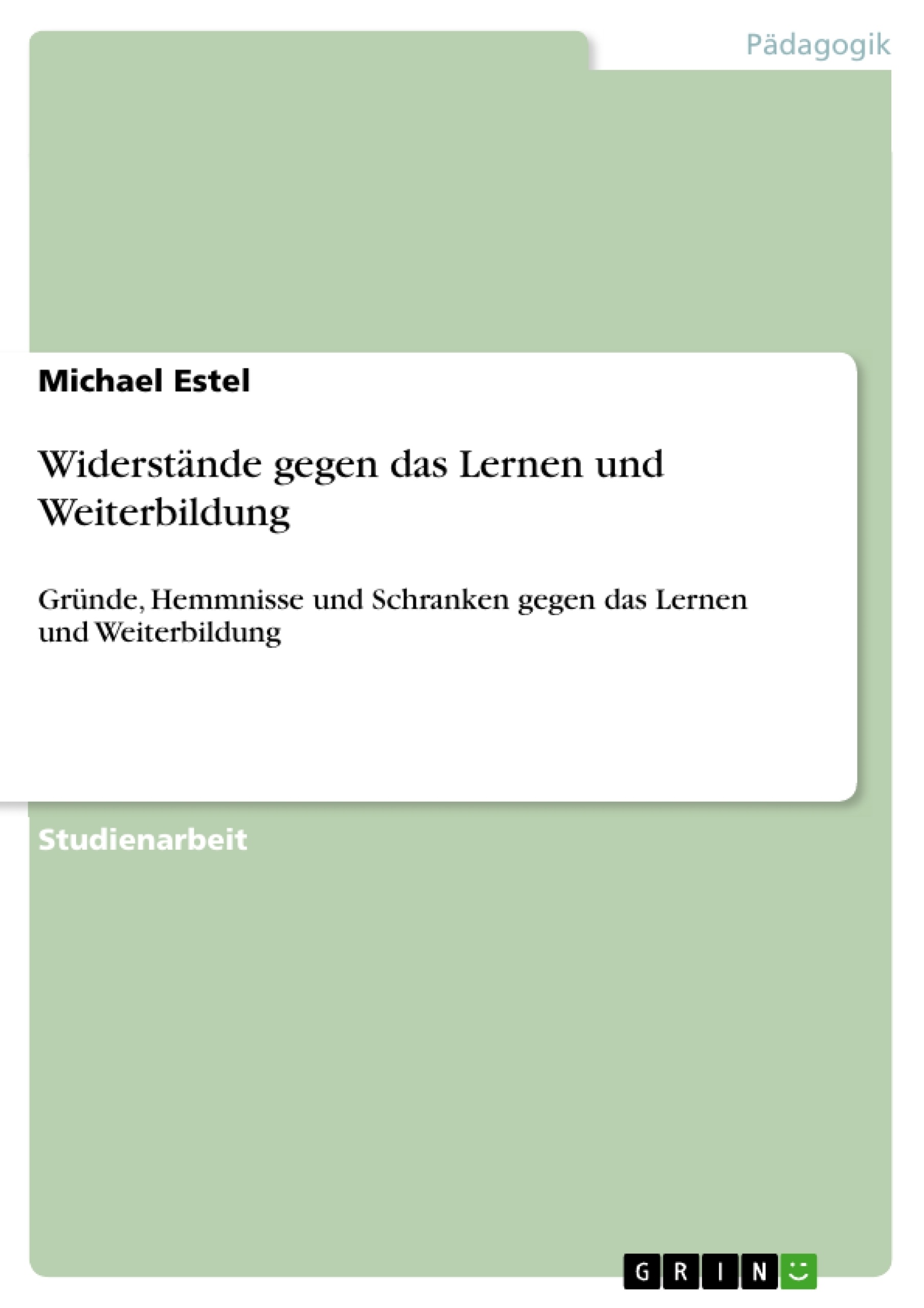„Lernen“ ist ein Begriff, der im alltäglichen Sprachgebrauch vielfältig benutzt werden kann. Man kann Fahrrad fahren lernen, eine Sprache lernen, jemanden kennenlernen. Nachvollziehbar ist deshalb auch die umfangreiche Beforschung des „Lernens“, sei es durch die Psychologie, Soziologie oder den Erziehungswissenschaften. Die Prozesse und Vorgänge beim Lernen, zum Beispiel im Gehirn, sind daher Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Eine unmittelbar mit diesem Thema verbundene, aber weit weniger diskutierte Thematik ist das Nicht-Lernen. Also Gründe, Hemmnisse, Barrieren, Schranken, Probleme und Schwierigkeiten die dazu führen, dass man nicht lernt oder sich weiterbildet. Denn leider ruft der Appell zum lebenslangen Lernen durchaus Vermeidungsreaktionen hervor (vgl. Siebert, 2011, S.105, Faulstich, 2006, S.7). Mit Bezug auf das „lebenslange Lernen“ soll sich „Lernen“ im Kontext dieser Hausarbeit speziell auf das Lernen Erwachsener beziehen, wobei damit insbesondere die Weiterbildung gemeint ist.
Diese Hausarbeit ist Teil der Lehrveranstaltung „Erwachsenenpädagogische Lernforschung“, in der einflussreiche Forschungsbeiträge zur Erwachsenenbildung dargestellt und bearbeitet wurden. Unter anderem wurde als eine Leitstudie die „Hannover Studie“ von Siebert und Gerl thematisiert, aber auch die Studie von Barz et al. über Milieus, bearbeitet. Jene Studien und weitere von Friebel und Gnahs über Institutionen und Bolder et al. zu Lernwiderständen bilden die Grundlage für die Bearbeitung der Thematik der Lernwiderstände. Es wird mit dieser Arbeit angestrebt zu klären, was Widerstände gegen das Lernen sind und wie diese entstehen.
Im ersten Schritt wird zunächst einmal der Begriff „Lernen“ an sich versucht zu definieren. Die theoretischen Grundlagen bilden die subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Holzkamp, neurobiologische und psychologische Theorien über das Lernen (Kapitel 1).
Bereits der erste Blick in die entsprechende Literatur eröffnet dem Leser die hohe Anzahl von Begriffen rund um die Widerstände gegen das Lernen. Ferner soll daher auch Ordnung in das Chaos der, mit dem Nicht-Lernen im Zusammenhang stehenden Begriffe gebracht werden (Kapitel 2). Holzer (2004) und Zeuner (2009) bieten mit ihren Werken die Möglichkeiten, die entsprechenden Studien zum Thema ausfindig zu machen und um Gründe, Hindernisse, Schranken usw. gegen das Lernen zu finden, um entsprechend zu intervenieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Lernen?
- Lernen aus biologischer Perspektive
- Lernen aus psychologischer Perspektive
- Lernen aus subjekttheoretischer Perspektive
- Ausblick
- Einordnung der Begriffe
- Ergebnisse der Forschung
- Axel Bolder, Ergebnisse und Perspektiven zu den „Gründen“
- Milieutypen, Forschung und Perspektiven zu den „Hemmnissen“
- Institutionsforschung und Perspektiven gegen „Schranken“
- Schluss
- Definition des Begriffs "Lernen" aus unterschiedlichen Perspektiven (biologisch, psychologisch, subjekttheoretisch)
- Analyse der Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Widerständen gegen das Lernen (Gründe, Hemmnisse, Barrieren, Schranken)
- Präsentation von Forschungsergebnissen zu Lernwiderständen, basierend auf Studien von Siebert und Gerl, Barz et al., Friebel und Gnahs, sowie Bolder et al.
- Einordnung der Thematik in den Kontext des lebenslangen Lernens, insbesondere der Erwachsenenbildung
- Suche nach Möglichkeiten, Lernwiderstände zu überwinden und die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten zu fördern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Widerständen gegen das Lernen und Weiterbildung. Ziel ist es, die Ursachen für diese Widerstände zu erforschen und zu klären, wie sie entstehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema "Widerstände gegen das Lernen und Weiterbildung" ein und unterstreicht die Bedeutung der Erforschung von Nicht-Lernen. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen für Lernwiderstände und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
Was ist Lernen?
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Lernen" aus neurobiologischer, psychologischer und subjekttheoretischer Perspektive. Es werden verschiedene Definitionen und Theorien zum Lernen präsentiert, die Rückschlüsse auf mögliche Ursachen für das Nicht-Lernen zulassen.
Einordnung der Begriffe
Dieses Kapitel befasst sich mit der Klärung und Systematisierung der Begriffe im Zusammenhang mit Lernwiderständen, wie z.B. Gründe, Hindernisse, Barrieren, Schranken. Es werden verschiedene Studien und Werke zur Analyse und Einordnung dieser Begriffe herangezogen.
Ergebnisse der Forschung
Dieses Kapitel stellt wichtige Forschungsergebnisse zu Lernwiderständen vor, die auf Studien von Bolder et al. (Gründe), Barz et al. (Hemmnisse), Friebel und Gnahs (Schranken) sowie Siebert und Gerl (Hannover Studie) basieren. Es werden die Erkenntnisse aus den verschiedenen Studien zusammengeführt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Lernwiderstände, Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Gründe, Hemmnisse, Barrieren, Schranken, neurobiologische Perspektive, psychologische Perspektive, subjekttheoretische Perspektive, Forschungsergebnisse, Interventionen, Handlungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Widerstände gegen das Lernen bei Erwachsenen?
Widerstände können sich als Hemmnisse, Barrieren oder Schranken äußern. Gründe sind oft negative Schulerfahrungen, Zeitmangel, fehlende Relevanz der Inhalte oder soziale Milieufaktoren.
Was ist die "Hannover Studie" von Siebert und Gerl?
Diese Leitstudie der erwachsenenpädagogischen Lernforschung untersuchte erstmals systematisch die Gründe für die Nicht-Teilnahme an Weiterbildungen und identifizierte verschiedene Typen von Lernwiderständen.
Wie erklärt die neurobiologische Perspektive das Nicht-Lernen?
Neurobiologisch gesehen kann Lernen verweigert werden, wenn das Gehirn neue Informationen als bedrohlich oder irrelevant einstuft. Emotionale Blockaden verhindern dann die neuronale Verknüpfung.
Welchen Einfluss hat das soziale Milieu auf die Weiterbildung?
Studien (z.B. Barz et al.) zeigen, dass die Bildungsnähe des Milieus maßgeblich bestimmt, ob Weiterbildung als Chance oder als Belastung wahrgenommen wird, was zu spezifischen "Milieu-Hemmnissen" führt.
Wie können Lernwiderstände überwunden werden?
Durch gezielte Interventionen, wie die Gestaltung niederschwelliger Angebote, die Berücksichtigung der subjektiven Lebenswelt der Lernenden und die Förderung der Selbstlernkompetenz.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Michael Estel (Author), 2011, Widerstände gegen das Lernen und Weiterbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190291