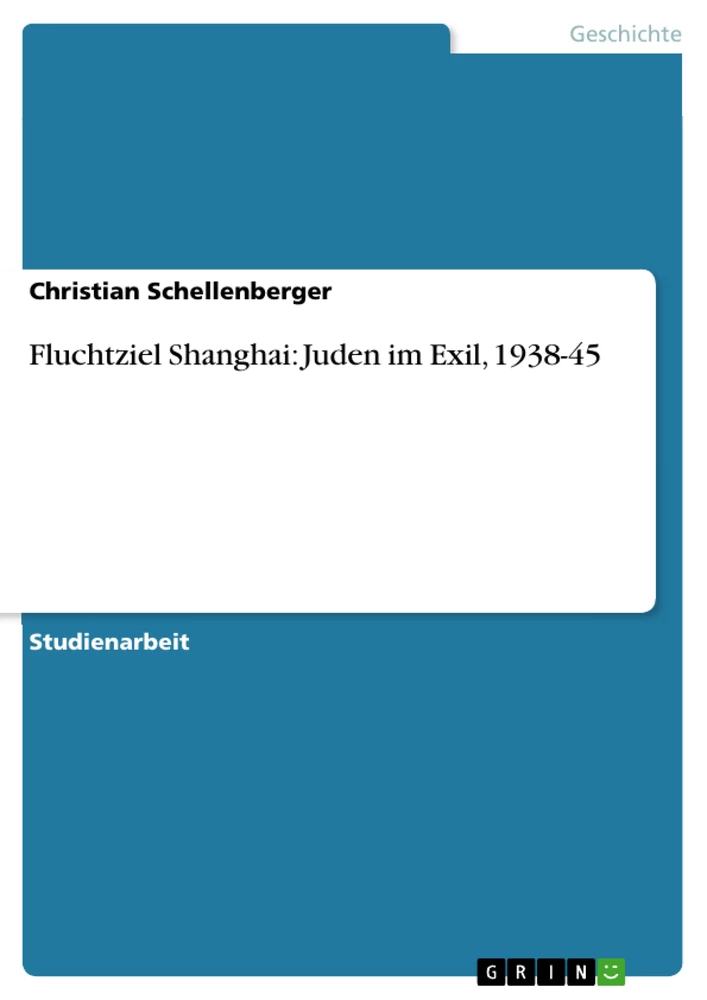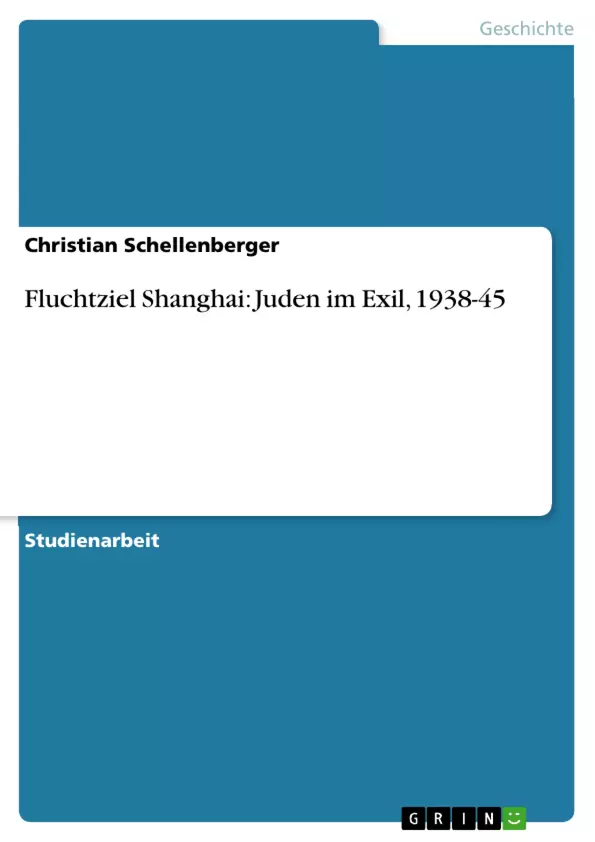Die Frage, warum gerade Shanghai als Zufluchtsort für Juden diente, hängt eng zusammen mit dem politischen Sonderstatus der Stadt. Darauf werde ich im Folgenden zunächst in gebotener Kürze eingehen. Weiterhin widme ich mich kurz den Umständen und dem Verlauf der Flucht nach Shanghai.
Der Hauptteil dieser Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Alltag deutscher und österreichischer Juden im Shanghaier Exil zwischen 1938 und 1945. Mit welchen Problemen hatten die Immigranten zu kämpfen? Unter welchen Umständen lebten die Einwanderer in Shanghai? Um diese Fragen zu beantworten, gehe ich auch darauf ein, wie sich das Verhältnis zwischen den neu eingewanderten Juden und den
alteingesessenen jüdischen Gemeinden entwickelte.
Erhielten die jüdischen Einwanderer Unterstützung und wie sah diese gegebenenfalls aus? Welche Probleme ergaben sich?
Außerdem soll in dieser Arbeit geklärt werden, wie die Lebensumstände nach dem Eintritt der japanischen Besatzungsmacht in den Zweiten Weltkrieg aussahen. Wie wirkte sich die Kontrolle der Stadt durch die Japaner auf den Alltag der jüdischen Flüchtlinge aus? Insbesondere werde ich hier auf die Errichtung des Ghettos im Bezirk Hongkew eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- POLITISCHER SONDERSTATUS SHANGHAIS
- FLUCHTWEGE UND FLUCHTUMSTÄNDE
- Verhältnis der jüdischen Emigranten zur Shanghaier Bevölkerung
- Lebensverhältnisse nach dem Eintritt Japans in den Zweiten Weltkrieg
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Schicksal von jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland und Österreich, die zwischen 1938 und 1945 in Shanghai Zuflucht suchten. Sie beleuchtet die Gründe für die Wahl Shanghais als Fluchtziel, die Fluchtwege und -umstände, den Alltag im Exil und die Herausforderungen, denen die Flüchtlinge im Angesicht der japanischen Besatzung und der Errichtung eines Ghettos begegneten.
- Der politische Sonderstatus Shanghais als exterritoriales Gebiet und die damit verbundene relative Sicherheit für jüdische Flüchtlinge
- Die schwierigen Fluchtwege und die unsicheren Lebensumstände der jüdischen Emigranten in Shanghai
- Die Integration der jüdischen Flüchtlinge in die Shanghaier Gesellschaft und die Beziehungen zu den bereits ansässigen jüdischen Gemeinden
- Die Auswirkungen der japanischen Besatzung auf den Alltag der jüdischen Flüchtlinge und die Errichtung des Ghettos in Hongkew
- Die Bedeutung von autobiographischen Berichten und Primärquellen für die Erforschung des Schicksals der jüdischen Emigranten in Shanghai
Zusammenfassung der Kapitel
1 EINLEITUNG
Die Einleitung stellt den Hintergrund der Flucht von jüdischen Flüchtlingen nach Shanghai vor und erläutert die Problematik der Wahl dieses Fluchtziels, das sich im Krieg befand. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit, der auf dem Alltag der jüdischen Emigranten zwischen 1938 und 1945 liegt, und benennt die zentralen Forschungsfragen.
2 POLITISCHER SONDERSTATUS SHANGHAIS
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen und politischen Hintergründe des Sonderstatus Shanghais als exterritoriales Gebiet und die damit verbundene relative Sicherheit für jüdische Flüchtlinge, die vor den Nationalsozialisten flohen.
3 FLUCHTWEGE UND FLUCHTUMSTÄNDE
Hier wird die Reise der jüdischen Flüchtlinge nach Shanghai im Zeitraum von 1938 bis 1939 dargestellt. Die schwierigen Fluchtbedingungen und die Unsicherheit über die Zukunft der Emigranten in einem fremden Land werden beleuchtet.
4 ALLTAG IM EXIL
Dieses Kapitel befasst sich mit den Lebensumständen der jüdischen Flüchtlinge in Shanghai, ihrem Verhältnis zur Shanghaier Bevölkerung und den Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren. Es wird auch auf die Entwicklungen nach dem Einmarsch der japanischen Truppen und der Errichtung eines Ghettos im Bezirk Hongkew eingegangen.
Schlüsselwörter
Jüdische Emigration, Shanghai, Exil, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Japanische Besatzung, Ghetto, Hongkew, Primärquellen, Autobiographische Berichte, Lebensbedingungen, Integration, Interkulturelle Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Shanghai zwischen 1938 und 1945 ein Fluchtziel für Juden?
Shanghai besaß einen politischen Sonderstatus als exterritoriales Gebiet. Es war einer der wenigen Orte weltweit, für den man kein Visum zur Einreise benötigte, was es für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich erreichbar machte.
Wie war der Alltag für jüdische Flüchtlinge in Shanghai?
Der Alltag war von schwierigen Lebensbedingungen, Armut und der Anpassung an eine völlig fremde Kultur geprägt. Die Flüchtlinge mussten sich in einer Stadt behaupten, die selbst vom Krieg gezeichnet war.
Was änderte sich durch die japanische Besatzung?
Nach dem Eintritt Japans in den Zweiten Weltkrieg verschlechterten sich die Bedingungen drastisch. 1943 ordneten die Japaner die Errichtung eines "Designated Area" (Ghetto) im Bezirk Hongkew an, in dem die Flüchtlinge unter beengten Verhältnissen leben mussten.
Wo genau befand sich das Ghetto für jüdische Flüchtlinge?
Das Ghetto befand sich im Shanghaier Bezirk Hongkew. Dort wurden staatenlose Flüchtlinge, die nach 1937 eingetroffen waren, zwangsweise angesiedelt.
Gab es Unterstützung durch bereits ansässige jüdische Gemeinden?
Ja, es gab bereits etablierte jüdische Gemeinden in Shanghai (z.B. sephardische Juden), die versuchten, den neu ankommenden Flüchtlingen mit Hilfsprogrammen und Unterkünften beizustehen.
Welche Quellen wurden zur Erforschung dieses Themas genutzt?
Die Forschung stützt sich maßgeblich auf autobiographische Berichte, Zeitzeugenaussagen und Primärquellen aus der Zeit zwischen 1938 und 1945.
- Arbeit zitieren
- Christian Schellenberger (Autor:in), 2010, Fluchtziel Shanghai: Juden im Exil, 1938-45, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190304