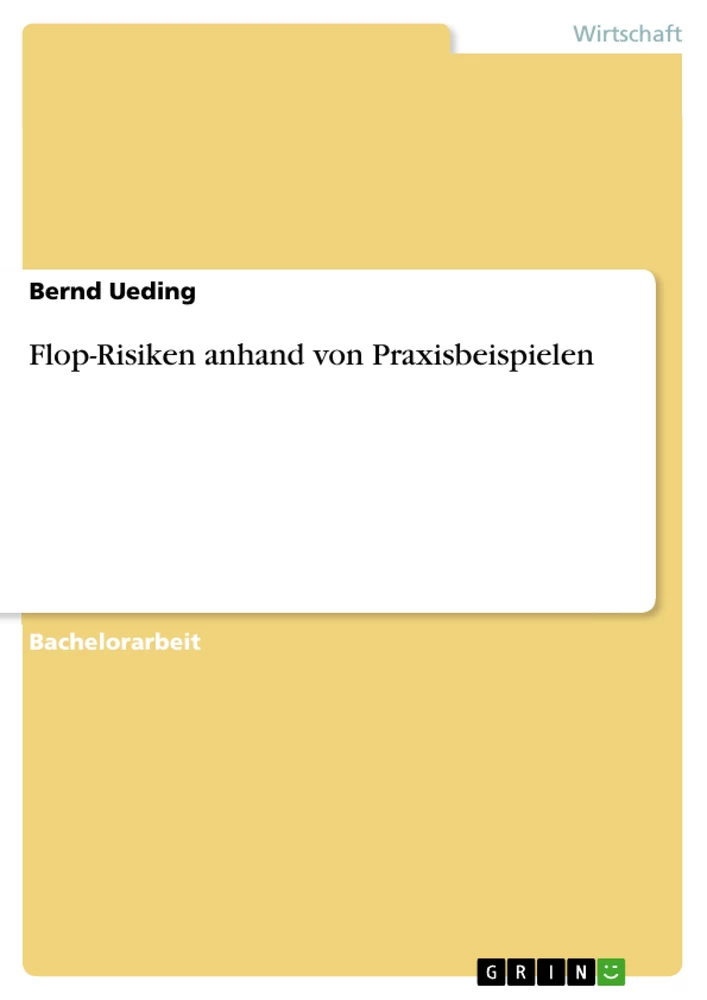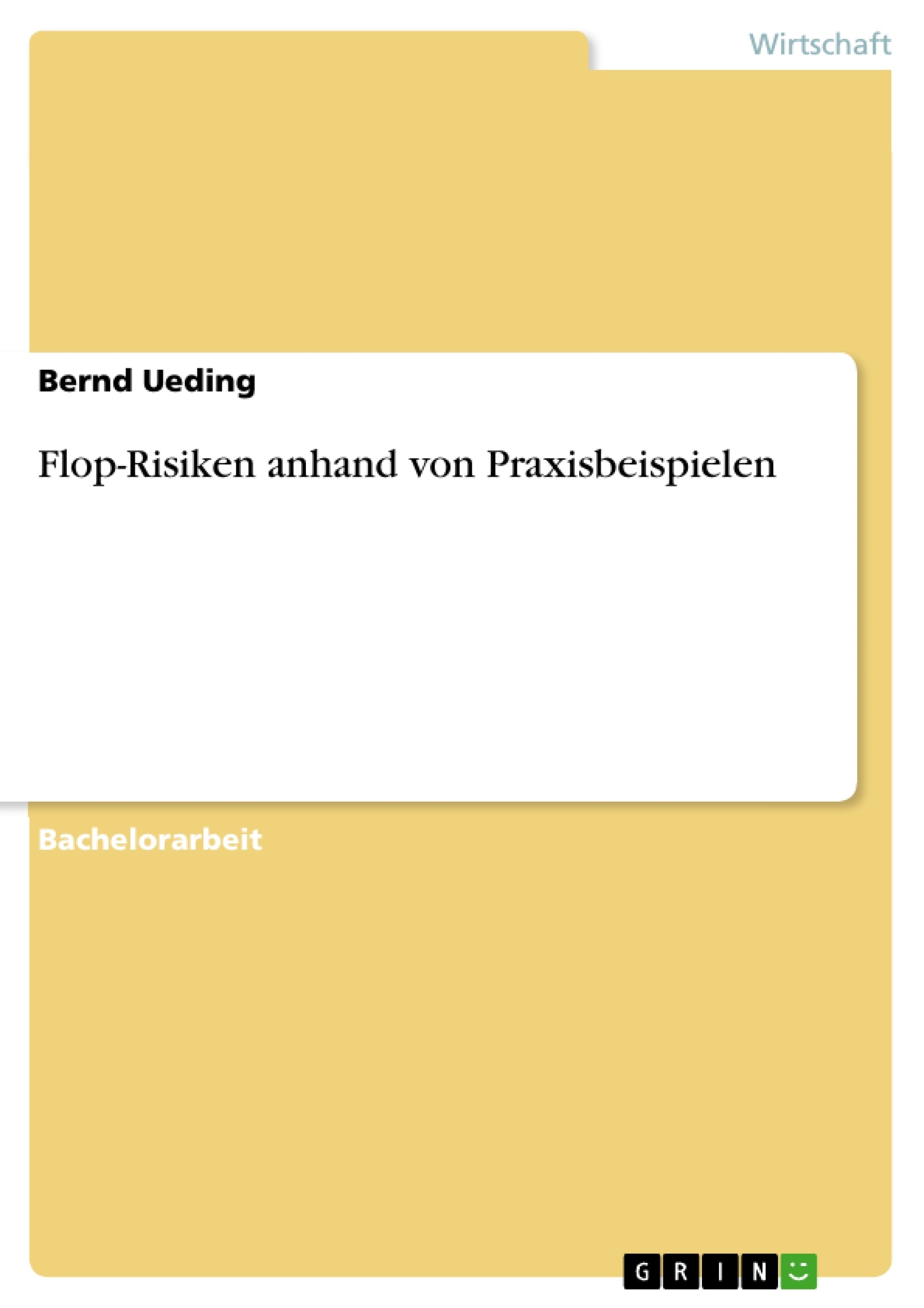Im Jahr 2010 wurden weltweit rund 78 Mio. Kraftfahrzeuge produziert. Die Gesamtproduktion von Kraftfahrzeugen in Deutschland belief sich auf fast 6 Mio. Einheiten. Damit beträgt der Anteil der Automobilindustrie am Gesamtumsatz der Industrie in Deutschland etwa 21%. Circa 750.000 Personen sind derzeit direkt in der Automobilbranche beschäftigt. Insgesamt betrachtet hängen sogar rund 5,3 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland in irgendeiner Form vom Automobil ab.
Diese Zahlen belegen die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilindustrie und damit wird klar, dass unternehmerische Fehlentscheidungen in diesem Industriezweig weitreichende Folgen haben können. Vor allem die Möglichkeit, die Flop-Risiken in der Automobilindustrie sehr praxisnah untersuchen zu können, brachte mich zu der Wahl dieses Themas für meine Bachelor-Thesis.
Branchenübergreifend floppen zwischen 60 und 80% aller Produktneueinführungen. Durch verkürzte Produktlebenszyklen steigt der Innovationsdruck, was zu einem hohen Kostenaufwand führt. Daher können Flops nicht nur zu Imageproblemen für die Herstellermarke führen (Vgl. Kapitel 4.2); sie können auch gravierende wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen (Vgl. Kapitel 4.1). Im schlimmsten Fall können Sie für ein Unternehmen sogar existenzbedrohend werden.
Ziel dieser Arbeit ist daher die systematische Analyse möglicher Flop-Ursachen in der Automobilindustrie, um letztendlich Handlungsempfehlungen abzuleiten, die das Flop-Risiko senken können. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das Kapitel 5, in dem 15 ausgewählte Flops der Automobilindustrie detailliert untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung
- 1.2 Allgemeine Vorgehensweise im Rahmen der Untersuchung
- 2. Begriffliche Grundlagen und theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Produktpolitik
- 2.1.1 Begriff der Produktpolitik
- 2.1.2 Bedeutung der Produktpolitik
- 2.2 Definition, „Flop“
- 2.3 Einführungen neuer Modelle in den Automobilmarkt
- 2.3.1 Produktinnovation
- 2.3.2 Produktvariation
- 2.3.3 Produktproliferation
- 2.3.3.1 Sortimentserweiterung
- 2.3.3.2 Produktdifferenzierung
- 3. Flop-Ursachen
- 3.1 Überschätzung des Marktpotenzials
- 3.2 Mangelnder Kundenmehrwert
- 3.3 Keine ausreichende Wettbewerbsdifferenzierung
- 3.4 Fehlender Marken-Fit
- 3.5 Zu anspruchsvolle Preispositionierung
- 4. Mögliche Folgen von Flops für den Hersteller
- 4.1 Wirtschaftliche Schäden
- 4.1.1 Kosten und Dauer der Entwicklung eines neuen Fahrzeugs
- 4.1.2 VW Phaeton
- 4.1.3 Audi A2
- 4.1.4 Chrysler Crossfire
- 4.1.5 Renault Avantime
- 4.2 Imageprobleme
- 4.2.1 Fiat Multipla
- 4.2.2 Jaguar X-Type
- 4.2.3 Opel Antara
- 5. Praxisbeispiele aus der Automobilindustrie
- 5.1 BMW Z3 Coupé
- 5.2 Chrysler Crossfire
- 5.3 Fiat Multipla
- 5.4 Jaguar X-Type
- 5.5 Opel Antara
- 5.6 Opel GT
- 5.7 Opel Speedster
- 5.8 Peugeot 607
- 5.9 Peugeot 1007
- 5.10 Renault Vel Satis
- 5.11 Toyota IQ
- 5.12 VW Fox
- 5.13 VW Lupo
- 5.14 VW Passat CC
- 5.15 VW Scirocco
- 5.16 Weitere Flops der letzten 10-20 Jahre summarisch
- 6. Handlungsempfehlungen um Flop-Risiken zu senken
- 6.1 Prognose zur Entwicklung des Flop-Risikos in der Automobilindustrie
- 6.2 Management von Flop-Risiken
- 6.2.1 Produktpositionierung
- 6.2.2 Beachtung und Prognose externer Einflussfaktoren
- 6.2.3 Senkung der Forschungs- und Entwicklungskosten
- 6.2.4 Konzentration auf das angestammte Segment
- 6.2.5 Risiko-Profile zur Identifikation erfolgskritischer Faktoren
- 6.2.6 Konzepttest
- 6.2.7 Produkttest
- 6.2.8 Tool-Kits
- 6.2.9 Anwendung von Scoring-Modellen
- 6.2.10 Quality Function Deployment
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Flops in der Automobilindustrie und hat zum Ziel, die Ursachen und Folgen solcher Markterfolge zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen, um Flop-Risiken zu minimieren.
- Definition und Ursachen von Flops in der Automobilindustrie
- Analyse von Praxisbeispielen aus der Automobilindustrie
- Mögliche Folgen von Flops für den Hersteller
- Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Flop-Risiken
- Prognose der Entwicklung des Flop-Risikos in der Automobilindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Vorgehensweise bei der Untersuchung.
- Kapitel 2: Begriffliche Grundlagen und theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie Produktpolitik und „Flop“. Es beleuchtet den Kontext der Produktentwicklung und Einführung neuer Modelle in den Automobilmarkt.
- Kapitel 3: Flop-Ursachen: Hier werden verschiedene Ursachen für Flops in der Automobilindustrie untersucht, wie z. B. die Überschätzung des Marktpotenzials oder mangelnder Kundenmehrwert.
- Kapitel 4: Mögliche Folgen von Flops für den Hersteller: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Schäden und Imageprobleme, die durch Flops entstehen können.
- Kapitel 5: Praxisbeispiele aus der Automobilindustrie: In diesem Kapitel werden konkrete Beispiele für Flops in der Automobilindustrie analysiert und deren Ursachen und Folgen untersucht.
- Kapitel 6: Handlungsempfehlungen um Flop-Risiken zu senken: Dieses Kapitel bietet Handlungsempfehlungen, wie Flop-Risiken in der Automobilindustrie minimiert werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Flop-Risiken, Automobilindustrie, Produktpolitik, Marktpotenzial, Kundenmehrwert, Wettbewerbsdifferenzierung, Marken-Fit, Imageprobleme, Handlungsempfehlungen, Management von Flop-Risiken, Konzepttest, Produkttest, Scoring-Modelle, Quality Function Deployment.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist das Flop-Risiko bei Produktneueinführungen?
Branchenübergreifend scheitern zwischen 60 und 80 % aller neuen Produkte am Markt.
Was sind typische Ursachen für einen Flop in der Automobilindustrie?
Häufige Ursachen sind die Überschätzung des Marktpotenzials, mangelnder Kundenmehrwert, fehlender Marken-Fit oder eine zu teure Preispositionierung.
Welche wirtschaftlichen Folgen haben Fehlentscheidungen für Autohersteller?
Neben hohen Entwicklungskosten können Flops zu massiven Imageproblemen führen und im Extremfall die Existenz des Unternehmens bedrohen.
Welche Automodelle gelten als bekannte Praxisbeispiele für Flops?
In der Analyse werden unter anderem der VW Phaeton, Audi A2, Fiat Multipla und der Renault Avantime als Beispiele untersucht.
Wie kann das Flop-Risiko gesenkt werden?
Empfohlen werden Maßnahmen wie Konzept- und Produkttests, Scoring-Modelle sowie das Quality Function Deployment (QFD) zur besseren Marktanpassung.
- Citar trabajo
- Bernd Ueding (Autor), 2012, Flop-Risiken anhand von Praxisbeispielen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190392