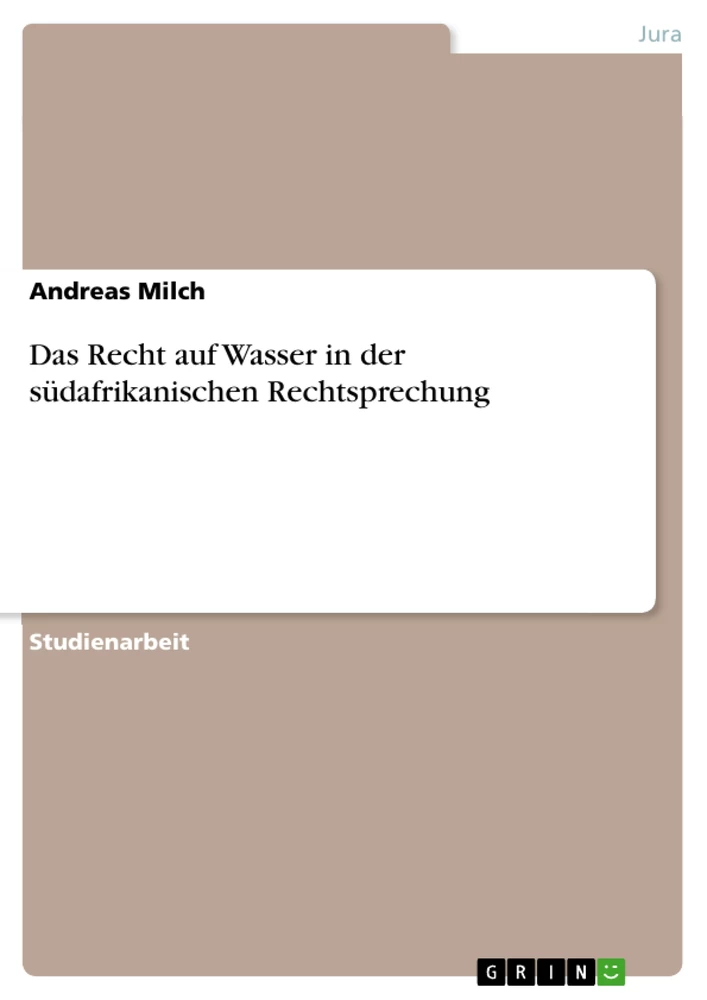A. Einleitung
Mit meiner vorliegenden Seminarhausarbeit möchte ich das Recht auf Wasser in der
Südafrikanischen Rechtssprechung darstellen. Hierbei werde ich nach einer kurzen
Darstellung der globalen Wasserkrise, zunächst die internationale juristische Grundlage für
das Recht auf Wasser erörtern und die Verpflichtungen der Staaten durch das Recht auf
Wasser darlegen.
In diesem Kontext werde ich kurz das durch Privatisierung der
Wasserversorgung entstandenen Billionengeschäft mit dem Wasser thematisieren, ehe ich das
Wasserproblem, die Kommerzialisierung und den Widerstand in Südafrika anspreche, um
anschließend die Regelungen in der Verfassung Südafrikas, deren Entwicklung und die
Ausgestaltung des Rechtsschutz darzustellen.
Beginnend beim Verfassungsgebungsprozess, werde ich darauffolgend den
Grundrechtskatalog - die Bill of Rights – und ihre Entstehung, insbesondere in Bezug auf die
Sozio-ökonomischen Zugangsrechte aus Art. 26 und 27 endgV, erläutern. Weiterführend
werde ich auf die Grundrechtsschranken, deren Bestimmungen, sowie verfassungsimmanente
Schranken eingehen und hier den Gesetzesbegriff des Art. 36 (1) endgV darstellen.
Nachfolgend skizziere ich noch den „National Water Act“, sowie den „Water Service Act“,
ehe ich das südafrikanische Gerichtssystem veranschauliche, um anschließend die gerichtliche
Überprüfbarkeit sozio-ökonomischer Zugangsrechte in Frage zu stellen und anhand aktueller
Rechtssprechung und Rechtsfindung am Beispiel von vier äußerst aktuellen und brisanten
Fällen, in meinem abschließenden Resümee und Ausblick zu einem Ergebnis komme.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- 1. Die globale Wasserkrise – Tägliche Verletzung des Rechts auf Wasser
- 2. Die juristische Grundlage für das Recht auf Wasser
- 3. Inhalt des Rechts auf Wasser
- 4. Verpflichtung der Staaten durch das Recht auf Wasser
- 5. Privatisierung, das Billionengeschäft mit dem Wasser
- 6. Wasser die Realität in Südafrika:
- Wasserknappheit und das Erbe der Apartheid
- Kommerzialisierung und Widerstand
- B. Regelung in der Verfassung Südafrikas & Ausgestaltung des Rechtsschutzes
- 1. Die Verfassungsgebung
- a. Interimsverfassung
- b. Die neue Verfassung Südafrikas
- 2. Bill of Rights
- a. Entstehung
- b. Sozio-Ökonomische Zugangsrechte (Art. 26 u. 27 endgV)
- 3. Drittwirkung
- 4. Grundrechtsschranken
- a. Schrankenbestimmungen
- b. Verfassungsimmanente Schranken
- c. Der Gesetzesbegriff i.S. des Art. 36 (1) endgV
- 5. National Water Act
- 6. Water Service Act 108 of 1997
- 7. Gerichtliche Überprüfbarkeit sozio-ökonomischer Zugangsrechte
- 1. Die Verfassungsgebung
- C. Aktuelle Rechtssprechung & Rechtsfindung in Südafrika
- 1. Das Gerichtssystem in Südafrika
- 2. Aktuelle Rechtssprechung und Rechtsfindung
- A.) 1. Fall: Government of the Republic of South Africa and others v Grootboom and others
- B.) 2. Fall: Manquele v Durban Transitional Metropolitian Council
- C.) 3. Fall: Bon Vista Mansions Case
- D.) 4. Fall: Prepaid Meters
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Recht auf Wasser in der südafrikanischen Rechtssprechung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der rechtlichen Grundlage des Rechts auf Wasser, seiner Ausgestaltung in der Verfassung Südafrikas und der konkreten Anwendung in der aktuellen Rechtsprechung. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der globalen Wasserkrise ergeben, und wie die südafrikanische Rechtssprechung auf diese Herausforderungen reagiert.
- Das Recht auf Wasser als Menschenrecht
- Die Rolle der Verfassung Südafrikas bei der Sicherung des Zugangs zu Wasser
- Die Herausforderungen der Wasserknappheit und des Erbes der Apartheid
- Die Rolle der Gerichte bei der Durchsetzung des Rechts auf Wasser
- Die Bedeutung von sozio-ökonomischen Zugangsrechten im Kontext des Rechts auf Wasser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Schwerpunkt auf die globale Wasserkrise und ihre Auswirkungen, insbesondere in Südafrika. Sie beleuchtet die juristische Grundlage des Rechts auf Wasser und seine Bedeutung im internationalen Recht. Kapitel B analysiert die Regulierung des Zugangs zu Wasser in der Verfassung Südafrikas, einschließlich der Bill of Rights und der relevanten Gesetze. Kapitel C befasst sich mit der aktuellen Rechtssprechung in Südafrika und analysiert verschiedene Fälle, die sich mit dem Recht auf Wasser befassen.
Schlüsselwörter
Recht auf Wasser, Südafrika, Verfassung, Rechtssprechung, Wasserkrise, Wasserknappheit, Apartheid, Bill of Rights, sozio-ökonomische Zugangsrechte, Privatisierung, Kommerzialisierung, Gerichtliche Überprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Zugang zu Wasser in Südafrika ein Grundrecht?
Ja, die südafrikanische Verfassung garantiert in der Bill of Rights (Art. 27) das Recht auf Zugang zu ausreichend Wasser als sozio-ökonomisches Grundrecht.
Wie beeinflusst das Erbe der Apartheid die Wasserversorgung?
Die historische Ungleichverteilung von Ressourcen führt bis heute dazu, dass viele ehemals benachteiligte Bevölkerungsgruppen keinen adäquaten Zugang zu Wasserinfrastruktur haben.
Was sind die wichtigsten Wassergesetze in Südafrika?
Zentral sind der "National Water Act" und der "Water Service Act" von 1997, die die Bewirtschaftung und den Zugang zu Wasser regeln.
Welche Rolle spielen südafrikanische Gerichte beim Recht auf Wasser?
Gerichte wie das Verfassungsgericht prüfen die staatlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Rechts auf Wasser, wie in wegweisenden Fällen wie "Grootboom" oder "Prepaid Meters".
Was ist die Problematik von Prepaid-Wasserzählern?
Prepaid-Zähler führen oft dazu, dass die ärmste Bevölkerung bei Geldmangel vom Wasser abgeschnitten wird, was Fragen zur Verfassungsmäßigkeit dieser Kommerzialisierung aufwirft.
- Quote paper
- Andreas Milch (Author), 2009, Das Recht auf Wasser in der südafrikanischen Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190422