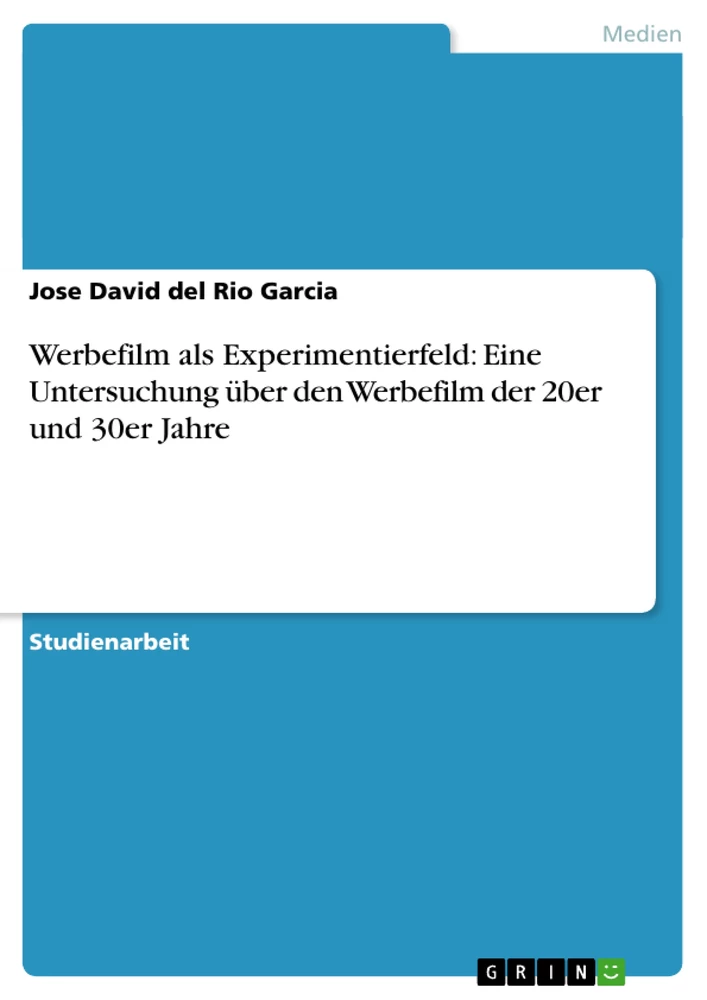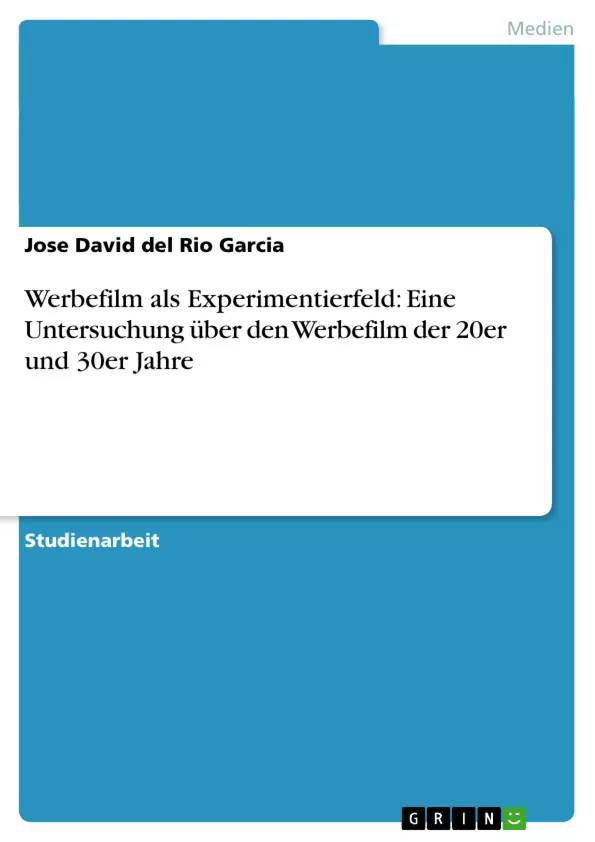In der vorliegenden Hausarbeit liegt der Schwerpunkt darin, die
Werbefilmentwicklung sowohl von ihrer technischen als auch von ihrer
inhaltlich-ästhetischen Seite zu behandeln. Hauptaugenmerk dieses
Beitrages soll die nähere Verfolgung der Beziehung zwischen Technik
und Kunst in einem beschränkten Zeitraum und in einer bestimmten
Filmbranche sein: Der Werbefilm. Welche Merkmale haben die
Erscheinung Werbefilm charakterisiert? War es eine verkaufsfördernde
Maßnahme oder bedeutete er vielmehr eine Plattform, den
Ideenreichtum neuer und altbewährter Künstler zu verwerten?
Bestimmten die technischen Errungenschaften das Erscheinungstempo
der inhaltlich-ästhetischen Impulse? Welche Synergiekräfte
ermöglichten diese produktive Zusammenarbeit? Unter welchen
Bedingungen führte diese gemeinsame Arbeit zum Erfolg?.
Im chronologischen Hausarbeitsaufbau wird diesen Leitfragen
nachgegangen mit der Absicht, dem Leser die zum Teil verkannte
Erfolgsgeschichte dieses Filmmetiers zu zeigen. Das Subgenre
Werbefilm wechselte im Laufe der Zeit drastisch seine Rolle von
Begleiterscheinung der Filmindustrie wurde es später als
Propagandafilm zu Kriegszwecken missbraucht und in seinem Zenit
war es als unerlässlichen Experimentierkasten, wo die innovativsten
Ideen ausprobiert werden konnten. Anhand dieser Tatsache soll die
Hausarbeit herausfinden, welcher Bezug zwischen technischem
Fortschritt und ästhetischem Impuls besteht und welchen Stellenwert
der Werbefilm zur damaligen Zeit in der Filmindustrie besaß.
Die Literaturrecherche in bezug auf den Werbefilm war stetig mit
Schwierigkeiten behaftet. Es ist folgerichtig so, dass diesem Subgenre
bis Dato von der Wissenschaft wenig Beachtung geschenkt wurde. Die
einzige Herausgabe einer Monographie, welche sich dem Werbefilm
auf inhaltlich-ästhetischer Ebene vollständig widmete, liegt bereits
zwanzig Jahre zurück. Beachtenswert waren die Literaturquellen,
welche zu Anfertigung dieser Hausarbeit herangezogen wurden. Diese
stammten hauptsächlich aus der Dekade der 20er und Anfang der 30er
Jahre. Sie beruhten meistens auf Meinungen oder Kommentaren der
Autoren, ohne dass sie einen methodologischen-wissenschaftlichen
Anspruch hatten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte des Werbefilms 1887 bis 1918
- Genesis des Werbefilms: Die Vorreiter und die Anwendungsgebiete
- Der Werbefilm und die Experimentierfreudigkeit seiner Betreiber
- Die Avantgarde: Technik und Kunst
- Der Avantgardebegriff: Ein kleiner Exkurs
- Neue Formen und Techniken im abstrakten/absoluten Werbefilm
- Die ästhetischen Bausteine des Avantgardefilms
- Montage als stilbildendes Element
- Der Rhythmus als neues stilbildendes Element der Avantgardisten
- Beziehung zwischen Spiel- und Werbefilmindustrie: Geschichte einer Symbiose
- Auswirkung des Werbefilms
- Die Avantgarde: Technik und Kunst
- Hochphase innovativer Tendenzen im Werbefilm (1928-1939)
- Der Film lernt zu sprechen: Die ersten Tonfilme
- Die ersten Farbfilme: Werbefarbfilme
- Werbefilme: Ein Tribut an Oskar Fischinger
- Eine Periode neigt sich dem Ende zu: Der Werbefilm bis das Nazi-Regime
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Werbefilms der 1920er und 1930er Jahre, sowohl unter technischen als auch unter inhaltlich-ästhetischen Aspekten. Im Fokus steht die Beziehung zwischen technischem Fortschritt und künstlerischer Gestaltung innerhalb dieser spezifischen Filmbranche. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Werbefilms als Experimentierfeld und untersucht die Synergien zwischen technischer Innovation und kreativen Impulsen.
- Der Werbefilm als Experimentierfeld für neue Technologien und künstlerische Ausdrucksformen.
- Die Beziehung zwischen technischem Fortschritt und ästhetischen Entwicklungen im Werbefilm.
- Die Rolle des Werbefilms im Kontext der Spielfilmindustrie.
- Die Auswirkung des Werbefilms auf die Gesellschaft und die Werbebranche.
- Die Schwierigkeiten der Literaturrecherche im Bereich des Werbefilms.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit: die Untersuchung der Entwicklung des Werbefilms der 20er und 30er Jahre unter technischen und ästhetischen Gesichtspunkten. Es wird die Frage nach dem Verhältnis von Technik und Kunst im Werbefilm gestellt, sowie die Rolle des Werbefilms als verkaufsfördernde Maßnahme und Plattform für künstlerische Ideen. Die Einleitung benennt die zentralen Forschungsfragen und den chronologischen Aufbau der Arbeit, der die Entwicklung des Werbefilms von einer Begleiterscheinung der Filmindustrie hin zu einem wichtigen Experimentierfeld darstellt. Die Schwierigkeiten der Literaturrecherche werden angesprochen, insbesondere der Mangel an wissenschaftlicher Literatur zu diesem Thema.
Vorgeschichte des Werbefilms: Der Werbefilm von 1887 bis 1918: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anfängen des Werbefilms, beginnend mit den ersten Werbefilmen der Gebrüder Lumière. Es werden die technischen Innovationen und ästhetischen Ansätze der frühen Werbefilme beleuchtet, und die Vorreiter der Werbefilmindustrie in Frankreich (Lumière, Méliès) und Deutschland (Messter) werden vorgestellt. Das Kapitel analysiert die frühen Anwendungsgebiete des Werbefilms und zeigt auf, wie schon damals Prinzipien der modernen Werbung, wie die Gegenüberstellung von "früher" und "heute", eingesetzt wurden. Die unterschiedlichen Herangehensweisen von Lumière (Realitätswiedergabe) und Méliès (Realitätsveränderung) werden kontrastiert.
Der Werbefilm und die Experimentierfreudigkeit seiner Betreiber: Dieses Kapitel untersucht die Experimentierfreudigkeit im Werbefilm der 20er und 30er Jahre, insbesondere im Kontext der Avantgarde. Es werden neue Formen und Techniken, wie Montage und Rhythmus, als stilbildende Elemente analysiert. Der Begriff der Avantgarde wird erläutert und seine Bedeutung für den Werbefilm der Zeit herausgearbeitet. Das Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Spielfilm- und Werbefilmindustrie, untersucht die Symbiose zwischen beiden und deren gegenseitige Beeinflussung. Schliesslich werden die Auswirkungen des Werbefilms auf die Filmindustrie und die Gesellschaft im Allgemeinen diskutiert.
Hochphase innovativer Tendenzen im Werbefilm (1928-1939): Dieses Kapitel befasst sich mit der Hochphase innovativer Tendenzen im Werbefilm, die mit der Einführung des Tonfilms und des Farbfilms einherging. Die Bedeutung dieser technischen Fortschritte für die Gestaltung von Werbefilmen wird analysiert, ebenso wie der Einfluss von Künstlern wie Oskar Fischinger. Das Kapitel beschreibt die Entwicklung des Werbefilms bis zum Beginn des Nazi-Regimes und deutet den bevorstehenden Wandel an, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.
Schlüsselwörter
Werbefilm, 1920er Jahre, 1930er Jahre, Avantgarde, Technik, Kunst, Montage, Rhythmus, Tonfilm, Farbfilm, Oskar Fischinger, Spielfilmindustrie, Werbung, Ästhetik.
FAQ: Entwicklung des Werbefilms der 1920er und 1930er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Werbefilms in den 1920er und 1930er Jahren. Der Fokus liegt auf den technischen und inhaltlich-ästhetischen Aspekten, insbesondere der Beziehung zwischen technischem Fortschritt und künstlerischer Gestaltung in dieser Filmbranche. Die Rolle des Werbefilms als Experimentierfeld und die Synergien zwischen technischer Innovation und kreativen Impulsen werden beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Werbefilm als Experimentierfeld für neue Technologien und künstlerische Ausdrucksformen, die Beziehung zwischen technischem Fortschritt und ästhetischen Entwicklungen, die Rolle des Werbefilms im Kontext der Spielfilmindustrie, seine Auswirkungen auf Gesellschaft und Werbebranche sowie die Schwierigkeiten der Literaturrecherche zu diesem Thema.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung des Werbefilms in den 1920er und 1930er Jahren, beleuchtet aber auch die Vorgeschichte bis 1918.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Vorgeschichte des Werbefilms (1887-1918), zum Werbefilm als Experimentierfeld der 1920er und 1930er Jahre, zur Hochphase innovativer Tendenzen (1928-1939) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Entwicklung, wie z.B. die Einführung von Ton- und Farbfilm.
Welche Aspekte der Vorgeschichte des Werbefilms werden behandelt?
Die Vorgeschichte behandelt die Anfänge des Werbefilms, beginnend mit den Gebrüdern Lumière. Es werden die technischen Innovationen und ästhetischen Ansätze der frühen Werbefilme beleuchtet, die Vorreiter der Werbefilmindustrie vorgestellt (Lumière, Méliès, Messter) und die frühen Anwendungsgebiete analysiert. Die unterschiedlichen Herangehensweisen von Lumière (Realitätswiedergabe) und Méliès (Realitätsveränderung) werden kontrastiert.
Welche Rolle spielte die Avantgarde im Werbefilm?
Die Arbeit untersucht die Experimentierfreudigkeit im Werbefilm der 20er und 30er Jahre im Kontext der Avantgarde. Neue Formen und Techniken wie Montage und Rhythmus als stilbildende Elemente werden analysiert. Die Bedeutung der Avantgarde für den Werbefilm und die Beziehung zwischen Spielfilm- und Werbefilmindustrie werden beleuchtet.
Welche technischen Entwicklungen hatten einen Einfluss auf den Werbefilm?
Die Einführung des Tonfilms und des Farbfilms in den 1920er und 1930er Jahren wird als bedeutender Einfluss auf die Gestaltung von Werbefilmen analysiert. Die Arbeit erwähnt auch den Einfluss von Künstlern wie Oskar Fischinger.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werbefilm, 1920er Jahre, 1930er Jahre, Avantgarde, Technik, Kunst, Montage, Rhythmus, Tonfilm, Farbfilm, Oskar Fischinger, Spielfilmindustrie, Werbung, Ästhetik.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Literaturrecherche?
Die Arbeit erwähnt explizit die Schwierigkeiten der Literaturrecherche im Bereich des Werbefilms und den Mangel an wissenschaftlicher Literatur zu diesem Thema.
- Citar trabajo
- Jose David del Rio Garcia (Autor), 2003, Werbefilm als Experimentierfeld: Eine Untersuchung über den Werbefilm der 20er und 30er Jahre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19047