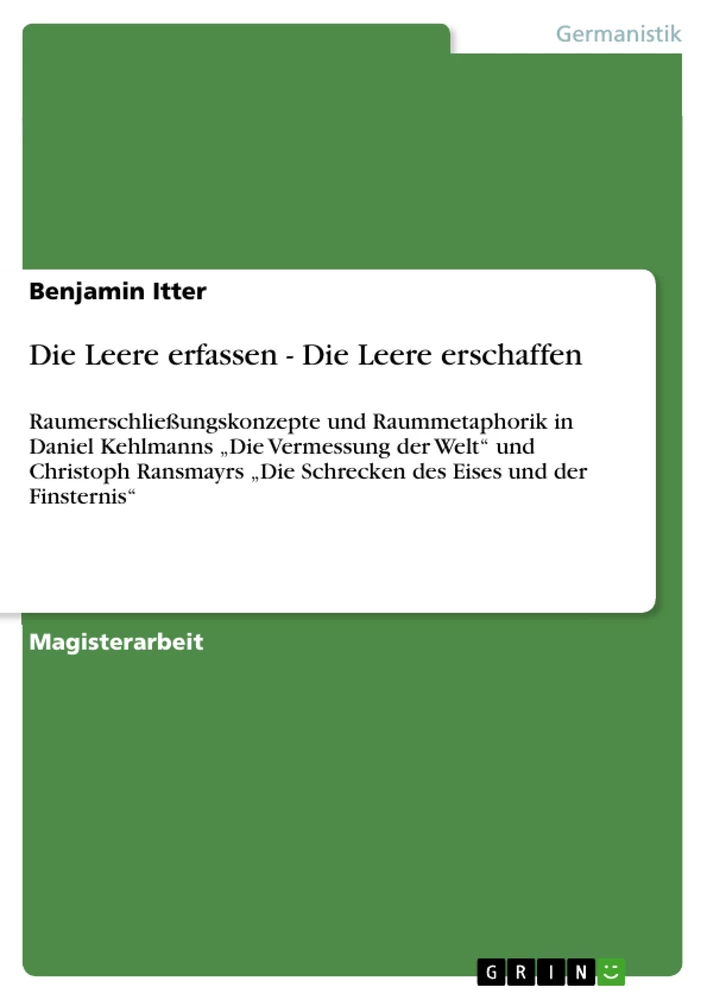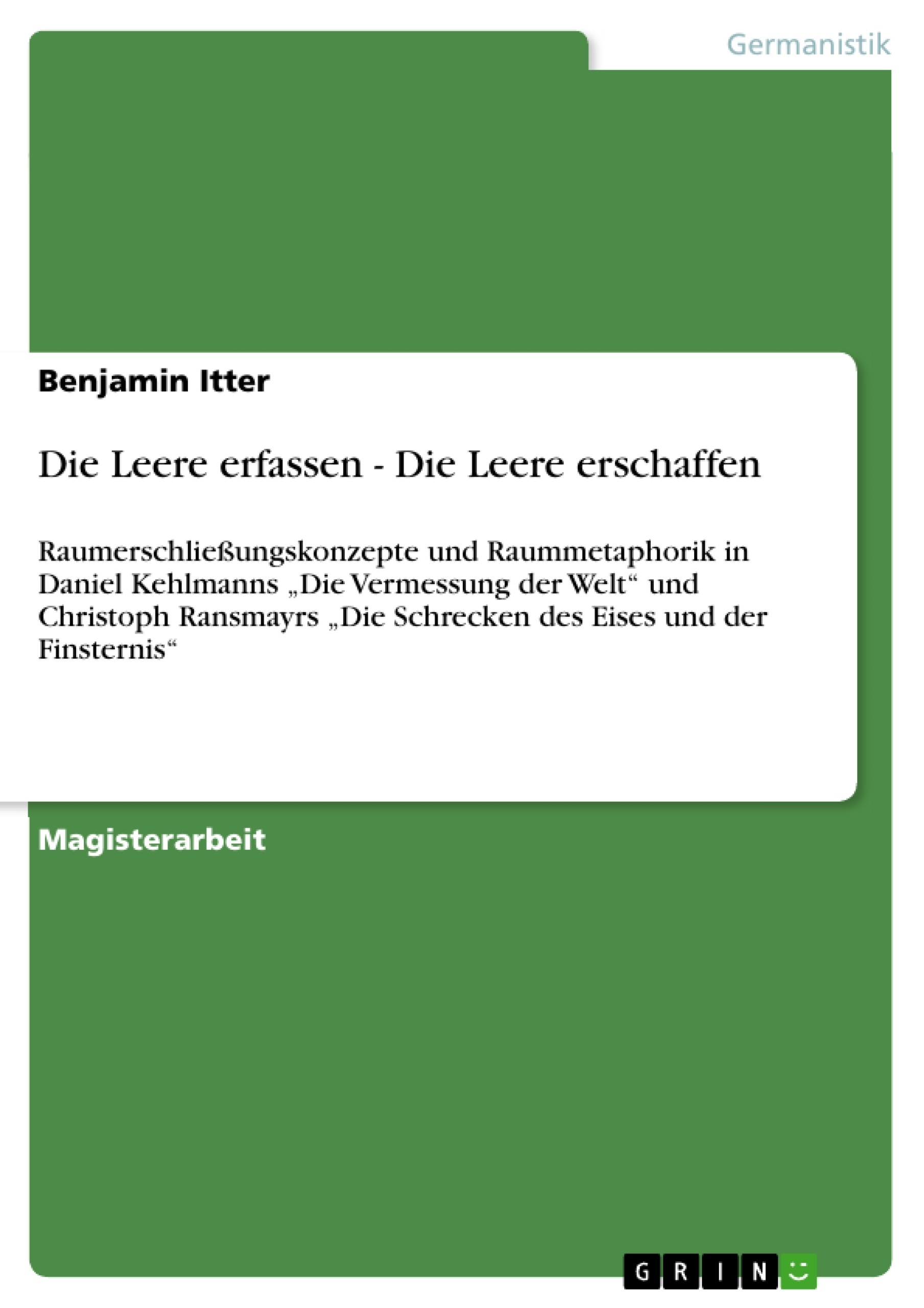Diese Arbeit setzt sich mit Raumerschließungskonzepten und der Raummetaphorik in Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt und Christoph Ransmayrs Roman Die Schrecken des Eises und der Finsternis auseinander. In eine Zeit des scheinbaren Verschwindens des Raumes setzen die Autoren zwei Romane, die sich mit dem Thema der Exploration, der Urbarmachung und Entdeckung von Räumen auseinandersetzen.
Der Leser wird in beiden Erzählungen in das 19. Jahrhundert zurückversetzt und damit in eine Zeit, die als Beginn der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Globalisierung gelten kann. Die wirtschaftliche Industrialisierung, der Imperialismus und die politischen Strömungen des Liberalismus, des Nationalismus und des Sozialismus, die Urbanisierung und die Verkehrsrevolution, die zu einer erhöhten Mobilität der Menschen führen sowie die Revolution der Wissenschaften und der Technik, lassen allesamt ihren Beginn in das 19. Jahrhundert rückdatieren. Die Haupterzählstränge des Romans Die Vermessung der Welt bilden die Südamerika-Expedition Alexander von Humboldts zwischen 1799 und 1804 sowie die „geistige Expedition“ Friedrich Gauß´, der zwischen Göttingen, Hannover und Berlin pendelnd, in unbekannte mathematische und physikalische Sphären vordringt.
In Ransmayrs Werk bilden die Haupterzählstränge einmal die österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition (Payer-Weyprecht-Expedition) zwischen 1872 und 1874 sowie die Geschichte von Josef Mazzini, der 100 Jahre nach der Payer-Weyprecht Expedition auf den Spuren derselben im ewigen Eis verschwindet. Die Analyse von Kehlmanns Roman nimmt dabei einen größeren Raum ein, da durch sie viele Grundbegrifflichkeiten bereits geklärt werden.
Meine These lautet, dass die von beiden Autoren entwickelten Raumerschließungskonzeptionen und die Raummetaphorik der Erzählräume auf der Metaebene auf die Vielfalt und Multidimensionalität von empirischen Räumen und deren Dynamik verweisen. Hinter der Fassade historischer Erzählungen verbergen sich moderne Raumkonzepte, deren Entstehung selbst durch die Struktur und Relation der erzählten Räume kritisch reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der spatial turn - Die Pluralisierung des Raumes
- Der Ordnungsraum der Antike und des Mittelalters
- Allmähliche Entgrenzung - Die Wende zum abstrakten Raum
- Der objektivierte Raum- Aufbruch in die "neue Welt"
- Die Räume der menschlichen Anschauung
- Raumergreifung im Namen der Freiheit
- Michel Foucaults,,Andere Räume"
- Der spatial turn in den Literatur- und Kulturwissenschaften
- Der literarische Raum
- Der erzählte Raum
- Juri Lotmans semantische Räume
- Das Chrontopos-Modell Michail Bachtins
- Der metahistorische Roman
- Raumstruktur in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt
- Die räumliche Binnenstruktur des Romans
- Semantische Räume in „Die Vermessung der Welt"
- Zwischenraum und Fremdraum - Raumkontrastierung
- Der Zwischenraum der Figur Alexander von Humboldt
- Der Zwischenraum der Figur Friedrich Gauß
- Die Bedeutung des Verhältnisses Außenraum und Innenraum
- Übergang in den Fremdraum
- Der Chronotopos der Vermessung - Die Leere erfassen
- Thematisierung des Verfließens der Zeit im Raum
- Die Heimkehr als Entwurf eines neuen Ausgangsraumes
- Fiktion und Wirklichkeit - Außertextuelle Räume
- Die Raumstruktur in Die Schrecken des Eises und der Finsternis
- Metahistorische Erzählweise - Grundmoment der Raumstruktur
- Die Erzählperspektive Josef Mazzinis - Die Leere erschaffen
- Die Payer-Weyprecht Expedition - Basisräume
- Stillstand im Eis - Unbeweglichkeit einer Insel
- Der,,Raumgreifer\" Payer
- Mazzinis Verschwinden - Demontage des Mythos vom beherrschbaren Raum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Raumkonzepten und Raummetaphorik in zwei literarischen Werken des 21. Jahrhunderts: Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“ und Christoph Ransmayrs „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die jeweiligen Raumstrukturen der Romane zu analysieren und die Bedeutung dieser Strukturen für die erzählte Geschichte und die literarische Gestaltung der beiden Werke zu erforschen.
- Der „spatial turn“ in den Literatur- und Kulturwissenschaften
- Die Rolle von Raumkonzepten in der literarischen Darstellung von Geschichte
- Die Bedeutung von Raummetaphorik für die Charakterisierung von Figuren und die Konstruktion von Bedeutung in der erzählten Welt
- Der Einfluss des „spatial turn“ auf die Interpretation von literarischen Texten
- Die unterschiedlichen Raumstrukturen in den beiden Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den „spatial turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften, insbesondere in Bezug auf die Literaturwissenschaft. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Raumverständnisses von der Antike bis zur Moderne. Es werden verschiedene Raumkonzepte vorgestellt und deren Bedeutung für die menschliche Wahrnehmung und die Gestaltung der Welt erörtert.
Im dritten Kapitel wird der „spatial turn“ im Kontext der Literatur- und Kulturwissenschaften eingeordnet und die Relevanz von Raumstudien für die Interpretation literarischer Texte herausgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich der Bedeutung des Raumes in der Literatur und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Analyse des literarischen Raumes.
Das fünfte Kapitel führt in die Thematik des metahistorischen Romans ein und beschreibt die charakteristischen Merkmale dieses Genres. Das sechste Kapitel analysiert die Raumstruktur in Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“ und untersucht die verschiedenen Arten von Räumen, die in dem Roman dargestellt werden.
Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit der Konstruktion des Chronotopos in Kehlmanns Roman und betrachtet die Bedeutung von Zeit und Raum für die erzählte Geschichte. Das achte Kapitel untersucht die Raumstruktur in Christoph Ransmayrs „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ und beleuchtet die Bedeutung der Erzählperspektive und der Darstellung der Polarlandschaft für den Roman.
Schlüsselwörter
Spatial turn, Raummetaphorik, Raumstruktur, literarischer Raum, Chronotopos, metahistorischer Roman, Daniel Kehlmann, „Die Vermessung der Welt“, Christoph Ransmayr, „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“, Raumkonzepte, Geschichte, Erzählperspektive, Polarlandschaft, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von „Die Vermessung der Welt“?
Daniel Kehlmanns Roman verknüpft die Lebensgeschichten von Alexander von Humboldt und Friedrich Gauß und deren unterschiedliche Arten, die Welt zu erfassen.
Welche Rolle spielt der „spatial turn“ in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Raumkonzepte und Raummetaphorik in den Romanen von Kehlmann und Ransmayr im Kontext der literaturwissenschaftlichen Wende zum Raum.
Wie unterscheiden sich Humboldt und Gauß in ihrer Raumerschließung?
Humboldt erschließt den Raum physisch durch Reisen und Vermessung, während Gauß eine „geistige Expedition“ in mathematische Räume unternimmt.
Worum geht es in Ransmayrs „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“?
Der Roman behandelt die österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition und das Verschwinden einer modernen Figur im ewigen Eis.
Was ist ein „metahistorischer Roman“?
Ein Genre, das historische Ereignisse erzählt, dabei aber die Art und Weise der Geschichtsschreibung und die Konstruktion von Wirklichkeit kritisch reflektiert.
- Citation du texte
- Benjamin Itter (Auteur), 2009, Die Leere erfassen - Die Leere erschaffen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190547