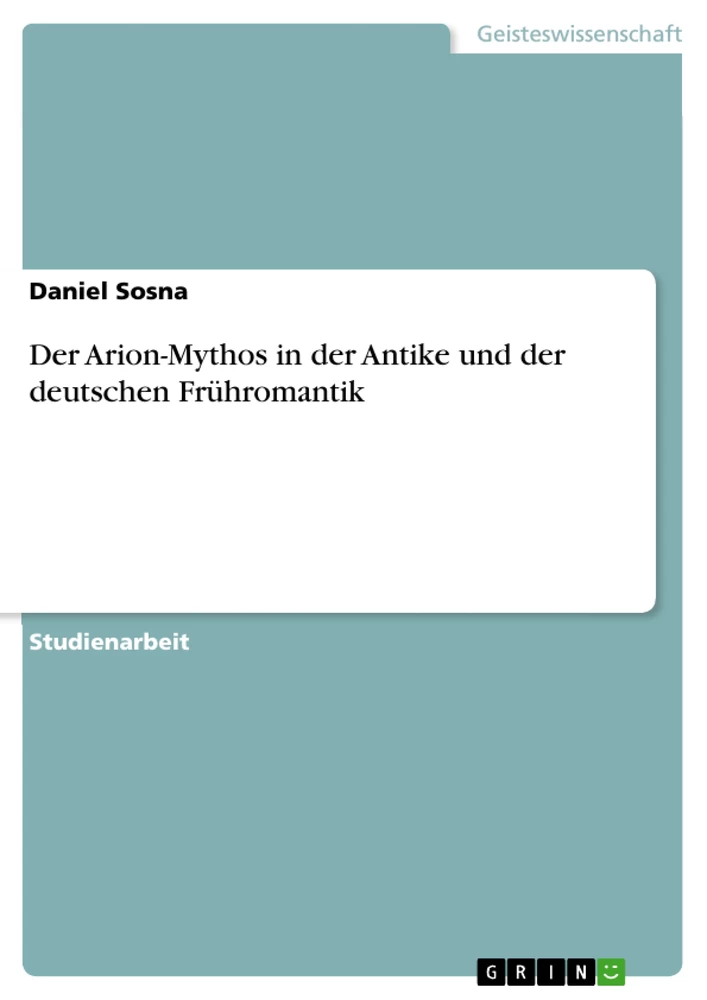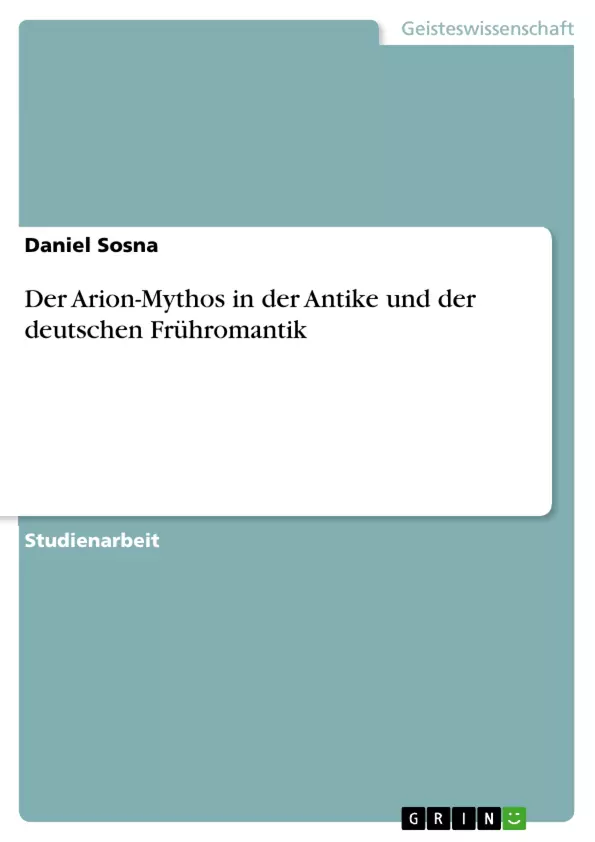„quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?“
Ovid deutet mit der oben stehenden rhetorischen Frage an, die in seiner Arion-Sage (Fasti, II, 79ff.) zu Beginn des dritten Distichons steht, dass die Figur des Arion größeren Teilen der antiken (gelehrten) Welt bekannt gewesen sein muss. Untrennbar mit dem legendären Sänger verbunden sind auch seine Leistungen im musischen und lyrischen Bereich sowie der Klang seiner Lyra, wenn er auf ihr spielte. Darüber hinaus knüpft sich an die Person des Arion deren wundersame Rettung vor geldgierigen Räubern durch einen Delphin, der – nach einigen Überlieferungen – zur Belohnung dafür von Jupiter in den Sternenhimmel erhoben wurde und seitdem ein eigenes Sternbild darstellt.
Arion soll im 7. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt haben und von der Insel Lesbos, genauer aus der Stadt Methymna, stammen. Eine längere Zeit soll er sich am Hofe Perianders (gestorben 585/3 v. Chr.), des korinthischen Tyrannen, aufgehalten haben. Von seinen angeblich so berühmten Texten und Liedern ist kein einziger Vers überliefert worden. Weiterhin ist aus seinem Leben nicht viel mehr bekannt als oben skizzierte Legende, deren grober Inhalt sich bei einer nahezu unüberschaubaren Anzahl antiker Autoren über die Jahrhunderte hinweg immer wieder findet. In Details unterscheidet sich die Erzählung bei den einzelnen Autoren jedoch. Die Arion-Sage begegnet uns zum ersten Male bei dem „Vater der Geschichtsschreibung“ Herodot (um 490 v. Chr. bis ca. 425 v. Chr.) in seinen Historien. Danach lassen sich in der Antike noch viele weitere Autoren ausmachen, die sich ebenfalls mit dem Stoff der Sage auseinandersetzen. Die bekanntesten von ihnen seien hier kurz vorgestellt: Der Dichter Ovid (43 v. Chr. bis wohl 17 n. Chr.) behandelt in seinen Fasti die Sage unter dem Gesichtspunkt des römischen Festkalenders und will vor allem seinem Leser mitteilen, wie und warum Jupiter das Sternbild des Delphins schuf. Des Weiteren finden wir den Arion bei Hyginus, unter dessen Namen wohl im 2. Jahrhundert rund 220 Fabeln veröffentlich worden sind. Welche Person sich dahinter genau verbirgt und inwieweit Hyginus mit einem gewissen Gaius Julius Hyginus – Bibliothekar zu Zeiten des Augustus – in Verbindung zu bringen ist, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Wichtiger als der Autor sind im Zusammenhand dieser Untersuchung auch der überlieferte Text und dessen Inhalt.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Die Arion-Sage in der Antike
- Die Arion-Sage in der deutschen Frühromantik
- August Wilhelm Schlegels „Arion“
- Ludwig Tiecks „Arion“
- „Arion“ in Novalis’ Roman „Heinrich von Ofterdingen“
- Zusammenfassende Schlussgedanken
- Verwendete Literatur und Quellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Rezeptionsgeschichte des Arion-Mythos von der Antike bis zur deutschen Frühromantik zu untersuchen. Sie analysiert die verschiedenen Darstellungen des Mythos bei antiken Autoren und vergleicht diese mit den literarischen Umsetzungen in der Frühromantik. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung herausgearbeitet und die Intentionen der frühromantischen Autoren hinterfragt.
- Rekonstruktion des Arion-Mythos anhand antiker Quellen
- Vergleichende Analyse der Darstellung des Mythos bei verschiedenen antiken Autoren
- Untersuchung der literarischen Umsetzung des Arion-Mythos in der deutschen Frühromantik
- Analyse der Intentionen der frühromantischen Autoren bei der Bearbeitung des Mythos
- Zusammenhang zwischen der Rezeption des Mythos und dem gesellschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zum Thema: Der einleitende Abschnitt beginnt mit einem Zitat Ovids, welches die Bekanntheit des Arion-Mythos in der antiken Welt unterstreicht. Er führt den Leser in die Thematik ein, indem er Arion als legendären Sänger und dessen wundersame Rettung durch einen Delphin beschreibt. Der Abschnitt skizziert kurz Arions Leben und verweist auf die zahlreichen antiken Autoren, die den Mythos überlieferten, wobei er auf Unterschiede in den Detaillierungen hinweist und die Notwendigkeit eines vergleichenden Ansatzes betont. Die Frage nach der Verbreitung und Veränderung des Mythos über die Jahrhunderte wird als zentrale Forschungsfrage formuliert.
Die Arion-Sage in der Antike: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Versionen des Arion-Mythos bei antiken Autoren wie Herodot, Ovid, Hyginus, Fronto, Aulus Gellius und Plinius dem Älteren. Es untersucht die jeweiligen Darstellungen, vergleicht die erzählerischen Schwerpunkte und identifiziert Unterschiede in den Details. Das Kapitel beleuchtet, wie der Mythos in unterschiedlichen Kontexten (Geschichtsschreibung, Dichtung, Naturgeschichte) verwendet und interpretiert wurde, und analysiert die Bedeutung des Mythos für die jeweilige Epoche und die individuellen Intentionen der Autoren. Die zentrale Frage nach der Entstehung und Weiterentwicklung des Mythos wird im Detail erörtert, indem die Abhängigkeit späterer Versionen von früheren Überlieferungen untersucht wird.
Die Arion-Sage in der deutschen Frühromantik: Dieses Kapitel widmet sich der Rezeption des Arion-Mythos bei den deutschen Frühromantikern, insbesondere bei August Wilhelm Schlegel, Ludwig Tieck und Novalis. Es untersucht deren literarische Bearbeitungen und stellt ihre individuellen Interpretationen des Mythos dar. Es wird analysiert, wie die Romantiker den antiken Stoff in ihre eigene Zeit und ihre künstlerischen Intentionen einbetteten und welche Aspekte des Mythos sie besonders hervorhoben oder veränderten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Vergleich der frühromantischen Umsetzungen mit den antiken Vorlagen, um die Veränderungen und Weiterentwicklungen des Mythos zu beleuchten und die Gründe für das starke Interesse der Frühromantiker an dieser Thematik zu ergründen.
Schlüsselwörter
Arion-Mythos, Antike, Frühromantik, Rezeptionsgeschichte, Herodot, Ovid, Schlegel, Tieck, Novalis, Vergleichende Literaturwissenschaft, Mythenrezeption, Literarische Umgestaltung, Gesellschaftlicher Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Rezeptionsgeschichte des Arion-Mythos von der Antike bis zur deutschen Frühromantik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Arion-Mythos, beginnend mit seiner Darstellung in der Antike bis hin zu seiner literarischen Verarbeitung in der deutschen Frühromantik. Der Fokus liegt auf dem Vergleich verschiedener Interpretationen und der Analyse der Intentionen der jeweiligen Autoren.
Welche antiken Autoren werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Versionen des Arion-Mythos bei antiken Autoren wie Herodot, Ovid, Hyginus, Fronto, Aulus Gellius und Plinius dem Älteren. Es werden die jeweiligen Darstellungen verglichen und Unterschiede in den Details herausgearbeitet.
Welche frühromantischen Autoren werden untersucht?
Im Schwerpunkt werden die literarischen Bearbeitungen des Arion-Mythos durch August Wilhelm Schlegel, Ludwig Tieck und Novalis untersucht. Die Arbeit analysiert ihre individuellen Interpretationen und den Einbezug des antiken Stoffes in ihre eigene Zeit und künstlerischen Intentionen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rekonstruktion des Arion-Mythos anhand antiker Quellen, einen vergleichenden Ansatz der Darstellung des Mythos bei verschiedenen antiken Autoren, die Untersuchung der literarischen Umsetzung in der deutschen Frühromantik, die Analyse der Intentionen der frühromantischen Autoren und den Zusammenhang zwischen der Rezeption des Mythos und dem gesellschaftlichen Kontext.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Hinführung zum Thema, ein Kapitel zur Arion-Sage in der Antike, ein Kapitel zur Arion-Sage in der deutschen Frühromantik (mit Unterkapiteln zu Schlegel, Tieck und Novalis), zusammenfassende Schlussgedanken, verwendete Literatur und Quellen sowie einen Anhang.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Eine zentrale Forschungsfrage ist die Verbreitung und Veränderung des Arion-Mythos über die Jahrhunderte hinweg. Die Arbeit untersucht, wie der Mythos in unterschiedlichen Kontexten verwendet und interpretiert wurde und welche Bedeutung er für die jeweilige Epoche hatte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Arion-Mythos, Antike, Frühromantik, Rezeptionsgeschichte, Herodot, Ovid, Schlegel, Tieck, Novalis, Vergleichende Literaturwissenschaft, Mythenrezeption, Literarische Umgestaltung, Gesellschaftlicher Kontext.
Wo finde ich die Kapitelzusammenfassungen?
Die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel: Hinführung zum Thema, Die Arion-Sage in der Antike und Die Arion-Sage in der deutschen Frühromantik. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
- Arbeit zitieren
- Daniel Sosna (Autor:in), 2011, Der Arion-Mythos in der Antike und der deutschen Frühromantik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190589