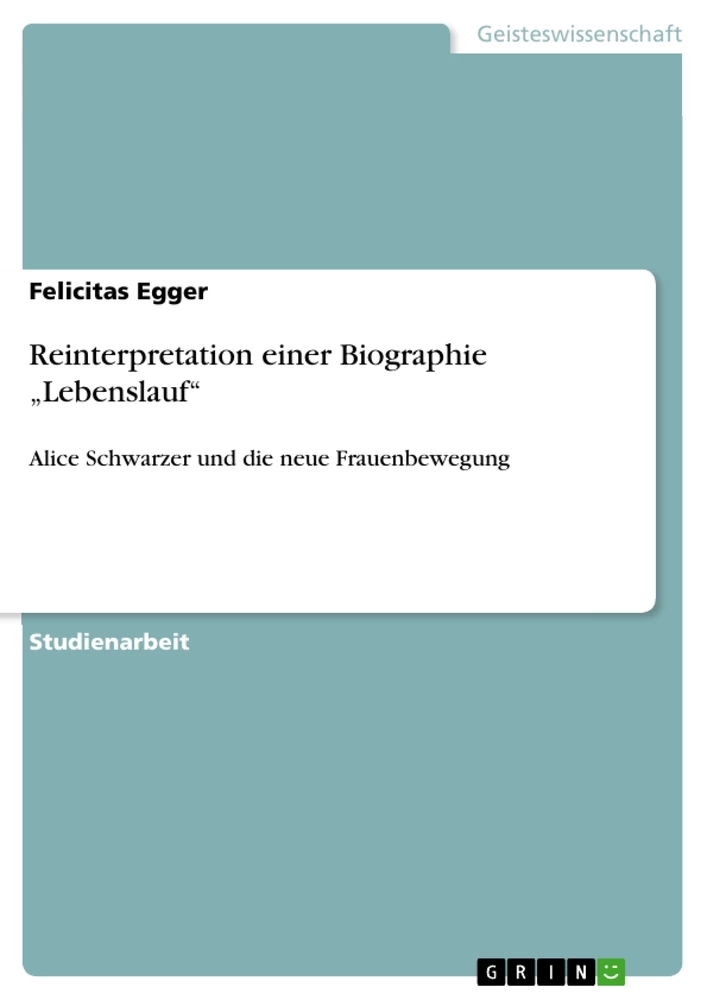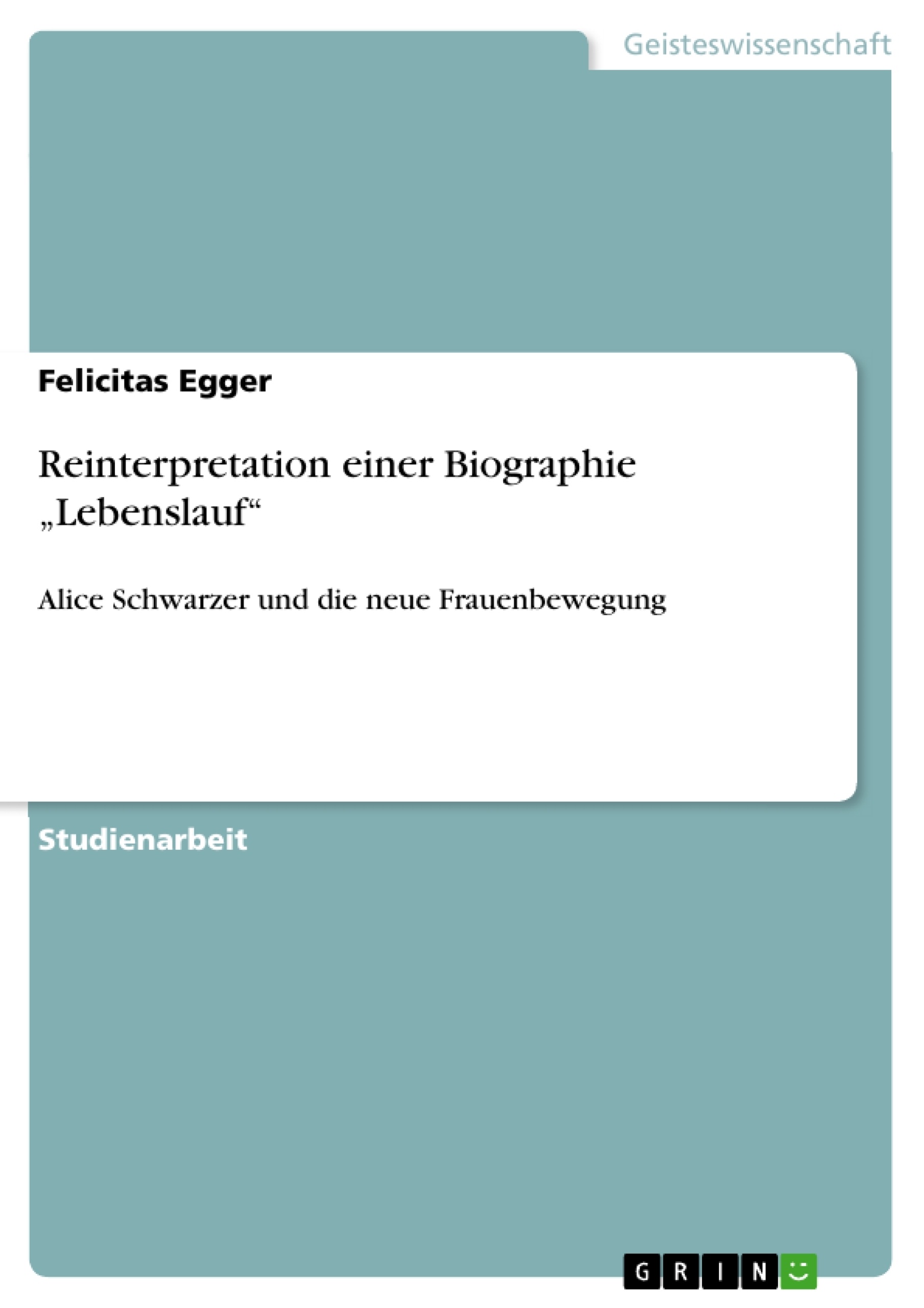Die Frauenfrage ist heute so aktuell wie vor etwa 40 Jahren, als sich in den westeuropäischen Ländern die sogenannte „neue Frauenbewegung“ formierte. Heute sind die Forderungen und Thematiken teilweise die gleichen, manche gerieten in Vergessenheit, andere wurden neu hinzugefügt – die Anliegen der Frauen verändern sich mit dem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext und den vorherrschenden Lebensentwürfen. Alice Schwarzer ist eine Persönlichkeit, die aus der neuen Frauenbewegung nicht wegzudenken ist, sie hat mit ihrem gesellschaftlichen und politischen Engagement in den vergangenen 40 Jahren immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Mit ihren Äußerungen und Stellungnahmen bezieht sie oft extreme Positionen und bewegt damit die öffentlichen Debatten zu Themen wie Abtreibung oder Kopftuchverbot. Der erste Teil dieser Arbeit umreißt kurz das Leben von Alice Schwarzer, anschließend werden theoretische Konzepte zur Bearbeitung von Biographien vorgestellt und dann wird auf die spezifische Situation von Frauen und die Frauenbewegungen in Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. Schließlich sollen die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln zusammengeführt werden, um folgende Fragestellungen zu beantworten: Was hat Alice Schwarzer geformt? Mit welchen Erfahrungen und Lebenserschütterungen war sie konfrontiert? Wie ist es ihr gelungen, gegenüber den dominanten Zeitströmungen eine relative Unabhängigkeit zu bewahren? Diese Fragestellungen zielen auf die zentrale Problematik in der Soziologie, wie individuelles Handeln und gesellschaftliche Strukturen bzw. Zwänge zusammenwirken. Ich möchte versuchen, das Leben von Alice Schwarzer vor allem im Kontext des Spagats zwischen politischem Engagement und wissenschaftlichem Arbeiten thematisieren, weil sie ein hervorragendes Beispiel für dieses Phänomen darstellt. In der Soziologie ist es auch von Interesse, wie sich das Wechselverhältnis zwischen Theorie und Praxis darstellt. Am Beispiel von Alice Schwarzer ist dies gut festzumachen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ALICE SCHWARZER: EINE KURZE DARSTELLUNG IHRES LEBENS
- Kindheit und Jugend in Wuppertal
- AUSBILDUNG
- AU-PAIR IN PARIS
- VOLONTARIAT BEI DEN DÜSSELDORFER NACHRICHTEN
- DIE 68ER
- ENGAGEMENT IN DER FRAUENBEWEGUNG
- DER ABTREIBUNGSPARAGRAPH
- DER KLEINE UNTERSCHIED UND SEINE GROẞEN FOLGEN - AUCH FÜR ALICE SCHWARZER
- THEORETISCHE KONZEPTE DER BIOGRAPHIEFORSCHUNG
- WOLFGANG FISCHER / MARTIN KOHLI: NORMALBIOGRAPHIE ALS ORIENTIERUNGSMUSTER
- MARIE JAHODA: EMOTIONALE UND INTELLEKTUELLE INVESTITIONEN
- PETER SLOTERDIJK: STÖR-ERFAHRUNGEN
- HERMANN LÜBBE: WAS HEIẞT „DAS KANN MAN NUR HISTORISCH ERKLÄREN“?
- HEINZ BUDE: DER FALL UND DIE THEORIE
- ANSELM STRAUSS: DIE BEDINGUNGSMATRIX
- DIE FRAUENBEWEGUNG IN FRANKREICH UND IN DEUTSCHLAND
- VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE FRAUENBEWEGUNG
- THEORETISCHE SCHLÜSSE
- ANWENDUNG DER BEDINGUNGSMATRIX AUF SCHWARZER UND IHR ENGAGEMENT IN DER FRAUENBEWEGUNG
- ALICE SCHWARZER UND NONKONFORMITÄT
- THEORETISche Schlüsse AUS DEM EINZElfall Alice ScHWARZER
- ALICE SCHWARZER UND DIE NORMALBIOGRAPHIE
- STÖRERFAHRUNGEN IN ALICE SCHWARZERS LEBEN
- HISTORISCHE ERKLÄRUNG FÜR DEN BEGINN DER FRAUENBEWEGUNG
- ABSCHLIEBENDE BETRACHTUNG
- WAS HAT ALICE SCHWARZER GEFORMT?
- MIT WELCHEN ERFAHRUNGEN BZW. LEBENSERSCHÜTTERUNGEN WAR SIE KONFRONTIERT?
- WIE IST ES IHR GELUNGEN, GEGENÜBER DOMINANTEN ZEITSTRÖMUNGEN IHRE UNABHÄNGIGKEIT ZU BEWAHREN?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Lebensgeschichte von Alice Schwarzer und untersucht, wie ihr Engagement in der neuen Frauenbewegung durch ihre Biographie und die gesellschaftlichen Strukturen geprägt wurde. Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen individuellem Handeln und gesellschaftlichen Zwängen, insbesondere im Kontext des Spagats zwischen politischem Engagement und wissenschaftlichem Arbeiten. Die Analyse stützt sich auf theoretische Konzepte der Biographieforschung und die Geschichte der Frauenbewegung in Frankreich und Deutschland.
- Die prägenden Einflüsse von Alice Schwarzers Kindheit und Jugend auf ihr späteres Engagement
- Die Bedeutung von Stör-Erfahrungen und Nonkonformität für die Entwicklung von Alice Schwarzers Lebensweg
- Die Rolle der Frauenbewegung und ihrer historischen Entwicklung in Frankreich und Deutschland
- Die Analyse der Biografie von Alice Schwarzer anhand theoretischer Konzepte der Biographieforschung
- Die Zusammenführung individueller Handlungsmotive und gesellschaftlicher Strukturen im Lebenslauf von Alice Schwarzer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Darstellung des Lebens von Alice Schwarzer, konzentriert sich dabei auf die ersten 14 Kapitel ihrer Autobiographie „Lebenslauf“. Das erste Kapitel beleuchtet die Kindheit und Jugend von Alice Schwarzer in Wuppertal und den Einfluss ihrer Familie auf ihre Entwicklung. Es wird dargelegt, wie ihre frühzeitige Selbstständigkeit und die Rolle der Großmutter ihre spätere Vermittlerinnenrolle zwischen Rand und Mitte der Gesellschaft prägten.
Das zweite Kapitel beschreibt Schwarzers Ausbildungsweg und die Herausforderungen, denen sie aufgrund des damaligen gesellschaftlichen Geschlechterbildes begegnete. Der Abschnitt zeichnet nach, wie sie im Alter von 19 Jahren mit ihrer ersten Beziehung eine schmerzhafte Erfahrung machte, die sie lange Zeit verdrängte.
Im dritten Kapitel wird Schwarzers Zeit als Au-pair in Paris beleuchtet. Dort lernte sie die französische Kultur kennen und begann mit dem Schreiben. Die Arbeit zeigt, wie diese Zeit ihre spätere Karriere als Journalistin vorbereitete.
Kapitel vier schildert Schwarzers Volontariat bei den Düsseldorfer Nachrichten, wo sie erstmals mit Frauenthemen in Berührung kam. Die Arbeit beschreibt ihre ersten Artikel über Prostitution und ihre frühen Gedanken zur Frauenemanzipation.
Das fünfte Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung der Arbeit. Es werden verschiedene Konzepte der Biographieforschung vorgestellt, darunter die „Normalbiographie“ nach Fischer und Kohli, die „Emotionale und intellektuelle Investitionen“ von Marie Jahoda, die „Stör-Erfahrungen“ von Peter Sloterdijk sowie die „Bedingungsmatix“ von Anselm Strauss. Diese Konzepte werden im Laufe der Arbeit zur Analyse von Schwarzers Leben eingesetzt.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Frauenbewegung in Frankreich und Deutschland. Es werden die historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung der Frauenbewegung analysiert und die spezifische Situation von Frauen in beiden Ländern beleuchtet.
Das siebte Kapitel führt die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammen und beantwortet die zentralen Fragestellungen der Arbeit: Was hat Alice Schwarzer geformt? Mit welchen Erfahrungen und Lebenserschütterungen war sie konfrontiert? Wie ist es ihr gelungen, gegenüber den dominanten Zeitströmungen eine relative Unabhängigkeit zu bewahren?
Schlüsselwörter
Alice Schwarzer, Frauenbewegung, Biographieforschung, Normalbiographie, Stör-Erfahrungen, Nonkonformität, Bedingungsmatix, gesellschaftliche Strukturen, individuelles Handeln, politisches Engagement, wissenschaftliches Arbeiten, Frauenemanzipation, Geschlechterrollen, Abtreibung, Kopftuchverbot, Frankreich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Alice Schwarzer in der Frauenbewegung?
Alice Schwarzer ist eine Leitfigur der neuen Frauenbewegung in Deutschland, bekannt durch ihr Engagement gegen den Abtreibungsparagraphen und als Gründerin der Zeitschrift EMMA.
Was ist eine „Normalbiographie“?
Ein soziologisches Konzept, das den gesellschaftlich erwarteten Lebenslauf (Schule, Ausbildung, Heirat, Rente) beschreibt, von dem Schwarzer bewusst abwich.
Welchen Einfluss hatte Paris auf Alice Schwarzer?
Während ihrer Zeit als Au-pair und Journalistin in Paris kam sie mit der französischen Frauenbewegung in Kontakt, was ihr politisches Denken maßgeblich prägte.
Was versteht man unter „Stör-Erfahrungen“ in ihrer Biografie?
Es sind Erlebnisse, die den gewohnten Lebenslauf unterbrechen und zur Reflexion oder zum Widerstand gegen gesellschaftliche Normen anregen.
Wie wird das Verhältnis von Theorie und Praxis bei ihr analysiert?
Die Arbeit untersucht, wie Schwarzer soziologische Erkenntnisse und journalistische Arbeit nutzte, um gesellschaftliche Veränderungen (Praxis) direkt anzustoßen.
- Citation du texte
- Felicitas Egger (Auteur), 2012, Reinterpretation einer Biographie „Lebenslauf“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190646