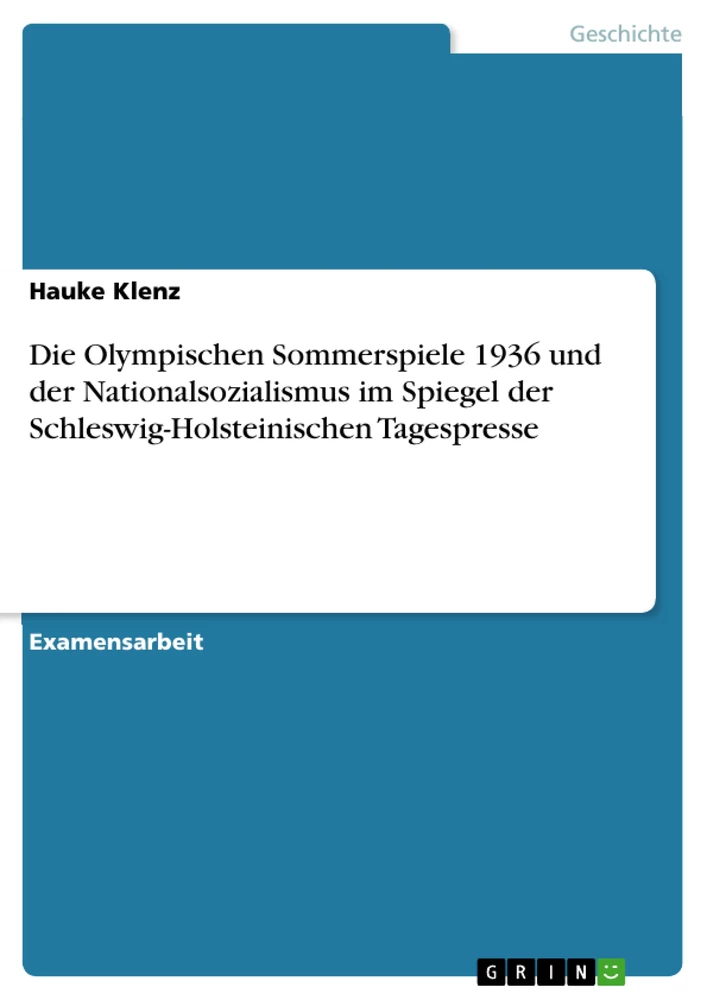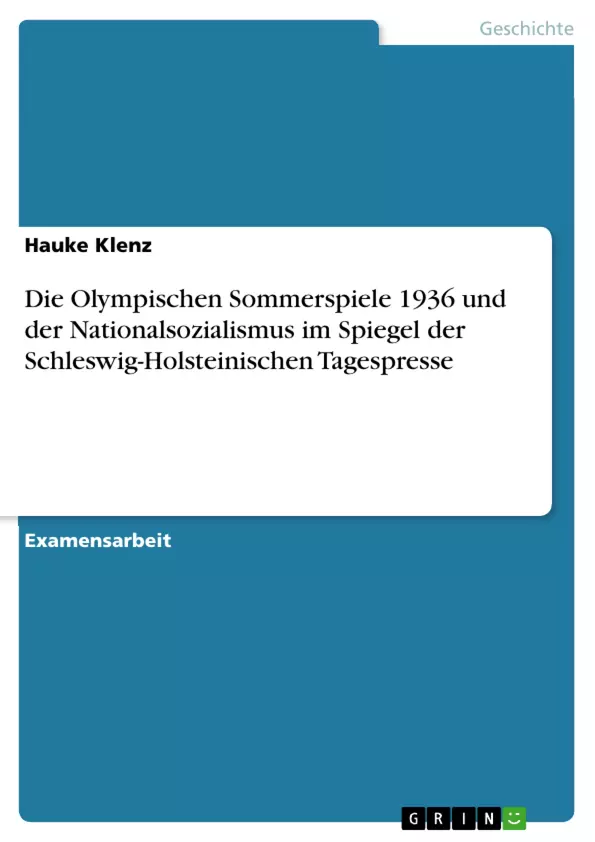Die Olympischen Sommerspiele des Jahres 1936 waren die ersten Olympischen Spiele, die in einer Diktatur stattfanden. Einerseits führte diese Tatsache zu einer weltweiten Protestbewegung, andererseits verschaffte sie den Ausrichtern der Spiele die nahezu uneingeschränkte organisatorische und finanzielle Unterstützung des gastgebenden Staates.
In der heutigen Zeit fällt es schwer nachzuvollziehen, warum sich das Internationale Olympische Komitee (IOK) dazu entschloss, die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, der Hauptstadt des sich unter der Herrschaft der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und ihres Führers Adolf Hitler befindlichen Deutschlands, auszutragen. Hier sei erwähnt, dass sich das IOK bereits am 13. Mai 1931, also lange vor der Machtergreifung Hitlers, auf den Ort der Spiele festgelegt hatte. Hierfür ist besonders Theodor Lewald, deutscher Sportfunktionär und Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 1936, als treibende Kraft anzusehen, da er bereits seit 1927 systematisch auf eine Vergabe der Spiele an Berlin hinarbeitete. Ausschlaggebend für die Entscheidung des IOK waren besonders die Organisationsfähigkeit und die Gastfreundschaft der Deutschen. War Deutschland aufgrund politischer Motivationen von den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen und 1924 in Chamonix noch ausgeschlossen, so hatte es mit der Vergabe der Spiele an Berlin geschafft, endgültig auf die Bühne des internationalen Sports zurückzukehren.
Es darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass die NSDAP den Olympischen Spielen nicht immer wohl gesonnen gegenüberstand. Besonders der „Völkische Beobachter“ (VB) und die „NS-Monatshefte“, Zentral- und Theorieorgane der NSDAP, beinhalteten regelmäßig entsprechende Berichte. Ein auf nationalen Gründen beruhender Sinneswandel erfolgte erst kurze Zeit nach Beendigung der Olympischen Sommerspiele von Los Angeles 1932. Dieser ist wohl nicht nur auf das dortige Abschneiden der deutschen Mannschaft, die mit einer Ausbeute von fünf Gold-, zwölf Silber- und sieben Bronzemedaillen nur den sechsten Rang in der Nationenwertung erreichte , zurückzuführen, sondern auch auf die nicht mehr zu übersehende Ausstrahlungskraft, die olympische Erfolge auf internationaler Ebene zu haben vermochten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage und Forschungsstand
- Die neuzeitliche Wiedergeburt der olympischen Spiele
- Der deutsche Sport und der Nationalsozialismus
- Die Situation vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
- Die Situation nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
- Die Olympischen Spiele auf dem Weg nach Berlin
- Berlins Bewerbung für die Olympischen Spiele 1936
- Berlin wird Ausrichter der Olympischen Spiele 1936
- Die außen- und innenpolitische Darstellung Deutschlands im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 1936
- Außenpolitische Darstellung Deutschlands durch das NS-Regime
- Verschleierung der Judenfeindlichkeit
- Die Presse im nationalsozialistischen Deutschland
- Die Lenkung der Presse im nationalsozialistischen Deutschland
- Die Phasen der Aus- und Gleichschaltung der Presse im nationalsozialistischen Deutschland
- Die schleswig-holsteinische Presse zwischen Republik und Diktatur
- Die Struktur der schleswig-holsteinische Presse zwischen 1928 und 1931
- Der Wandel der schleswig-holsteinischen Presse und ihre Annäherung an den Nationalsozialismus
- Die Haltung der linksorientierten Presse gegenüber dem Nationalsozialismus
- Die Installation des neuen Pressesystems in Schleswig-Holstein
- Die Olympischen Sommerspiele 1936 und die Schleswig-Holsteinische Tagespresse
- Die ,,Kieler Neuesten Nachrichten“
- Die Bildberichterstattung der „Kieler Neuesten Nachrichten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Die Wortberichterstattung der „Kieler Neuesten Nachrichten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Zwischenfazit zur Untersuchung der „Kieler Neuesten Nachrichten“
- Darstellung im „Lübecker Volksboten“
- Die Bildberichterstattung des „Lübecker Volksboten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Die Wortberichterstattung des „Lübecker Volksboten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Zwischenfazit zur Untersuchung des „Lübecker Volksboten“
- Darstellung in den „,Husumer Nachrichten“
- Die Bildberichterstattung der „Husumer Nachrichten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Die Wortberichterstattung der „Husumer Nachrichten“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Zwischenfazit zur Untersuchung der „Husumer Nachrichten“
- Darstellung in der „Eckernförder Zeitung“
- Die Bildberichterstattung der „Eckernförder Zeitung“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Die Wortberichterstattung der „Eckernförder Zeitung“ zu den Olympischen Spielen 1936
- Zwischenfazit zur Untersuchung der „Eckernförder Zeitung“
- Die ,,Kieler Neuesten Nachrichten“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Berichterstattung der schleswig-holsteinischen Tagespresse über die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin. Die Arbeit untersucht, wie die Spiele im Kontext des nationalsozialistischen Regimes dargestellt wurden und welche Rolle die Presse im Rahmen der NS-Propaganda spielte.
- Die Rolle der Olympischen Spiele 1936 in der NS-Propaganda
- Die Darstellung der Spiele in der schleswig-holsteinischen Tagespresse
- Die Einflüsse des nationalsozialistischen Regimes auf die Presse
- Die Bild- und Wortberichterstattung über die Spiele
- Die Rezeption der Spiele in Schleswig-Holstein
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Olympischen Sommerspiele 1936 im Kontext des Nationalsozialismus ein und beleuchtet die Bedeutung der Spiele für das NS-Regime. Anschließend werden die Quellenlage und der Forschungsstand dargelegt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Entwicklung des deutschen Sports im Nationalsozialismus, die Geschichte der Bewerbung und Vergabe der Spiele an Berlin sowie die außen- und innenpolitische Darstellung Deutschlands im Vorfeld der Spiele untersucht.
Es folgt eine Analyse der Presse im nationalsozialistischen Deutschland, die sich auf die Lenkung der Presse durch das Regime und die Phasen der Aus- und Gleichschaltung fokussiert. Anschließend wird die Struktur und Entwicklung der schleswig-holsteinischen Presse zwischen 1928 und 1931 beleuchtet, sowie die Haltung der linksorientierten Presse gegenüber dem Nationalsozialismus und die Installation des neuen Pressesystems in Schleswig-Holstein.
Im Kern der Arbeit werden die Berichterstattung der vier schleswig-holsteinischen Tageszeitungen „Kieler Neuesten Nachrichten“, „Lübecker Volksbote“, „Husumer Nachrichten“ und „, Eckernförder Zeitung“ über die Olympischen Sommerspiele 1936 analysiert. Dabei werden sowohl die Bildberichterstattung als auch die Wortberichterstattung untersucht, um die Perspektive der jeweiligen Zeitung auf die Spiele zu ergründen. Die Ergebnisse der Analyse werden in Zwischenfazits für jede der vier Zeitungen zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Olympische Sommerspiele 1936, Nationalsozialismus, Propaganda, Presse, Schleswig-Holstein, Tagespresse, Bildberichterstattung, Wortberichterstattung, „Kieler Neuesten Nachrichten“, „Lübecker Volksbote“, „Husumer Nachrichten“, „Eckernförder Zeitung“
- Citation du texte
- Hauke Klenz (Auteur), 2010, Die Olympischen Sommerspiele 1936 und der Nationalsozialismus im Spiegel der Schleswig-Holsteinischen Tagespresse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190656