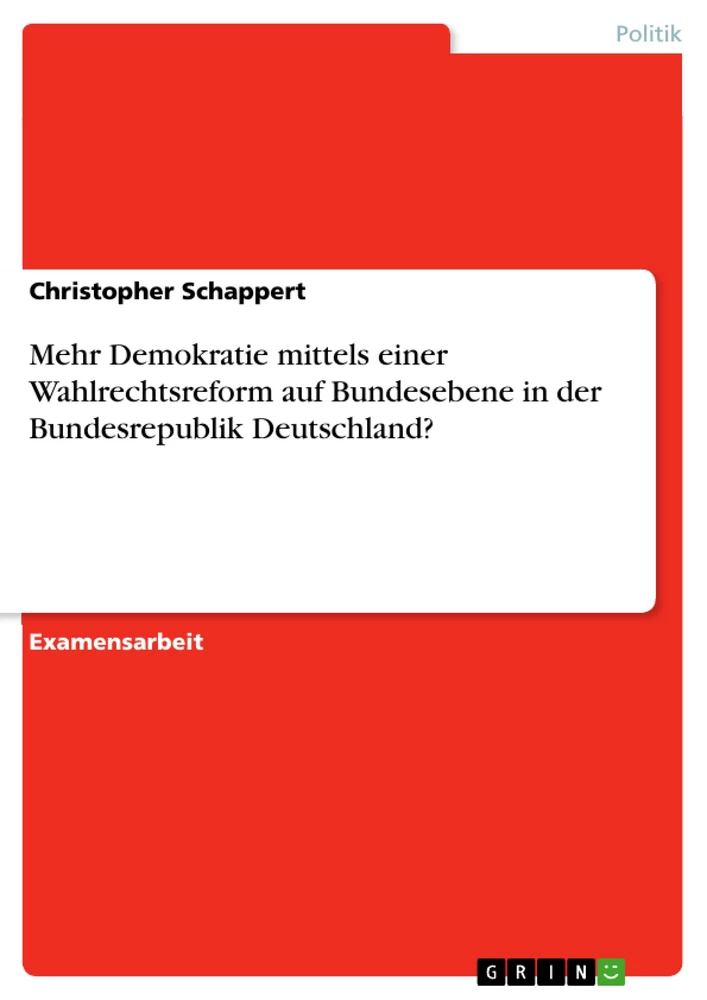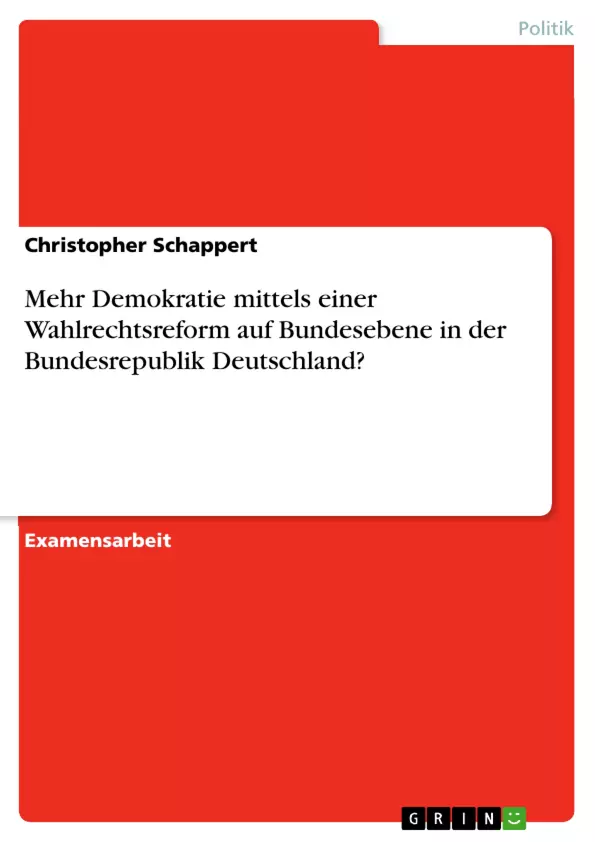„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ heißt es im deutschen Grundgesetz Artikel 20, Absatz 2. Dieser Grundsatz kann in einer modernen, liberalen westlichen Demokratie nur durch Wahlen umgesetzt werden, bei denen das Volk seine Repräsentanten selbst wählt. Ziel einer Demokratie muss also sein, die wahren Präferenzen der Bürger möglichst genau zu erfassen und diese in Politik im Interesse der Bürger umzusetzen. Dementsprechend sollte es auch die Bundesrepublik Deutschland (BRD) anstreben, bei Wahlen, insbesondere bei solchen auf Bundesebene zum deutschen Bundestag, den Wählerwillen im Parlament widerzuspiegeln.
Während sich viele wissenschaftliche Abhandlungen mit der konkreten Umsetzung von Wählerstimmen in Parlamentsmandate befassen, wird zumeist die Transformation von politischen Präferenzen in Wählerstimmen auf individueller Bürgerebene vernachlässigt. Ist ein Wähler zum Beispiel Anhänger der SPD und befürwortet ein rot-grünes Regierungsbündnis auf Bundesebene, so kann er entsprechend seiner Präferenz bei den Bundestagswahlen für die SPD votieren. Geht die SPD jedoch nach der Wahl eine Koalition mit der CDU/CSU ein, da es im Parlament nicht für eine rot-grüne Mehrheit gereicht hat, so hat der Wähler letztendlich durch seine Stimme eine Regierungskoalition unterstützt, die er unter Umständen als nicht wünschenswert erachtet hätte. Jedoch blieb ihm keine andere Möglichkeit, seine politischen Präferenzen mittels Zweitstimmenabgabe „genauer“ zum Ausdruck zu bringen. Dies ist jedoch nur ein Beispiel von vielen denkbaren, warum das deutsche Bundestagswahlrecht mittels einer Wahlrechtsreform „demokratischer“ gemacht werden sollte. Offensichtlich spielen bei bundesdeutschen Wahlen zunehmend strategische Überlegungen seitens der Wähler eine Rolle, so dass in der vorliegenden Arbeit ein Vorschlag erarbeitet wurde, wie das deutsche Bundestagswahlrecht reformiert werden kann, um es (noch) demokratischer zu machen. Ausgangspunkt sind hierbei normative Überlegungen, wonach es für eine Demokratie bedeutsam ist, wie die Bürger ihre politischen Interessen und Einstellungen in Wahlstimmen ausdrücken können, sowie wie diese Wahlstimmen verrechnet und in entsprechende Parlamentsmandate übersetzt werden. Damit das Volk regieren kann und politische Herrschaft so weit wie möglich legitim ist, sollte die Herrschaft alle politischen Interessen und Präferenzen entsprechend ihres gesellschaftlichen Einflusses bündeln und zum Wohle des Volkes verwirklichen. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Problematisierung
- Von der Herrschaft des Volkes zur Volksrepräsentation: Zur Bedeutung von Wahlen in der repräsentativen Demokratie
- Wahlen als Grundpfeiler der modernen Demokratie
- Übertragung von Präferenzen in politische Macht: Wahlsysteme und Wahlsystemeffekte
- Zwischen Bewährtem und Reformiertem: Die Verwirklichung politischer Präferenzen des deutschen Wahlbürgers auf Bundesebene mittels Wahlen und Wahlsystem
- Bewährtes ohne Mängel? Das Bundestagswahlsystem auf dem Prüfstand
- Der Wähler als homo oeconomicus: Ein theoretischer Erklärungsansatz des rationalen Wählens nach Anthony Downs
- Wählen entgegen dem Sinn der Demokratie? Verfälschte Präferenzartikulation durch strategisches Wahlverhalten
- Von der „Enge der Zweitstimme“ zu Reformvorschlägen auf dem Abstellgleis: Defizite des bundesdeutschen Wahlsystems und bisherige Versuche diese zu beseitigen
- Genauere Wählerpräferenztransmission zur Korrektur eines defizitären Wahlsystems? Ein Vorschlag zur Modifikation des Wahlrechts auf Bundesebene
- Die Idee: Verbesserte Erfassung von parteipolitischen Präferenzen mit Hilfe eines Systems des Kumulierens und Panaschierens von Zweitstimmen
- Die Effekte: Theoretische Auswirkungen und „Mehr Demokratie“ durch eine Wahlrechtsreform?
- Die Umsetzung: Von der Wählerpräferenz zum Parlamentsmandat
- Zwischen Kongruenzen und Divergenzen: Empirische Analysen zu Einstellungen von Wählern und Parteien bezüglich des Vorschlags zur Bundestagswahlsystemreform
- Der Wähler, Wahlen und Wahlrechtsreform: Von Defiziten des Wahlsystems auf Bundesebene zur Modifikation
- Von Diskrepanzen und Übereinstimmung: Theorie und Empirie im Vergleich
- Zwischen Machtpolitik und Demokratienorm: Die deutschen Parteien und ihre Einstellungen zu Wahlen, Wahlsystem und Wahlrechtsreform
- Reform ohne Makel? Mögliche Probleme, Schwächen und Herausforderungen der vorgeschlagenen Wahlsystemmodifikation
- Defizite oder ein „Mehr an Demokratie“? Zusammenfassung und Fazit
- Von der Wählerpräferenz zu Herausforderungen einer möglichen Reform: Eine abschließende Zusammenfassung der Erkenntnisse
- „Mehr Demokratie“ trotz Bedenken: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Prüfungsarbeit befasst sich mit der Frage, ob eine Wahlrechtsreform auf Bundesebene in der Bundesrepublik Deutschland zu „Mehr Demokratie“ führen kann. Die Arbeit untersucht kritisch das bestehende Wahlsystem und analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen einer Reform. Sie geht dabei auf die Bedeutung von Wahlen in der repräsentativen Demokratie ein, beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zum Wahlverhalten und analysiert empirische Daten zu Einstellungen von Wählern und Parteien bezüglich einer möglichen Wahlrechtsreform.
- Die Bedeutung von Wahlen für die repräsentative Demokratie
- Das deutsche Wahlsystem und seine Defizite
- Die Auswirkungen einer Wahlrechtsreform auf die politische Repräsentation
- Theoretische und empirische Analysen zu Einstellungen von Wählern und Parteien
- Herausforderungen und Chancen einer Wahlrechtsreform
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die Problematik der Wahlrechtsreform in Deutschland dar und erläutert die Forschungsfrage.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von Wahlen in der repräsentativen Demokratie und beleuchtet verschiedene Aspekte der Wahlsystematik.
- Das dritte Kapitel analysiert das bestehende Wahlsystem auf Bundesebene und untersucht seine Vor- und Nachteile.
- Das vierte Kapitel geht auf die theoretischen Grundlagen des rationalen Wahlverhaltens ein und analysiert das strategische Wahlverhalten von Wählern.
- Das fünfte Kapitel präsentiert einen konkreten Vorschlag zur Modifikation des Wahlsystems und untersucht dessen theoretische Auswirkungen.
- Das sechste Kapitel stellt empirische Befunde zu Einstellungen von Wählern und Parteien bezüglich der vorgeschlagenen Wahlrechtsreform vor.
- Das siebte Kapitel analysiert mögliche Probleme, Schwächen und Herausforderungen der vorgeschlagenen Wahlsystemmodifikation.
Schlüsselwörter
Wahlrechtsreform, repräsentative Demokratie, Bundestagswahlsystem, Wahlverhalten, strategisches Wählen, Kumulieren und Panaschieren, empirische Analyse, Einstellungen von Wählern, Einstellungen von Parteien, Mehr Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Wahlrechtsreform auf Bundesebene?
Das Ziel ist es, den Wählerwillen präziser im Parlament abzubilden und die Transformation politischer Präferenzen in Wählerstimmen demokratischer zu gestalten.
Was wird unter „strategischem Wahlverhalten“ verstanden?
Wähler stimmen oft nicht für ihre absolute Lieblingspartei, sondern taktisch (z.B. für einen Koalitionspartner), was die eigentliche Präferenzartikulation verfälschen kann.
Welchen Reformvorschlag macht die Arbeit?
Vorgeschlagen wird die Einführung eines Systems des Kumulierens und Panaschierens von Zweitstimmen, um Wählern mehr Flexibilität bei der Stimmabgabe zu ermöglichen.
Was bedeutet „Kumulieren und Panaschieren“?
Kumulieren erlaubt das Häufeln mehrerer Stimmen auf einen Kandidaten; Panaschieren ermöglicht das Verteilen von Stimmen auf Kandidaten verschiedener Parteilisten.
Wie stehen die deutschen Parteien zu einer solchen Reform?
Die Arbeit analysiert Diskrepanzen zwischen Machtpolitik und Demokratienorm, wobei Parteien Reformen oft skeptisch gegenüberstehen, wenn diese ihre eigene Machtposition gefährden könnten.
- Citar trabajo
- Christopher Schappert (Autor), 2011, Mehr Demokratie mittels einer Wahlrechtsreform auf Bundesebene in der Bundesrepublik Deutschland?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190666