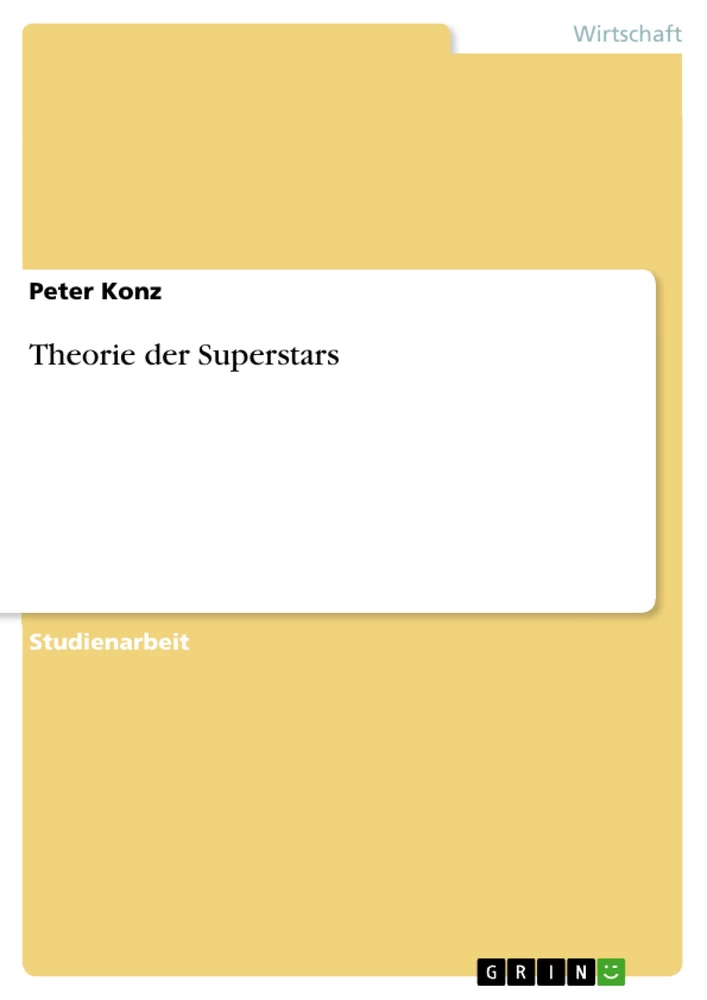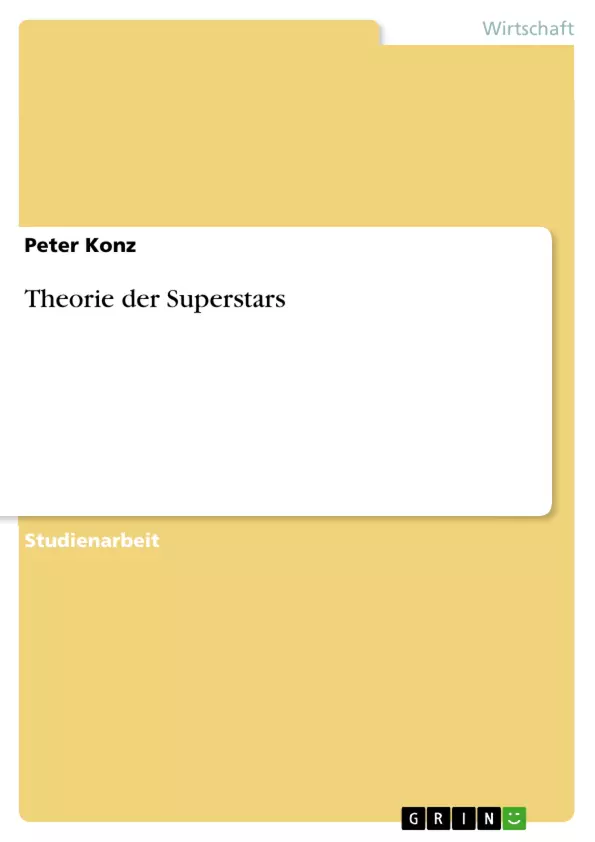Spielt Frank Lampard vom FC Chelsea wirklich sechsmal besser als ein durchschnittlicher Spieler der Premier League? Sind die englischen Fußballer die talentiertesten in Europa? Dreimal stärker als Spieler aus Frankreich? Legt man das Einkommen dieser Sportler als Indikator für ihre Leistung zugrunde, muss man eigentlich davon ausgehen, dass obige Aussagen stimmen. Jedem müsste die Unverhältnismäßigkeit der Verdienste zu dem Können der Akteure auffallen. Es stellt sich somit die Frage, womit der übertriebene Anstieg der Spielergehälter, speziell von herausragenden Stars verschiedener Vereine, zu rechtfertigen ist. (Die Welt, 2008)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Superstars und soll die Ungleichverteilung der Einkommen von Künstlern erklären. Sie gibt unter anderem zu verstehen, dass in unserer heutigen Zeit, in der künstlerisches Gut über die Medien kostenminimal und nahezu unbegrenzt verbreitet werden kann, bereits kleinste Talentunterschiede der Darsteller zu erheblichen Einkommensunterschieden führen können. Dabei tritt in vielen Märkten das Phänomen auf, dass sich die Nachfrage auf einen vergleichsweise kleinen Teil der Anbieter konzentriert, welche ihre Mitstreiter klar dominieren. Nur wenige Stars können ausreichen, um einen großen Markt abzudecken. Halte man sich einmal den Markt für klassische Musik vor Augen. Trotz seinem enormen Ausmaß sind nur sehr wenige herausstechende Solisten bekannt, die im Vergleich zu zweitrangigen Musikern um ein Vielfaches mehr verdienen. Es scheint jedoch fraglich zu sein, ob ein Laie den Unterschied in den verschiedenen Spielweisen überhaupt heraushören kann. (Rosen, 1981) Wir werden auch sehen, dass die Schieflage in der Einkommensverteilung von Anbietern den Anstieg der Preise von Künstlergut nicht ausreichend erklären kann und noch weitere Faktoren eine Rolle spielen müssen.
Zu Beginn dieser Arbeit diskutieren wir das Modell von Sherwin Rosen. Am Ende des Kapitels werden noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und verschiedene auftretende Effekte behandelt. In einem weiteren Kapitel untersuchen wir, inwiefern der Markt für Rockkonzerte die bearbeitete Theorie widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell von Sherwin Rosen
- Die Nachfrageseite
- Die Angebotsseite
- Das Marktgleichgewicht
- Zusammenfassung und Kritikpunkte
- Der Markt für Rockkonzerte
- Datenbasis
- Die Entwicklung von Ticketverkäufen
- Die Verteilung der Einnahmen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Superstars und soll die Ungleichverteilung der Einkommen von Künstlern erklären. Sie gibt unter anderem zu verstehen, dass in unserer heutigen Zeit, in der künstlerisches Gut über die Medien kostenminimal und nahezu unbegrenzt verbreitet werden kann, bereits kleinste Talentunterschiede der Darsteller zu erheblichen Einkommensunterschieden führen können.
- Erklärung der Ungleichverteilung von Einkommen im Zusammenhang mit Superstars
- Die Rolle der Medien und der Verbreitung von künstlerischem Gut
- Die Auswirkungen von Talentunterschieden auf Einkommen
- Analyse des Modells von Sherwin Rosen
- Anwendung der Theorie auf den Markt für Rockkonzerte
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Thematik der Superstars eingeführt und die Frage nach der Rechtfertigung von überhöhten Gehältern, insbesondere bei herausragenden Sportlern, aufgeworfen. Das zweite Kapitel behandelt das Modell von Sherwin Rosen, das die Ungleichverteilung von Einkommen in künstlerischen Bereichen erklären soll. Das dritte Kapitel untersucht den Markt für Rockkonzerte und analysiert, inwiefern er die in Kapitel 2 behandelte Theorie widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Superstars, Einkommensunterschiede, Talent, Medien, Verbreitung von Gut, Sherwin Rosen, Rockkonzerte, Marktgleichgewicht, Nachfrage, Angebot.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die „Theorie der Superstars“?
Die Theorie erklärt, warum in bestimmten Märkten (Sport, Musik) kleinste Talentunterschiede zu massiven Einkommensunterschieden führen, da wenige Top-Anbieter den gesamten Markt bedienen können.
Welchen Einfluss haben moderne Medien auf Superstar-Einkommen?
Medien ermöglichen die Verbreitung künstlerischer Güter zu minimalen Grenzkosten, wodurch ein einziger Star ein Millionenpublikum erreichen und Konkurrenten verdrängen kann.
Wer entwickelte das grundlegende Modell der Superstars?
Das ökonomische Modell wurde 1981 von Sherwin Rosen formuliert, um die Schieflage in der Einkommensverteilung zu analysieren.
Wie zeigt sich das Phänomen im Markt für Rockkonzerte?
Im Rockmarkt konzentriert sich ein Großteil der Einnahmen auf eine sehr kleine Gruppe von Top-Acts, während der Großteil der Musiker nur geringe Erträge erzielt.
Warum sind Talentunterschiede oft schwer objektiv messbar?
Oft kann ein Laie den qualitativen Unterschied zwischen einem Weltstar und einem zweitrangigen Musiker kaum hören, dennoch dominiert der Star die Nachfrage aufgrund von Markenbildung und Skaleneffekten.
- Citation du texte
- Peter Konz (Auteur), 2010, Theorie der Superstars, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190856