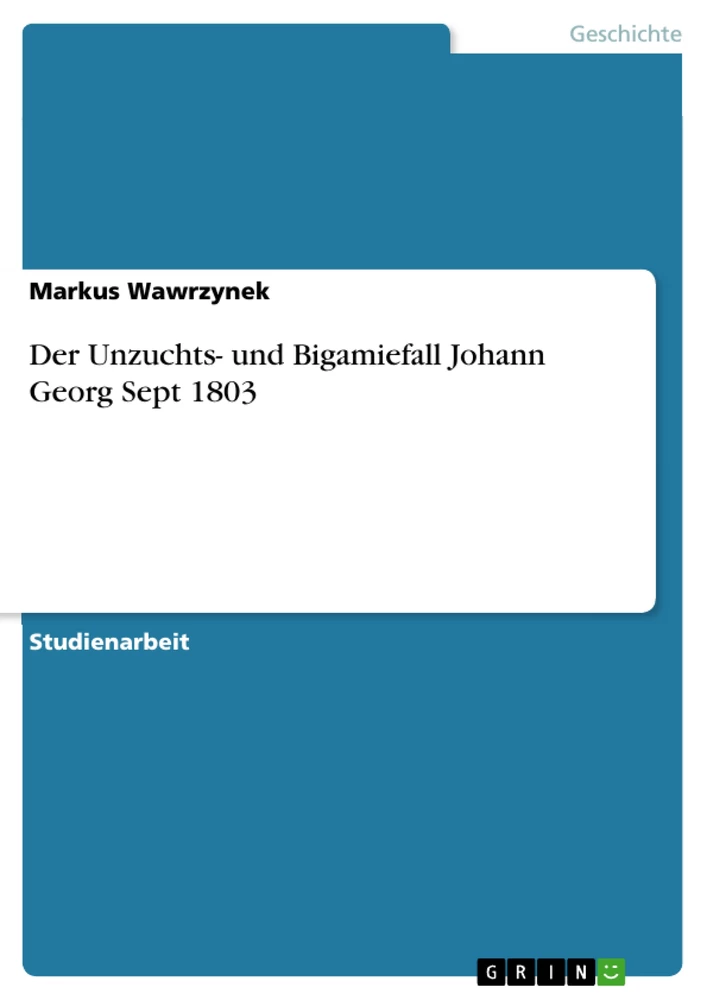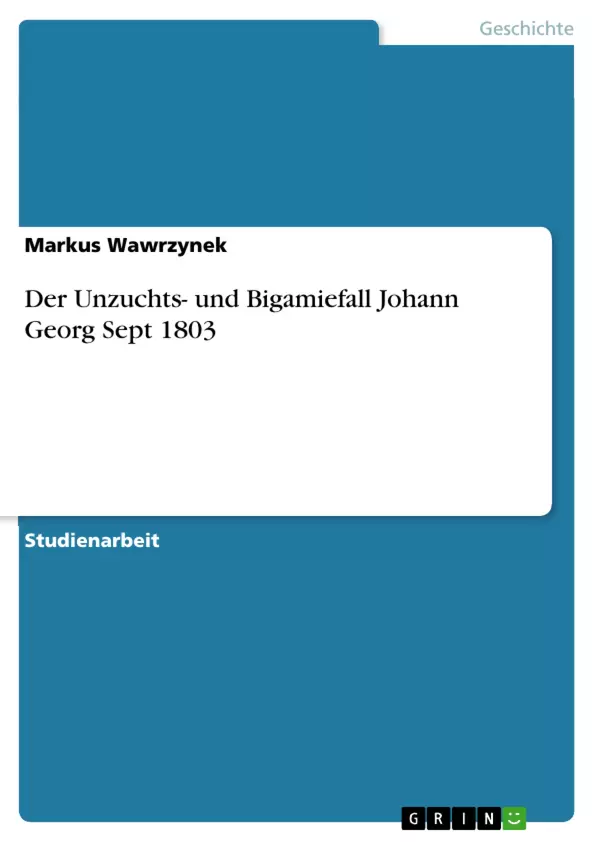Das Ziel der Revision des Unzuchts- und Bigamiefalles, der 1803 vor dem Patrimonialgericht in Brunn untersucht und verhandelt wurde, ist es, einen quellenfundierten Beitrag zur Erforschung der Lebensweise und der Lebensgewohnheiten niederer sozialer Schichten im ländlichen fränkischen Raum zu liefern. Da in der Regel aus diesem weitgehend analphabetische soziale Milieu so gut wie keine eigenhandschriftlichen Quellen vorhanden sind, ist es nötig auf schriftliche Quellengattungen auszuweichen, die von Schreibkundigen verfasst wurden, aber den Inhalt bzw. die Aussage der Analphabeten spiegeln. Diese Art von Quellen findet sich zumeist in Form von Protokollen in Untersuchungs- bzw Prozessakten, was zur Folge hat, dass die niedergelegte Aussage entweder von einem Delinquenten oder von einem Zeugen im untersuchten Kriminalfall stammt. Es besteht die Gefahr, dass die Meinungen, Verhaltensweisen und Bewusstseinsinhalte, die sich in einzelnen Protokollen straffällig Gewordener niederschlagen, übergeneralisiert und für ein ganzes Milieu als typisch oder zumindest als nicht unüblich befunden werden, obgleich die Aussage in einem atypischen Rahmen, nämlich vor Gericht, und von möglicherweise atypischen Personen gewonnen wurde. Es gilt also sorgsam abzuwägen, wie weitreichend eine allgemeine Aussage über ein Milieu oder über die rurale Volkskultur auf dieser Basis sein kann. Ganz sicher darf von einem isolierten exemplarisch wieder aufgerollten Fall – wie dies hier im Folgenden geschehen soll - kein revidierter Blick auf eine soziale Schicht erwartet werden. Trotzdem kann diese Revision von Gerichtsakten im Zusammenspiel mit anderen quellenfundierten Beiträgen und unter Abgleich mit bekannten Fakten ein wirklichkeitsgetreueres historisches Bild vom Leben eines schriftunkundigen Milieus liefern.
Ein Problem anderer Art bildet die Interpretation der wieder aufgerollten Untersuchung. Der Interpret neigt absichtslos dazu, einen Fall in seinem Sinn, also innerhalb seiner bekannten Kategorien auszulegen. Kurz ausgedrückt: Er findet das, wonach er sucht. Und er übersieht womöglich, was darzustellen lohnend wäre. Er begibt sich in einen circulus vitiosus, bei dem in der Annahme auch schon der Beweis enthalten ist. Es scheint deshalb geboten, den im Folgenden wieder aufgerollten Fall möglichst präzise vorzustellen, um dem Leser selbst die Gelegenheit zu geben, die vom Verfasser gezogenen Schlüsse nachzuvollziehen oder, wenn nötig, bei der Lektüre zu anderen Schlüssen zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Ziel der Untersuchung.
- Die Quellen.....
- Unzucht, Ehe, Ehebruch und Bigamie.....
- Der Ort des Prozesses...
- Der Fall Johann Georg Sept......
- Die Vorgeschichte....
- Das Delikt………..\li>
- Der Prozess.
- Das Urteil....
- Bewertung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Fallstudie befasst sich mit dem Unzuchts- und Bigamiefall Johann Georg Sept, der 1803 vor dem Patrimonialgericht in Brunn verhandelt wurde. Ihr Ziel ist es, einen quellenfundierten Beitrag zur Erforschung der Lebensweise und Lebensgewohnheiten niederer sozialer Schichten im ländlichen fränkischen Raum zu liefern.
- Die Rolle von Prozessakten als Quelle für das Leben und die Lebensgewohnheiten des ländlichen, analphabetischen Milieus
- Die Interpretation von Quellendokumenten und die Gefahr der Überverallgemeinerung
- Der Wandel des Eherechts in der frühen Neuzeit
- Die Bedeutung der Ehe als Zweckgemeinschaft im ländlichen Raum
- Die Komplexität der Verflechtung von sozialem, rechtlichem und religiösem Kontext im untersuchten Fall
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Zielsetzung der Untersuchung und die Herausforderungen, die sich aus der Interpretation von Quellen aus einem weitgehend analphabetischen Milieu ergeben.
Kapitel zwei widmet sich der Quelle des Falles, den Akten des Pückler-Limpurgischen-Archivs, und gibt Aufschluss über die vorhandenen Dokumente, wie Briefe, Protokolle, Berichte und Urteile.
Kapitel drei beleuchtet den Wandel des Eherechts in der frühen Neuzeit und die Rolle der Ehe als Zweckgemeinschaft im ländlichen Raum.
Kapitel vier beschreibt den Ort des Prozesses, das Patrimonialgericht in Brunn.
Kapitel fünf widmet sich dem Fall Johann Georg Sept, seiner Vorgeschichte, dem Delikt, das ihm zur Last gelegt wird, und dem Prozessverlauf.
Schlüsselwörter
Die Fallstudie thematisiert die Bereiche Unzucht, Bigamie, Ehe, Ehebruch, Patrimonialgericht, Lebensweise, Lebensgewohnheiten, ländlicher Raum, frühe Neuzeit, Quellenkritik, Quelleninterpretation, soziale Schichten, fränkische Geschichte, fränkische Landesgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es im Fall Johann Georg Sept von 1803?
Es handelt sich um einen Kriminalfall wegen Unzucht und Bigamie, der vor einem fränkischen Patrimonialgericht verhandelt wurde und Einblicke in das Leben niederer sozialer Schichten gibt.
Warum sind Gerichtsakten für die historische Forschung so wichtig?
Da das rurale Milieu oft analphabetisch war, sind Prozessprotokolle eine der wenigen Quellen, die die Aussagen und Lebensweisen dieser Menschen widerspiegeln.
Was war die Bedeutung der Ehe im ländlichen Raum um 1800?
Die Ehe wurde primär als ökonomische Zweckgemeinschaft gesehen, die für das Überleben im bäuerlichen und handwerklichen Umfeld notwendig war.
Welche Gefahren gibt es bei der Interpretation solcher Quellen?
Es besteht die Gefahr der Überverallgemeinerung, da Aussagen vor Gericht oft in einer atypischen Zwangssituation gemacht wurden und nicht zwingend den Alltag repräsentieren.
Was ist ein Patrimonialgericht?
Ein Gericht, das von einem Grundherrn (Adeligen) in seinem Herrschaftsbereich unterhalten wurde, bevor die staatliche Justiz vereinheitlicht wurde.
- Quote paper
- Markus Wawrzynek (Author), 2002, Der Unzuchts- und Bigamiefall Johann Georg Sept 1803, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19087