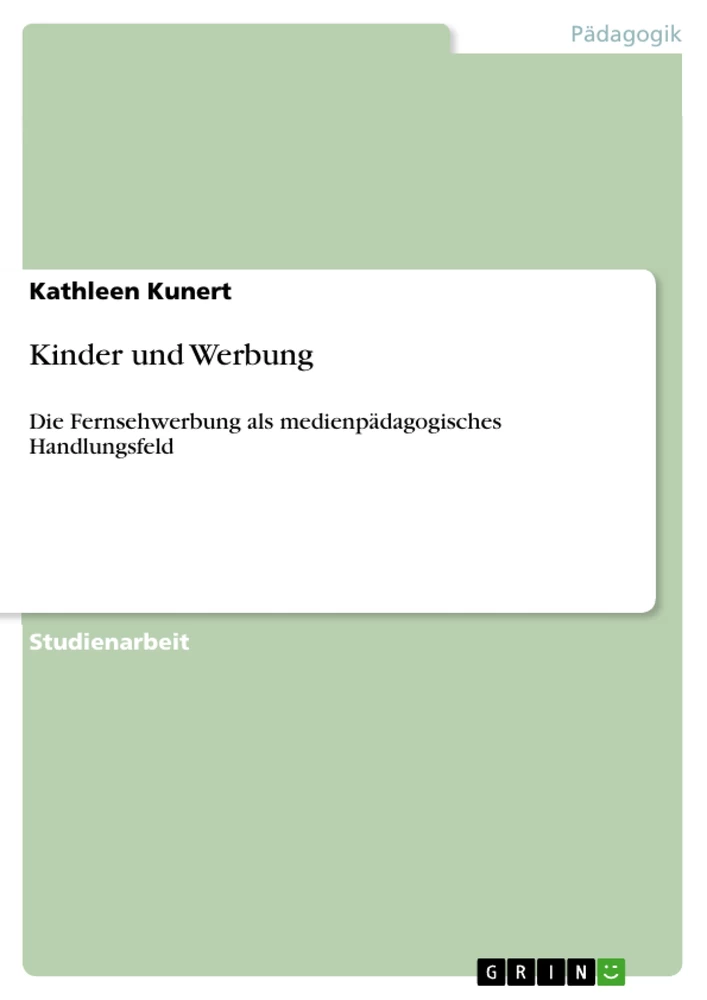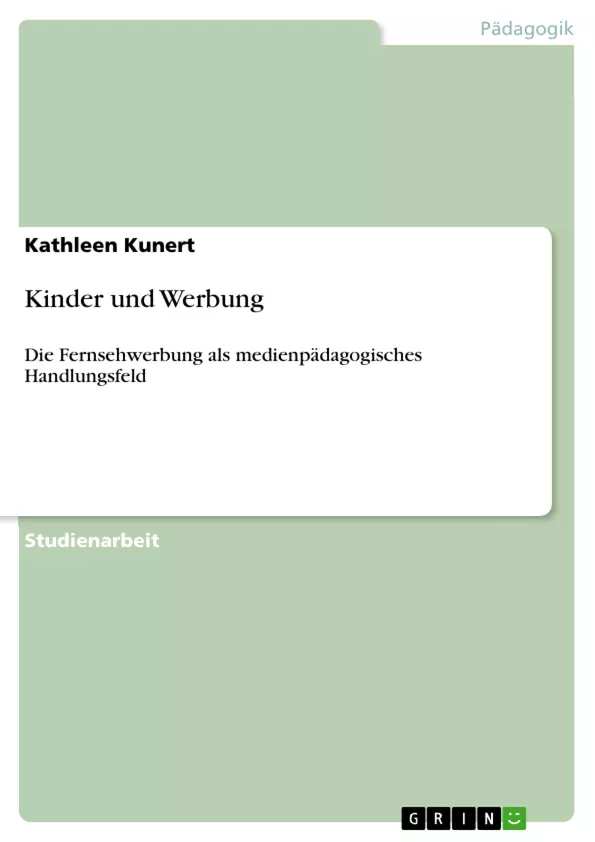Medien gehören neben Familie, Schule und peer groups in der heutigen modernen Informationsgesellschaft zu einer wichtigen Sozialisationsinstanz. In diesem Rahmen kommt es vermehrt zu Werbeeinblendungen, die sich speziell an Kinder richten und denen Eltern und Pädagogen kritisch gegenüber stehen. Kinder lassen sich von bunten Bildern und lauten Klängen faszinieren und manipulieren. Inwieweit das kindliche Publikum Werbebilder durchschaut, soll in vorliegender Arbeit thematisiert werden. Speziell wird darauf eingegangen, wie Kinder gegenüber Werbung eingestellt sind, wie sie Werbebilder verstehen und erleben bzw. was sie sich für die eigene Ausformung ihrer Persönlichkeit aus der Werbung herausfiltern (Kap. 5). Nachdem die Notwendigkeit medien- und konsumpädagogischer Arbeit ausführlich dargelegt wurde, werden Lösungsvorschläge hinsichtlich der Vermittlung von Werbekompetenz aufgezeigt. Hierbei sollen Anregungen für einen didaktisch wertvollen Schulunterricht auf der Grundlage von Materialen des Vereins Media Smart gegeben werden. (Kap. 6) Neben den erzieherischen Institutionen Schule und Kindergarten wird im Schlussteil der entscheidende Einfluss der Familie bei der Heranbildung eines kritischen und werbekompetenten Konsumenten bewusst gemacht. (Kap. 7)
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Definition des Begriffs Werbung
- Kinder als beliebte Zielgruppe
- Notwendigkeit medienpädagogischer Arbeit bei Kindern
- Der Charakter von Werbespots
- Einstellung der Kinder zur Werbung
- Das kindliche Erleben von Fernsehbildern
- Fehlendes Fernseh- und Werbeverständnis
- Identitätsstiftung und Markenbindung durch Werbung
- Vermittlung von Werbekompetenz
- Anregungen für den Unterricht: „Augen auf Werbung“
- Werbe- und konsumpädagogische Erwachsenenbildung
- Wertevermittlung
- Werbewirkungen
- Geschlechtsspezifische Rollen
- Kaufwünsche
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das medienpädagogische Spannungsfeld "Kinder und Werbung". Sie beleuchtet die Notwendigkeit medienpädagogischer Arbeit im Umgang mit Werbung und stellt Lösungsvorschläge für erzieherische Institutionen vor, mit deren Hilfe Werbe- und Konsumkompetenz erfolgreich vermittelt werden können.
- Die Bedeutung von Werbung in der modernen Informationsgesellschaft
- Die Rolle des Fernsehens als Medium der Werbung
- Die Anfälligkeit von Kindern für Werbebotschaften
- Die Notwendigkeit der Vermittlung von Werbekompetenz
- Lösungsansätze für die Bewältigung des medienpädagogischen Problems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema "Kinder und Werbung" und beleuchtet die Bedeutung von Medien in der heutigen Gesellschaft. Anschließend wird die Definition des Begriffs "Werbung" erläutert und die besondere Anfälligkeit von Kindern als Zielgruppe hervorgehoben. Das Kapitel "Notwendigkeit medienpädagogischer Arbeit bei Kindern" untersucht die Wirkungsweise von Werbespots auf Kinder, die Einstellung von Kindern zur Werbung, ihr Verständnis von Fernsehbildern und die Notwendigkeit der Vermittlung von Werbekompetenz. Es werden auch die Herausforderungen für Eltern und Pädagogen bei der Gestaltung eines werbekompetenten Umfelds für Kinder beleuchtet. Das Kapitel "Vermittlung von Werbekompetenz" liefert konkrete Vorschläge für die Vermittlung von Werbekompetenz in Schule und Kindergarten und stellt die Rolle der Familie bei der Entwicklung eines kritischen und werbekompetenten Konsumenten heraus. Schließlich werden Werbe- und Konsumpädagogische Erwachsenenbildung in der Arbeit beleuchtet, wobei der Fokus auf die Themen Wertevermittlung, Werbewirkungen, geschlechtsspezifische Rollen und Kaufwünsche liegt.
Schlüsselwörter
Medienpädagogik, Kinder, Werbung, Fernsehwerbung, Werbekompetenz, Konsumkompetenz, Mediennutzung, Medienbildung, Werbewirkung, Werbeverständnis, Medienkompetenz, Identitätsstiftung, Markenbindung, Erwachsenenbildung, Wertevermittlung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Kinder eine so beliebte Zielgruppe für die Werbeindustrie?
Kinder sind leicht durch bunte Bilder und Klänge zu faszinieren und entwickeln früh Markenbindungen, die ihre Identität prägen können.
Was versteht man unter „Werbekompetenz“ bei Kindern?
Es ist die Fähigkeit, Werbebotschaften kritisch zu hinterfragen, deren manipulative Absicht zu erkennen und bewusst mit Konsumwünschen umzugehen.
Welche Rolle spielt das Fernsehen in diesem Zusammenhang?
Das Fernsehen ist ein Hauptmedium für Werbung, bei dem Kinder oft Schwierigkeiten haben, zwischen Programm und Werbeeinblendung zu unterscheiden.
Wie können Schulen die Werbekompetenz fördern?
Durch didaktisch wertvollen Unterricht, zum Beispiel mit Materialien des Vereins Media Smart („Augen auf Werbung“), können Kinder geschult werden.
Welchen Einfluss hat die Familie auf das Konsumverhalten?
Die Familie ist die entscheidende Instanz für die Wertevermittlung und die Heranbildung eines kritischen, werbekompetenten Konsumenten.
- Quote paper
- Kathleen Kunert (Author), 2008, Kinder und Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190930