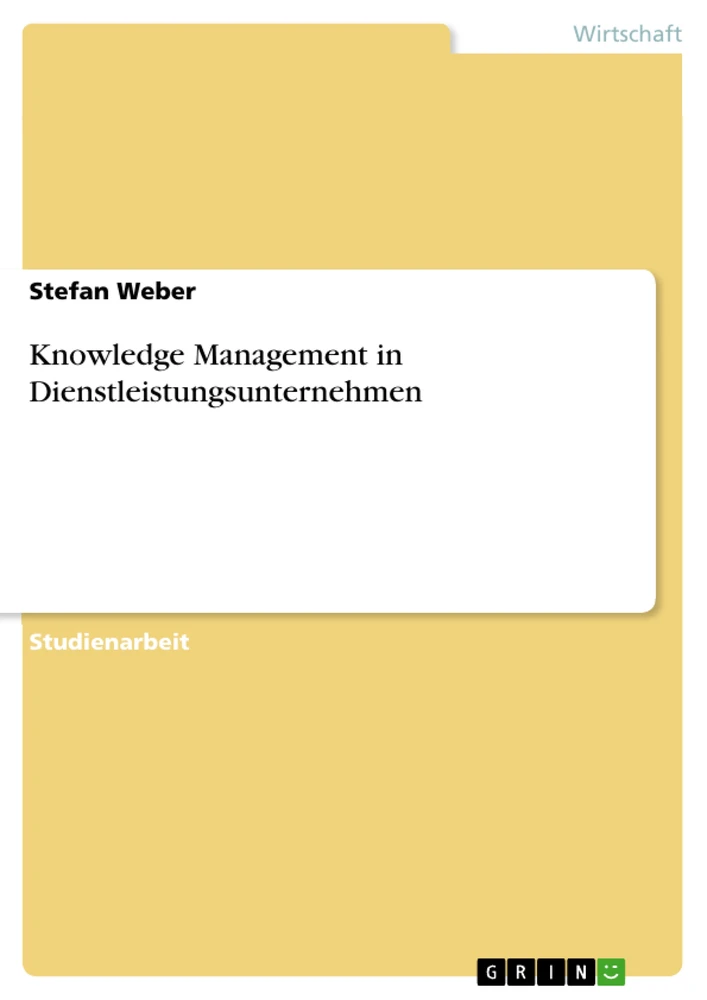1. Vorbemerkung
Zu Beginn dieser Arbeit stand die Frage nach entsprechenden Definitionen
Als nächsten Schritt führte ich die Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen für Knowledge Management
Daraufhin beschäftigte ich mich mit der Frage der Notwendigkeit von respektive für KM.
Im letzten Schritt schließlich kam ich zu dem Punkt Überlegungen bezüglich der Umsetzung und Einbindung von KM anzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Was sind Dienstleistungsunternehmen?
- Differenzierung in prozessgetrieben und projektgetrieben
- Prozeß
- Projekt
- Zusammenführung Prozeß und Projekt
- Was ist Wissen?
- Was ist Knowledge Management?
- Umsetzung und Einbindung von KM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des Knowledge Management im Kontext von Dienstleistungsunternehmen. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Wissenstransfer, der Wissenserarbeitung und der Wissensnutzung in diesem spezifischen Sektor einhergehen.
- Definition und Abgrenzung von Dienstleistungsunternehmen
- Bedeutung von Wissen und Knowledge Management in Dienstleistungsunternehmen
- Relevanz von Prozess- und Projektorientierung im Kontext von Knowledge Management
- Verschiedene Ansätze und Modelle des Knowledge Management
- Praktische Implementierung und Integration von Knowledge Management in Dienstleistungsunternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkung
Das erste Kapitel stellt die Grundfrage nach Definitionen von Knowledge Management und den Voraussetzungen für dessen erfolgreiche Umsetzung dar. Es skizziert die Problematik und die Notwendigkeit von Knowledge Management in Dienstleistungsunternehmen.
2. Was sind Dienstleistungsunternehmen?
Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Dienstleistung" und unterscheidet verschiedene Arten von Dienstleistungsunternehmen. Es beleuchtet die spezifischen Merkmale von Dienstleistungen, die sie von materiellen Gütern abgrenzen. Zudem wird auf die Unterscheidung zwischen prozess- und projektgetriebenen Dienstleistungsunternehmen eingegangen.
3. Was ist Wissen?
Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Aspekte von Wissen und dessen Bedeutung für Unternehmen beleuchtet.
4. Was ist Knowledge Management?
Kapitel vier beschäftigt sich mit dem Konzept des Knowledge Management und seinen verschiedenen Facetten. Es analysiert die Definition von Knowledge Management aus der Sicht von Sveiby und untersucht die Bausteine des Wissensmanagements.
5. Umsetzung und Einbindung von KM
Das fünfte Kapitel behandelt die praktische Umsetzung und Einbindung von Knowledge Management in Dienstleistungsunternehmen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für die Integration von KM in Unternehmensprozesse und -strukturen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Dienstleistungsunternehmen, Knowledge Management, Wissenstransfer, Wissenserarbeitung, Wissensnutzung, Prozessorientierung, Projektorientierung und die Implementierung von Knowledge Management in der Praxis. Sie untersucht die Bedeutung des Wissensmanagements für den Erfolg von Dienstleistungsunternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Knowledge Management für Dienstleister besonders kritisch?
Dienstleistungen sind oft immateriell und hängen stark vom Wissen der Mitarbeiter ab; ein effektiver Wissenstransfer sichert hier die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist der Unterschied zwischen prozess- und projektgetriebenen Unternehmen?
Prozessgetriebene Firmen setzen auf standardisierte Abläufe, während projektgetriebene Firmen (z. B. Consulting) individuelles Wissen für wechselnde Aufgaben nutzen.
Wie definiert Sveiby Knowledge Management?
Sveiby betrachtet KM als die Kunst, Wert aus den immateriellen Vermögenswerten eines Unternehmens zu schaffen, wobei die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen.
Was sind die Bausteine des Wissensmanagements?
Dazu gehören die Wissensidentifikation, der Wissenserwerb, die Wissensentwicklung, die Wissensverteilung, die Wissensnutzung und die Wissensbewahrung.
Welche Voraussetzungen müssen für erfolgreiches KM erfüllt sein?
Neben einer passenden IT-Infrastruktur ist vor allem eine Unternehmenskultur nötig, die das Teilen von Wissen fördert und belohnt.
- Citar trabajo
- Dipl.kfm. (FH) Stefan Weber (Autor), 2000, Knowledge Management in Dienstleistungsunternehmen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190961