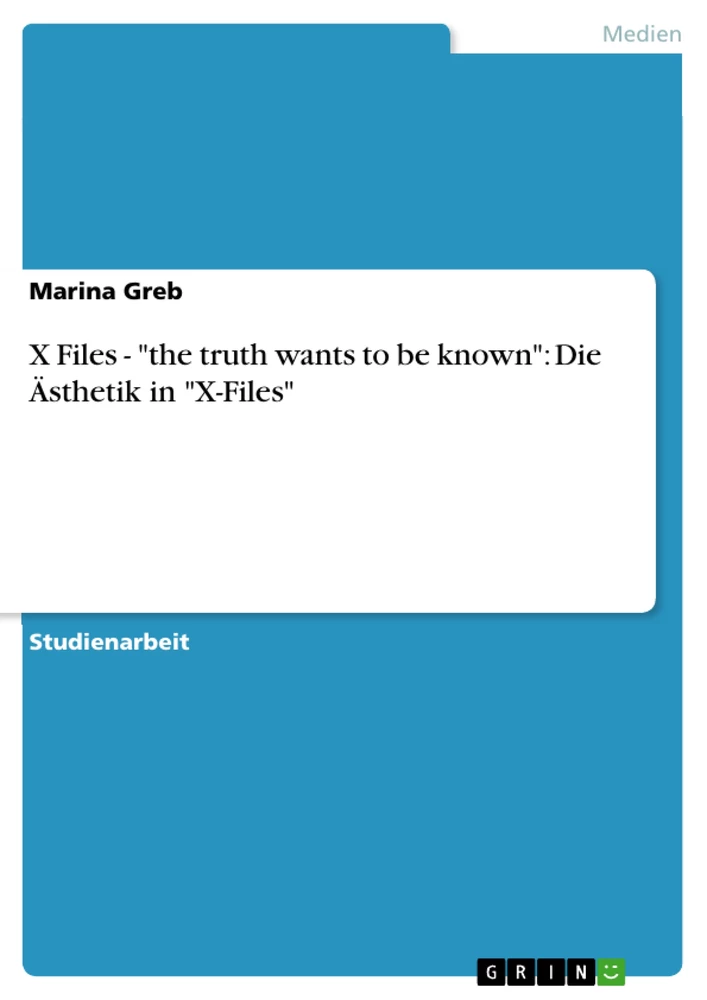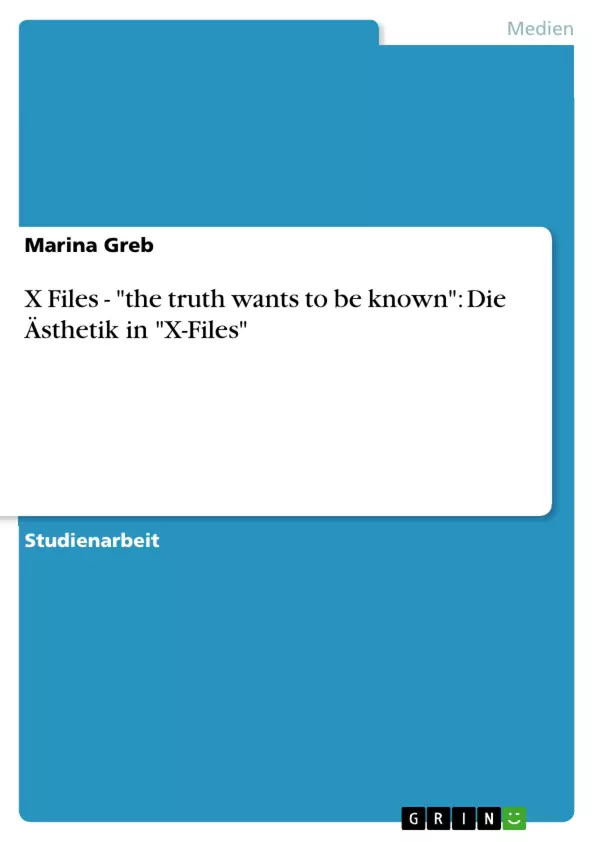Das Bedürfnis nach einem medialen Text, welches in sich die Skepsis und Misstrauen des Volkes gegenüber seiner Regierung, der „populistischen Paranoia“ , visuell aufnimmt, hat Chris Carter 1992 mit Hilfe des US-Senders FOX aufgegriffen und verarbeitet. Die resultierende Serie oszilliert in ihrem Wesen zwischen politischen Verschwörungen, metaphysischen Elementen und kriminellen Motiven, und wirkt als eine Projektion jener gesellschaftlichen Unruhen der 90-ger. Sie durchbricht die Grenze zwischen Vernunft und Glauben.
Diese Studienarbeit, beschäftigt sich mit der Serie „X- Files“, die im Rahmen des Seminars "Serienwelten lesen: Analysen der Gattungsgeschichte und Ästhetik der TV-Serie" ausführlich besprochen wurde.
Bei der Analyse dieses medialen Textes beabsichtige ich, mich an der dreigliedrigen Struktur des Referates zu orientieren. Die Studienarbeit wird die gemachten Aussagen theoretisch belegen, in dem hier die Serie dank den Arbeiten Donna Harraways und Laura Mulveys neu beleuchtet wird. Hinzufügen ist noch Folgendes: der Ausgangspunkt für die Analysen werden die beiden FBI- Agenten Mulder und Scully sein, die Nachfolger dieser zwei Hauptdarstelle Doggett und Reyes werden ausgelassen, da der Austausch der Schauspieler eine implizite Änderung des Charakters der Serie bewirkte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Third man: Are you familiar with the so-called \"X-Files?\" - SCULLY: I believe they have to do with unexplained phenomena.³
- Fakten über “X Files”
- Plot
- SCULLY: Do you have a theory?- MULDER: I have plenty of theories. - Narrative Strukturen..
- Genrehybridisierung
- Motive
- Visuelle Inszenierung..
- THIRD MAN: Are you familiar with an agent named Fox Mulder? - SCULLY: Yes, I am.- Protagonisten
- Kulturhistorische Situierung
- Subtexte...
- Donna Harraways Cyborg-Metaphorik
- Dekonstruktion des „,,male gaze\".
- MULDER: Were you able to arrange an examination facility? Interpretation und Deutung......
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Serie „X-Files“, die im Rahmen des Seminars am 8. Juni 2010 ausführlich besprochen wurde. Die Arbeit analysiert die Serie anhand der Figuren Mulder und Scully, mit dem Ziel, die Serie anhand der Arbeiten Donna Harraways und Laura Mulveys neu zu beleuchten.
- Die Serie „X-Files“ als Projektion der gesellschaftlichen Unruhen der 90er Jahre, die die Grenze zwischen Vernunft und Glauben durchbricht.
- Die Analyse der „X-Files“ als medialer Text, der die Skepsis und das Misstrauen des Volkes gegenüber seiner Regierung, die „populistische Paranoia“, visuell aufnimmt.
- Die Untersuchung der Serie im Kontext der Genrehybridisierung, die Elemente von politischen Verschwörungen, metaphysischen Elementen und kriminellen Motiven vereint.
- Die Analyse der Figuren Mulder und Scully als komplementäres Duo, das die verschiedenen Seiten der Wahrheit repräsentiert.
- Die Anwendung von Donna Harraways Cyborg-Metaphorik und Laura Mulveys „male gaze“ auf die Serie, um die genderpolitischen Dimensionen der Serie zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Serie "X-Files" und die Zielsetzung der Arbeit ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Fakten über "X Files", einschließlich des Erfolgs der Serie, der Produktionsgeschichte und des Formats. Der dritte Abschnitt untersucht die narrativen Strukturen der Serie, einschließlich der Genrehybridisierung, der Motive und der visuellen Inszenierung. Das vierte Kapitel analysiert die Protagonisten Mulder und Scully, während das fünfte Kapitel die kulturhistorische Situierung, die Subtexte, Donna Harraways Cyborg-Metaphorik und die Dekonstruktion des "male gaze" untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der "X-Files", wie politische Verschwörungen, metaphysische Elemente, Genrehybridisierung, Donna Harraways Cyborg-Metaphorik, Laura Mulveys "male gaze", und die Analyse der Figuren Mulder und Scully.
Häufig gestellte Fragen
Was spiegelt die Serie „X-Files“ gesellschaftlich wider?
Die Serie reflektiert die „populistische Paranoia“ der 90er Jahre – das Misstrauen der Bürger gegenüber der Regierung und die Grenze zwischen Vernunft und Glauben.
Warum werden nur Mulder und Scully in der Analyse berücksichtigt?
Die Nachfolger Doggett und Reyes werden ausgelassen, da der Austausch der Hauptdarsteller den grundlegenden Charakter und die Ästhetik der Serie implizit veränderte.
Wie wird Donna Harraways Cyborg-Metaphorik auf die Serie angewendet?
Die Arbeit nutzt Harraways Konzepte, um die Grenzen zwischen Mensch, Maschine und Außerirdischem sowie die Rollenbilder innerhalb der Serie neu zu beleuchten.
Was bedeutet die Dekonstruktion des „male gaze“ in Bezug auf Scully?
Unter Rückgriff auf Laura Mulvey wird untersucht, wie die Figur der Dana Scully traditionelle männliche Blickmuster und Rollenverteilungen in Thriller-Serien durchbricht.
Welche Genres werden in „X-Files“ kombiniert?
Die Serie ist ein Hybrid aus politischem Verschwörungsthriller, metaphysischem Horror und klassischen kriminologischen Motiven.
- Citation du texte
- Marina Greb (Auteur), 2010, X Files - "the truth wants to be known": Die Ästhetik in "X-Files", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191006