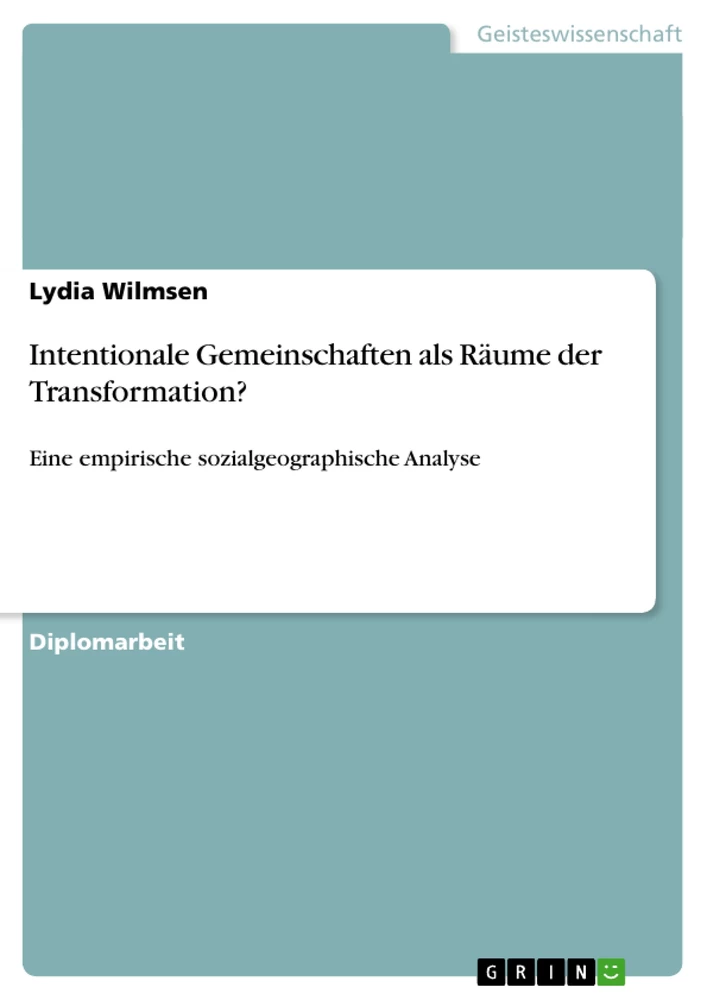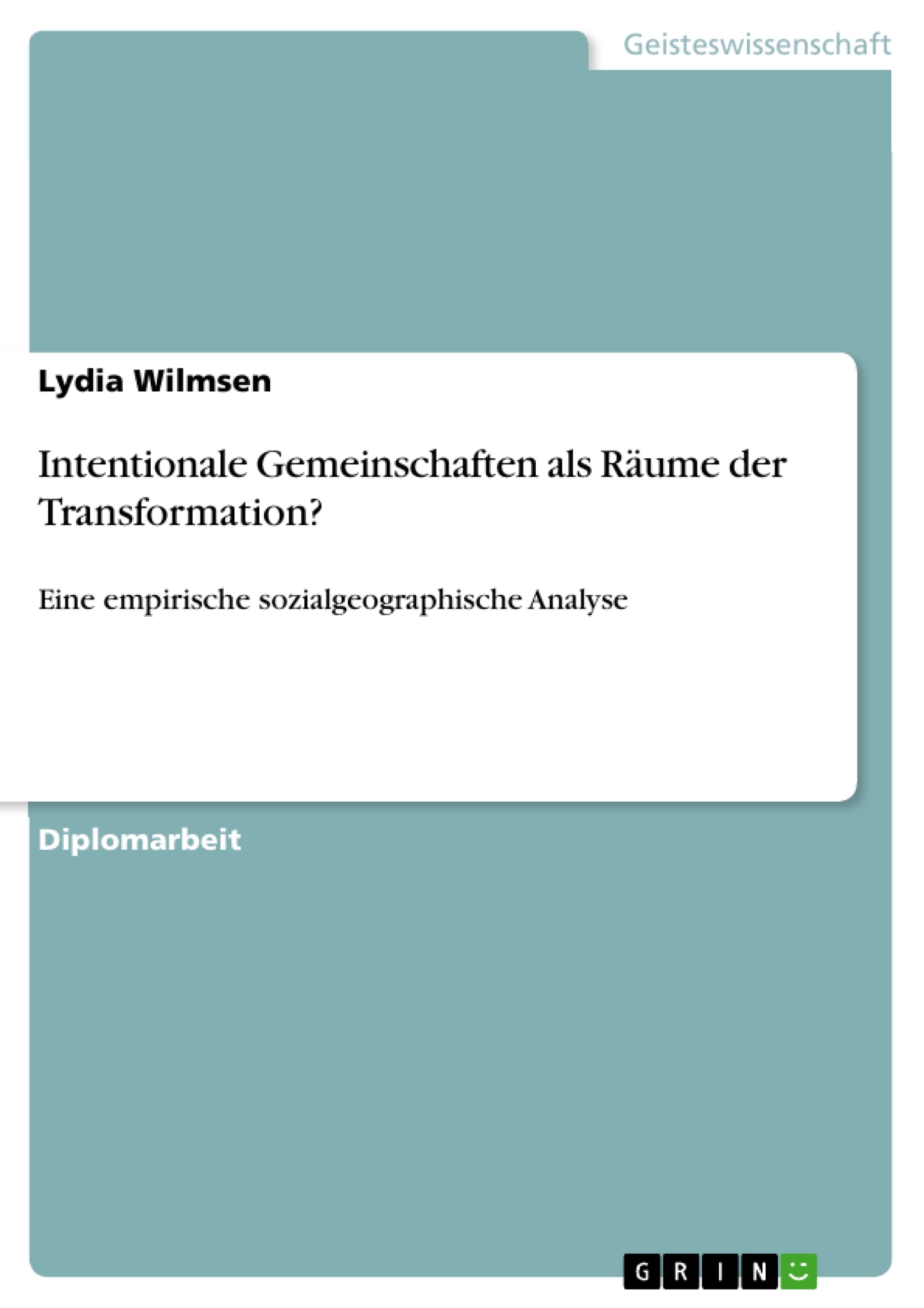Wandel und Veränderung gehen oftmals von wenigen Menschen und kleinen Gruppen aus. Als Idealisten, Pioniere und Querdenker mit starkem Willen, hoher Energie und Leidenschaft, beschreiten sie neue Wege, häufig auch gegen den Widerstand in ihrer Umgebung. Viele dieser ehemals kleinen und unbekannten Gruppen entwickeln sich später zu Massenbewegungen. In diesem Sinne beschäftigt sich auch diese Arbeit mit einem scheinbaren Randphänomen, nämlich mit neueren Gemeinschaftsbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hierin wird dafür plädiert, ihnen trotz ihrer mengenmäßigen Vernachlässigbarkeit entsprechende Relevanz zuzusprechen. Wachsende ökonomische, ökologische und soziale Unsicherheiten und dazu die Ablehnung und Missbilligung des Umgangs mit Mensch und Natur lassen die Menschen nach Alternativen in jenen Bereichen suchen und mit neuen Lebensweisen experimentieren. Auch das Erreichen eines bestimmten Lebensstandards und damit die weitgehende Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse – Deutschland zählt zu den größten Volkswirtschaften dieser Welt und verfügt über ausgeprägte soziale
Sicherungssysteme – veranlasst Menschen, sich verstärkt die Frage nach Lebenssinn, Transformation und transzendentalen Themen zu stellen und in Folge dessen nach alternativen Lebensmodellen zu suchen. Gemeinschaften bieten daher auf verschiedenen Ebenen Anknüpfungspunkte. Einerseits stellen sie Möglichkeiten dar, die Grundbedürfnisse, die in der Gesellschaft nicht mehr ausreichend gesichert werden, in einem anderen sozialen Kontext zur
Verfügung zu stellen. Sie propagieren eine weitgehend ökologische Lebensweise, experimentieren mit alternativen ökonomischen Modellen und legen Wert auf soziales Miteinander und wertschätzende Kommunikation. Andererseits bieten sie denjenigen, die auf der Suche nach
Möglichkeiten der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung sind, eine Lebensform, in der dafür bewusst Freiräume geschaffen werden.
Alternative Lebensweisen, subsumiert unter dem Überbegriff der intentionalen Gemeinschaften, sind sozialpsychologische Experimentierfelder mit Modellcharakter. Der Ansatz, sowohl auf der ökologischen als aber auch gerade auf der sozialpsychologischen Ebene grundlegend neue und visionäre Wege zu gehen, die Ausstrah-
lungseffekte in die Gesellschaft haben können, machen solche Gemeinschaften in ihrem Mikrokosmos zu interessanten Forschungsprojekten unserer Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Erkenntnisinteresse und forschungsleitende Fragen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Intentionale Gemeinschaften
- 2.1 Historischer Überblick
- 2.2 Begriffsklärung 'Intentionale Gemeinschaft'
- 2.3 Vorstellung der untersuchten Gemeinschaften
- 2.3.1 Lebensgarten Steyerberg
- 2.3.2 ZEGG
- 2.3.3 Stamm der Likatier
- 3 Erkenntnistheoretischer Hintergrund
- 3.1 Weshalb Theorie?
- 3.2 (Post-)Strukturalistisches Grundverständnis
- 3.2.1 Strukturalismus
- 3.2.2 Poststrukturalismus
- 3.3 Theoretischer Aufbau dieser Arbeit
- 3.3.1 Performativität als diskursive Praxis
- 3.3.1.1 Grundgedanken einer performativen Perspektive
- 3.3.1.2 Die poststrukturalistische Sicht der Performativität auf das Subjekt
- 3.3.2 Konzept der Heterotopien
- 3.3.2.1 Heterotopien nach Foucault
- 3.3.2.2 Intentionale Gemeinschaft als Heterotopie
- 3.3.3 Konzept der Liminalität
- 3.3.3.1 Liminalität und Communitas
- 3.3.3.2 Intentionale Gemeinschaften als Ort kollektiver Liminalität
- 3.4 Brückenschlag zwischen den Theorien
- 4 Untersuchungsdesign und Arbeitsmethodik
- 4.1 Methodologische Vorüberlegungen
- 4.2 Forschungsablauf
- 4.3 Qualitativer Forschungsansatz
- 5 Empirische Ergebnisse
- 5.1 Sprachliche Rahmen von Gemeinschaft und Gesellschaft
- 5.2 Welche Rituale konstituieren den Gegenraum?
- 5.3 Welches Werteverhalten kann in diesem Gegenraum entstehen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht intentionale Gemeinschaften als mögliche Räume der Transformation. Das Ziel ist es, anhand empirischer Daten sozialgeographischer Forschung zu analysieren, inwiefern diese Gemeinschaften alternative Lebensweisen und Wertevorstellungen praktizieren und ob sie tatsächlich transformative Prozesse befördern.
- Begriff und Geschichte intentionaler Gemeinschaften
- Theorien der Performativität, Heterotopien und Liminalität
- Qualitative Forschungsmethodik und deren Anwendung
- Analyse sprachlicher Praktiken und Rituale in den Gemeinschaften
- Untersuchung der in den Gemeinschaften entwickelten Werte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, stellt die Problemstellung und das Erkenntnisinteresse dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beschreibt den Forschungsansatz und die Forschungsfragen, die die Arbeit leiten werden.
2 Intentionale Gemeinschaften: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über intentionale Gemeinschaften, klärt den Begriff und stellt die drei untersuchten Gemeinschaften – Lebensgarten Steyerberg, ZEGG und Stamm der Likatier – vor. Es bietet einen Kontext für die spätere Analyse, indem es die Vielfalt und die Eigenheiten dieser Gemeinschaftsformen beleuchtet.
3 Erkenntnistheoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es begründet die Wahl eines (post-)strukturalistischen Ansatzes und erläutert die Konzepte der Performativität, Heterotopien und Liminalität. Der Brückenschlag zwischen diesen Theorien bildet die methodologische Basis für die Analyse der empirischen Daten.
4 Untersuchungsdesign und Arbeitsmethodik: Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen. Es rechtfertigt die Wahl eines qualitativen Forschungsansatzes, detailliert die angewendeten Methoden (problemzentrierte und narrative Interviews), und erläutert die Schritte der Datenanalyse (Transkription, Kodierung, Interpretation). Der Fokus liegt auf der Begründung und Transparenz des gewählten methodischen Designs.
5 Empirische Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es analysiert die sprachlichen Praktiken und Rituale innerhalb der untersuchten Gemeinschaften und deren Beziehung zu vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werten. Die Analyse fokussiert auf die Konstruktion von Gegenräumen und die Entwicklung alternativer Werte in diesen Räumen.
Schlüsselwörter
Intentionale Gemeinschaften, Transformation, qualitative Sozialgeographie, (Post-)Strukturalismus, Performativität, Heterotopien, Liminalität, Gegenraum, Lebensgarten Steyerberg, ZEGG, Stamm der Likatier, narrative Interviews, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Intentionale Gemeinschaften als Räume der Transformation
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht intentionale Gemeinschaften und analysiert, inwieweit diese alternative Lebensweisen und Wertevorstellungen praktizieren und transformative Prozesse fördern. Sie konzentriert sich auf drei konkrete Gemeinschaften: Lebensgarten Steyerberg, ZEGG und Stamm der Likatier.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie intentionale Gemeinschaften alternative Lebensweisen und Wertevorstellungen praktizieren und ob sie tatsächlich transformative Prozesse befördern. Sie analysiert sprachliche Praktiken, Rituale und die Entwicklung von Werten in diesen Gemeinschaften im Vergleich zu vorherrschenden gesellschaftlichen Normen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen (post-)strukturalistischen Ansatz und bezieht die Konzepte der Performativität, Heterotopien und Liminalität in die Analyse ein. Diese Konzepte bilden die methodologische Basis für die Interpretation der empirischen Daten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen qualitativen Forschungsansatz mit problemzentrierten und narrativen Interviews. Die Datenanalyse umfasst Transkription, Kodierung und Interpretation der Interviews.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Intentionale Gemeinschaften (mit historischem Überblick und Vorstellung der untersuchten Gemeinschaften), Erkenntnistheoretischer Hintergrund (mit Erläuterung der theoretischen Konzepte), Untersuchungsdesign und Arbeitsmethodik (Beschreibung der Methoden) und Empirische Ergebnisse (Präsentation und Analyse der Daten).
Welche Gemeinschaften wurden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei intentionale Gemeinschaften: den Lebensgarten Steyerberg, das ZEGG und den Stamm der Likatier.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Intentionale Gemeinschaften, Transformation, qualitative Sozialgeographie, (Post-)Strukturalismus, Performativität, Heterotopien, Liminalität, Gegenraum, Lebensgarten Steyerberg, ZEGG, Stamm der Likatier, narrative Interviews, Diskursanalyse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirischen Ergebnisse analysieren die sprachlichen Praktiken und Rituale in den untersuchten Gemeinschaften und deren Beziehung zu gesellschaftlichen Normen und Werten. Der Fokus liegt auf der Konstruktion von Gegenräumen und der Entwicklung alternativer Werte.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, anhand empirischer Daten zu analysieren, inwieweit intentionale Gemeinschaften alternative Lebensweisen und Wertevorstellungen praktizieren und transformative Prozesse befördern.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Sozialgeographie, qualitativer Forschung, (post-)strukturalistischen Theorien, intentional Gemeinschaften und Transformationsforschung beschäftigen.
- Citar trabajo
- Lydia Wilmsen (Autor), 2011, Intentionale Gemeinschaften als Räume der Transformation?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191025