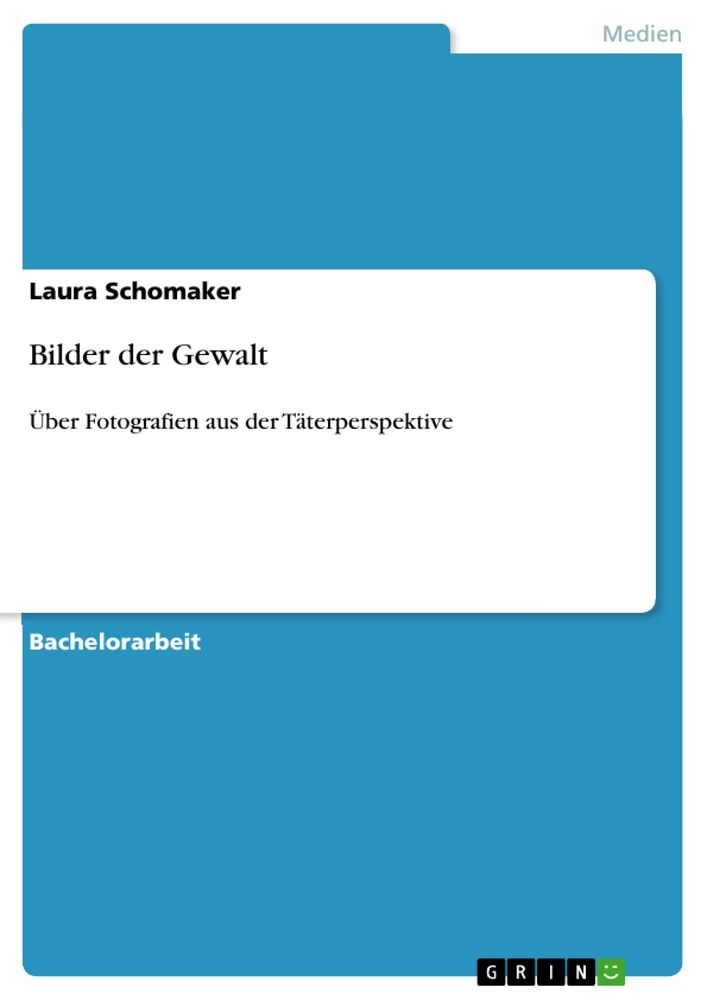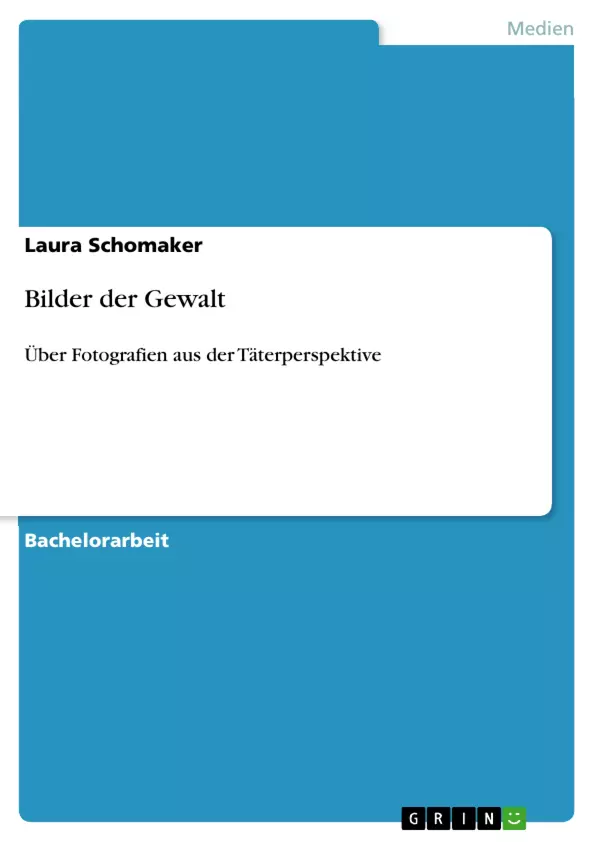Bilder der Gewalt existieren seit Menschengedenken und führen uns immer wieder eindrücklich vor Augen, wozu Menschen tatsächlich fähig sind. Denn Bilder können auf eine Art und Weise schockieren und in Erinnerung bleiben, der Worte niemals fähig wären. Fotografien scheinen dabei eine besondere Macht auf uns auszuüben, da sie als Zeugnisse von Realität gelten. Um diese Macht verstehen zu können, wird das Bild in dieser Arbeit zunächst in den Zusammenhang von Wahrnehmung und Realität gestellt. Dabei soll geklärt werden, welche Wirkung Bilder im Allgemeinen auf uns haben und warum.
Im Folgenden werden dann Fotografien von Gewaltverbrechen untersucht, die aus der Täterperspektive – also entweder von den Tätern selbst, von Mitschuldigen oder Befürwortern der Tat – aufgenommen wurden. Schließlich steckt dahinter immer eine gewisse Absicht des Fotografen und die Bilder sollen eine bestimmte Funktion erfüllen.
Dass sich diese Funktion im Laufe der Geschichte verändert hat und stets vom jeweiligen Kontext der Bilder abhängig ist, soll an vier verschiedenen Beispielen deutlich gemacht werden: an Knipser-Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg, Bildern von Lynchmorden an Afro-Amerikanern in den USA, Aufnahmen des Terroranschlags vom 11. September 2001 sowie an den Folterfotos von Abu Ghraib.
Die letzten beiden Beispiele sowie der aktuelle Bilderkrieg an sich werden weiterhin im Zusammenhang mit William J.T. Mitchells „biopictorial turn“ untersucht, der die technischen Möglichkeiten des Bildes in Verbindung mit dem doppelten Phänomen von Klonen und Terror sieht.
Zu guter Letzt setzt sich diese Arbeit mit der umstrittenen und äußerst brisanten Frage nach dem richtigen Umgang mit Gewaltbildern auseinander. Ob sie nun als Waffen fungieren und man durch ihre Betrachtung automatisch zum Komplizen der Täter wird, oder ob diese Bilder als Beweise des Unrechts gezeigt werden müssen, damit die Verbrechen nicht vertuscht werden können, bleibt zu klären.
In jedem Fall sollte man sich mit dem Phänomen von Bildern der Gewalt beschäftigen, da es leider auch heute noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und Fotografien von grausamen Verbrechen weiter verbreitet und leichter zugänglich sind als je zuvor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Macht der Bilder: Bild, Wahrnehmung und Realität
- Fotos als Trophäen und Amulette
- Knipser im Zweiten Weltkrieg
- Lynchfotografie in Amerika
- Der Krieg der Bilder: 9/11 und Abu Ghraib
- Die neue Bildaktpolitik im asymmetrischen Krieg
- Der „Biopictorial Turn\": Klonen und Terror
- Der Umgang mit den Fotos: Waffen oder Beweise?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Fotografien von Gewaltverbrechen, insbesondere aus der Täterperspektive. Sie untersucht die Macht von Bildern und ihre Fähigkeit, unsere Wahrnehmung und Realität zu beeinflussen. Die Arbeit analysiert, wie Fotografien als Trophäen und Amulette, aber auch als Waffen im Krieg eingesetzt werden können.
- Die Rolle des Bildes in der Wahrnehmung und Realität
- Die Funktion von Fotografien von Gewaltverbrechen aus der Täterperspektive
- Die Bedeutung von Bildern im Kontext des Krieges
- Die Auswirkung von Bildern auf die öffentliche Meinung
- Die ethischen und moralischen Herausforderungen im Umgang mit Gewaltbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltbilder ein und beleuchtet die Bedeutung von Fotografien als Zeugnisse der Realität. Kapitel 2 untersucht die Macht von Bildern im Zusammenhang mit Wahrnehmung und Realität. Kapitel 3 widmet sich Fotografien von Gewaltverbrechen aus der Täterperspektive, wobei anhand von Beispielen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Lynchfotografie in Amerika die Funktion von Bildern als Trophäen und Amulette herausgestellt wird. Kapitel 4 analysiert den "Krieg der Bilder" im Kontext von 9/11 und Abu Ghraib, wobei die neue Bildaktpolitik im asymmetrischen Krieg und der "Biopictorial Turn" betrachtet werden. Kapitel 5 diskutiert den Umgang mit Gewaltbildern und die Frage, ob sie als Waffen oder Beweise eingesetzt werden sollten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Gewaltbildern, Täterperspektive, Wahrnehmung, Realität, Fotografie, Trophäen, Amulette, Krieg der Bilder, asymmetrischer Krieg, 9/11, Abu Ghraib, "Biopictorial Turn", Klonen, Terror, Waffen, Beweise, ethische und moralische Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Macht haben Fotografien von Gewaltverbrechen?
Fotografien gelten als Zeugnisse der Realität und können Schockmomente erzeugen, die Worte nicht erreichen. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung und können als Trophäen oder Waffen fungieren.
Was bedeutet die Untersuchung aus der Täterperspektive?
Die Arbeit analysiert Bilder, die von Tätern, Mitschuldigen oder Befürwortern aufgenommen wurden, um eine bestimmte Absicht oder Funktion zu erfüllen, wie etwa die Selbstdarstellung oder Einschüchterung.
Welche historischen Beispiele werden in der Arbeit analysiert?
Es werden Knipser-Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg, Lynchmorde in den USA, der 11. September 2001 und die Folterfotos von Abu Ghraib untersucht.
Was ist der „biopictorial turn“ nach William J.T. Mitchell?
Dieser Begriff beschreibt die Verbindung technischer Bildmöglichkeiten mit den Phänomenen von Klonen und Terror im zeitgenössischen „Bilderkrieg“.
Sollten Gewaltbilder als Beweise oder Waffen betrachtet werden?
Die Arbeit diskutiert die ethische Frage, ob das Zeigen dieser Bilder notwendig ist, um Verbrechen zu beweisen, oder ob man durch die Betrachtung zum Komplizen der Täter wird.
- Quote paper
- Laura Schomaker (Author), 2010, Bilder der Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191058