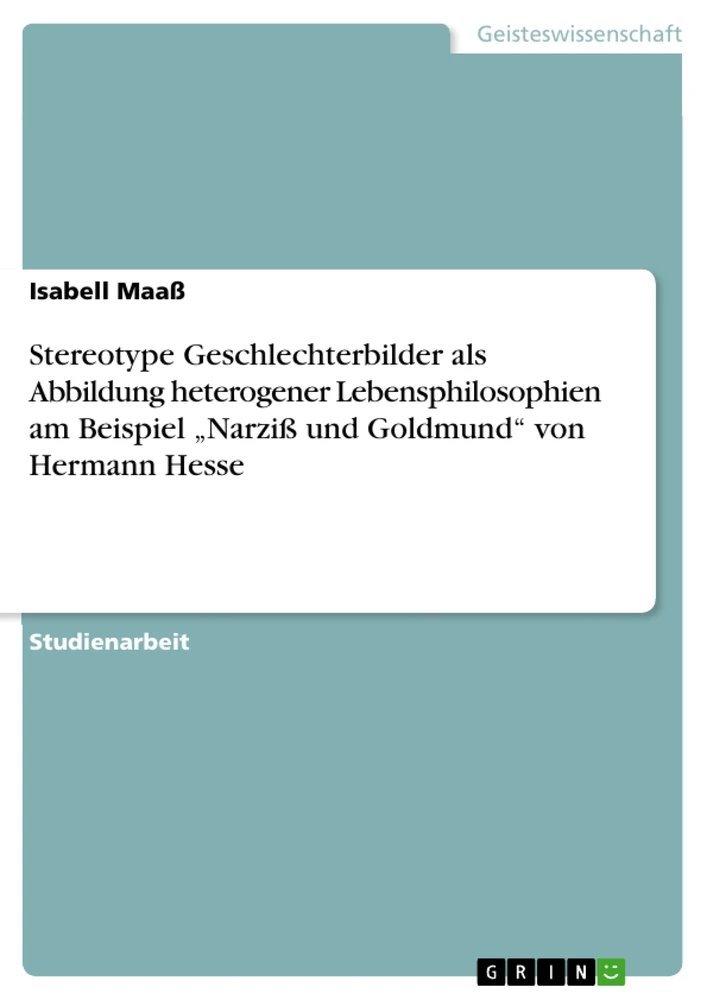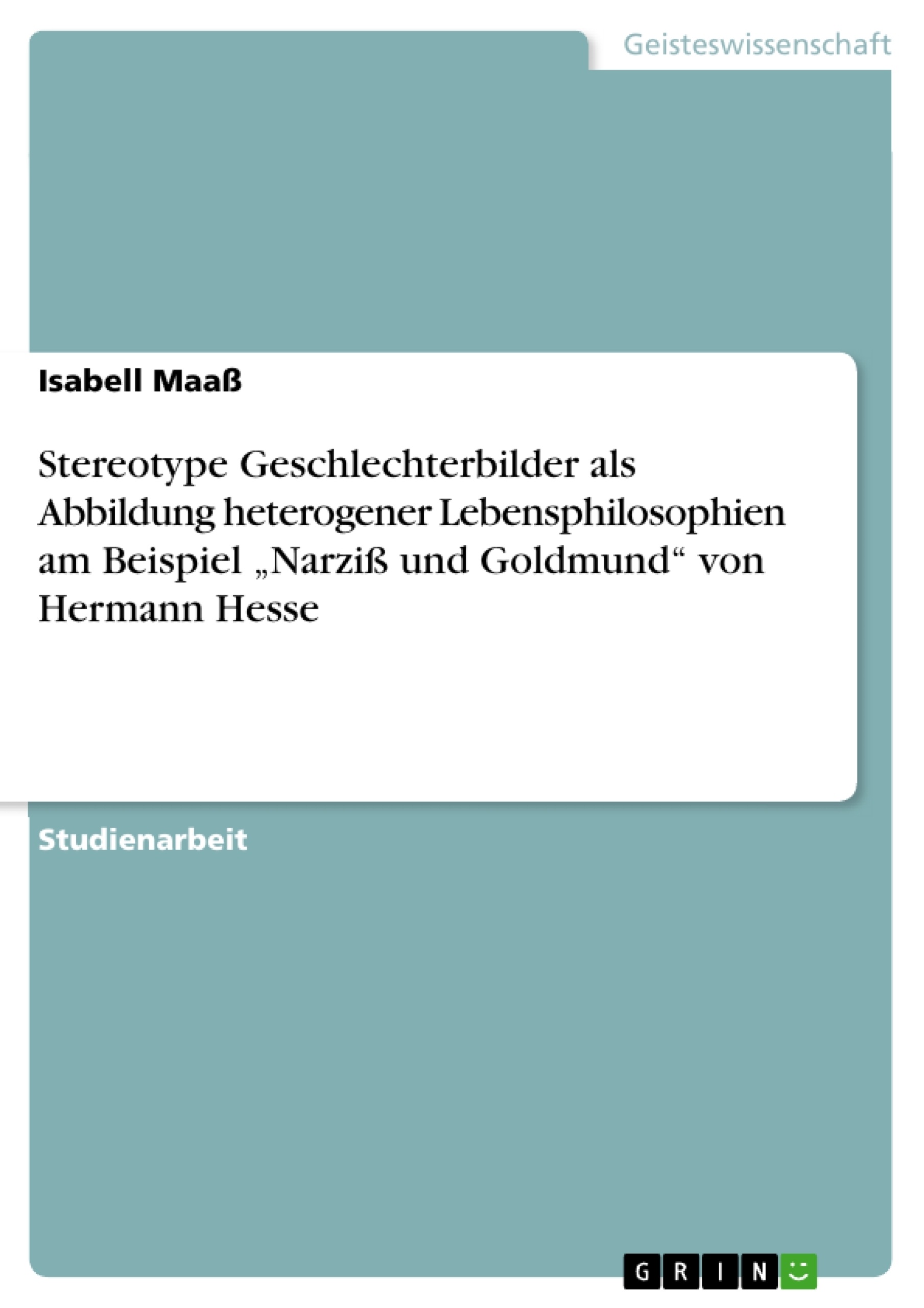Kulturelle, soziale und anatomische Unterschiede gab es schon immer zwischen den Geschlechtern. Und lange bevor die Erforschung dieser Differenzen als Wissenschaft anerkannt wurde, beschäftigten sich Menschen mit diesem Thema. Noch bevor man diese Unterschiede bewusst analysierte existierten sie. So unterteilt man die Menschen anatomisch durch ihr sexuelles Geschlecht in Männer und Frauen. In unserer Westlichen Kultur entwickelte sich aus der Annahme es gäbe nur ein anatomisches Geschlecht1 im 18. Jahrhundert ein Zweigeschlechtermodell (Thomas Laqueur). Das Problem des Ein-Geschlecht-Modells, abgesehen davon, dass es grundsätzlich falsch ist, ist die daraus einhergehende Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts und somit die unterdrückte soziale Rolle der Frau2.
[...]
1Laqueur 1996, S.16
2Laqueur 1992, S.24
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „Geschichte der Männlichkeiten“ eine kurze Buchvorstellung
- 3 Der Geschlechterbegriff
- 4 Narziß und Goldmund
- 5 Analyse
- 5.1 Geschlechterbilder bei „Narziß und Goldmund“
- 5.2 Geistmensch contra Herzmensch
- 5.3 Die Beziehung der Protagonisten
- 5.4 Lebensphilosophien
- 6 Interpretation
- 6.1 Interpretation im Rahmen der Geschlechterforschung
- 6.2 Bezüge zum historischen Kontext
- 7 Fazit
- 8 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Geschlechterrollen und den damit verbundenen Lebensphilosophien in Hermann Hesses Roman „Narziß und Goldmund“. Ausgehend von „Geschichte der Männlichkeiten“ von Martschukat und Stieglitz wird der sozial konstruierte Geschlechterbegriff analysiert. Ziel ist es, die charakterlichen Unterschiede zwischen Narziß und Goldmund zu beleuchten und deren mögliche Beziehung zum historischen Kontext zu erörtern.
- Sozial konstruierte Geschlechterrollen in „Narziß und Goldmund“
- Kontrast zwischen Geist und Herz als Ausdruck unterschiedlicher Männlichkeitsbilder
- Beziehung zwischen den Protagonisten und deren Auswirkung auf die Darstellung von Geschlechterrollen
- Einfluss des historischen Kontextes auf die Gestaltung der Geschlechterbilder
- Heterogene Lebensphilosophien als Ausdruck unterschiedlicher Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterforschung ein und erläutert die Komplexität des Geschlechterbegriffs. Sie hebt die Entwicklung des Zweigeschlechtermodells in der westlichen Kultur hervor und problematisiert die damit verbundene Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Geschlechterrollen und Lebensphilosophien in Hermann Hesses „Narziß und Goldmund“, wobei die charakterlichen Unterschiede zwischen den beiden männlichen Protagonisten im Mittelpunkt stehen. Die Frage nach dem Einfluss des sozialen Kontextes und der damaligen Gesellschaft auf die Darstellung der Geschlechterrollen wird als zentrale Forschungsfrage formuliert.
2 „Geschichte der Männlichkeiten“ eine kurze Buchvorstellung: Dieses Kapitel bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches „Geschichte der Männlichkeiten“ von Jürgen Martschukat und Olaf Stieglitz. Es beschreibt die historische Entwicklung des Forschungsfeldes der Men’s Studies und die drei zentralen Themenschwerpunkte des Buches: den Mann als Vater und Versorger, die Sozialität des Mannes in der Gesellschaft und Aspekte männlicher Sexualität. Die Autoren betonen die Relationalität der Männerforschung und die Notwendigkeit, die Forschung auf verschiedene soziale Verhältnisse und Kulturen auszuweiten, um ein umfassenderes Verständnis von Männlichkeit zu erlangen. Es wird kritisiert, dass die Forschung häufig von einer eingeschränkten Perspektive (weiße, heterosexuelle Männer der Mittelklasse) ausgeht und wichtige Aspekte vernachlässigt.
3 Der Geschlechterbegriff: Dieses Kapitel definiert den komplexen Begriff „Geschlecht“ und differenziert zwischen genetischem, gonadalem und genitalem Geschlecht. Es dient als Grundlage für die nachfolgende Analyse der Geschlechterrollen in „Narziß und Goldmund“ und stellt sicher, dass ein gemeinsames Verständnis des Begriffs innerhalb der Arbeit herrscht. Die medizinische Perspektive auf das Geschlecht wird hier als Ausgangspunkt für die spätere Auseinandersetzung mit dem sozial konstruierten Geschlecht verwendet.
Schlüsselwörter
Geschlechterrollen, Lebensphilosophien, „Narziß und Goldmund“, Hermann Hesse, Geschlechterforschung, Männlichkeiten, sozial konstruiertes Geschlecht, historischer Kontext, Geistmensch, Herzmensch.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse der Geschlechterrollen und Lebensphilosophien in Hermann Hesses 'Narziß und Goldmund'"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung von Geschlechterrollen und den damit verbundenen Lebensphilosophien in Hermann Hesses Roman "Narziß und Goldmund". Sie untersucht die charakterlichen Unterschiede zwischen Narziß und Goldmund und deren Beziehung zum historischen Kontext, ausgehend von dem Verständnis des sozial konstruierten Geschlechts, wie es in "Geschichte der Männlichkeiten" von Martschukat und Stieglitz dargestellt wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit sozial konstruierten Geschlechterrollen in "Narziß und Goldmund", dem Kontrast zwischen "Geistmensch" und "Herzmensch" als Ausdruck unterschiedlicher Männlichkeitsbilder, der Beziehung zwischen den Protagonisten und deren Einfluss auf die Darstellung von Geschlechterrollen, dem Einfluss des historischen Kontextes auf die Gestaltung der Geschlechterbilder und heterogenen Lebensphilosophien als Ausdruck unterschiedlicher Geschlechterrollen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vorstellung des Buches "Geschichte der Männlichkeiten", Definition des Geschlechterbegriffs, Analyse der Geschlechterbilder in "Narziß und Goldmund" (einschließlich der Betrachtung der Beziehung der Protagonisten und deren Lebensphilosophien), Interpretation der Ergebnisse im Rahmen der Geschlechterforschung und im historischen Kontext, Fazit und Quellenverzeichnis.
Wie wird der Geschlechterbegriff definiert?
Die Arbeit differenziert den komplexen Begriff "Geschlecht" zwischen genetischem, gonadalem und genitalem Geschlecht. Sie verwendet die medizinische Perspektive als Ausgangspunkt, um anschließend den sozial konstruierten Aspekt des Geschlechts zu analysieren.
Welche Rolle spielt "Geschichte der Männlichkeiten"?
Das Buch "Geschichte der Männlichkeiten" von Martschukat und Stieglitz dient als theoretische Grundlage. Die Arbeit fasst die Kernaussagen des Buches zusammen, insbesondere die historische Entwicklung der Men’s Studies und die Kritik an einer eingeschränkten Perspektive in der Forschung.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des historischen Kontextes auf die Gestaltung der Geschlechterbilder in "Narziß und Goldmund" und bezieht diesen Aspekt in die Interpretation der Ergebnisse mit ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechterrollen, Lebensphilosophien, "Narziß und Goldmund", Hermann Hesse, Geschlechterforschung, Männlichkeiten, sozial konstruiertes Geschlecht, historischer Kontext, Geistmensch, Herzmensch.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Geschlechterrollen und Lebensphilosophien in "Narziß und Goldmund" zu untersuchen und die charakterlichen Unterschiede zwischen Narziß und Goldmund im Kontext des historischen und sozial konstruierten Geschlechterverständnisses zu beleuchten.
- Citation du texte
- Isabell Maaß (Auteur), 2011, Stereotype Geschlechterbilder als Abbildung heterogener Lebensphilosophien am Beispiel „Narziß und Goldmund“ von Hermann Hesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191063