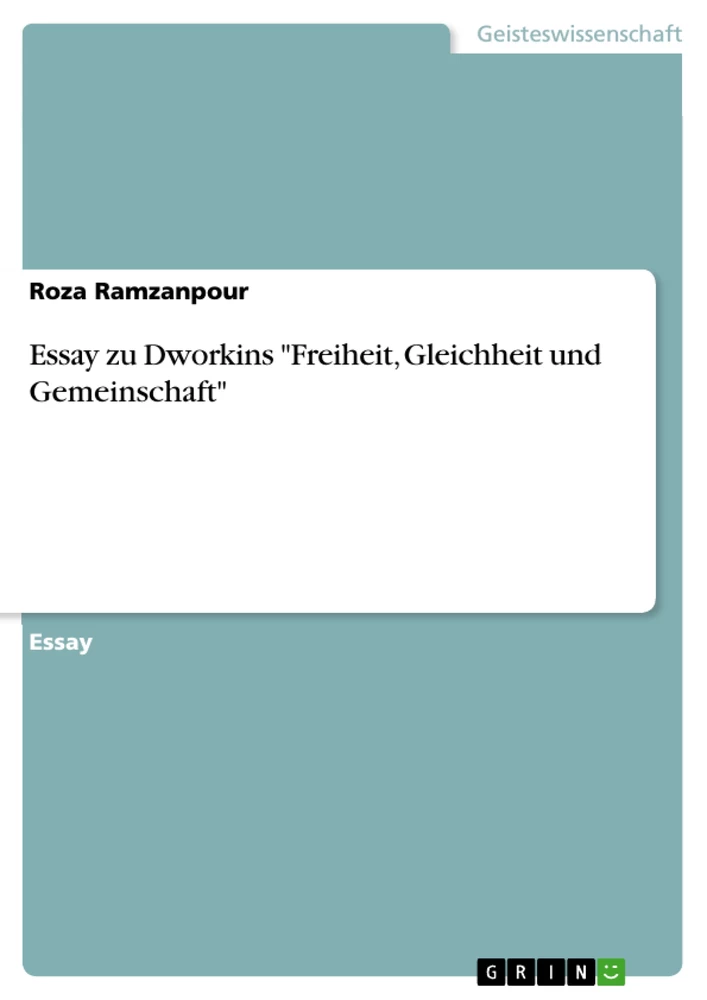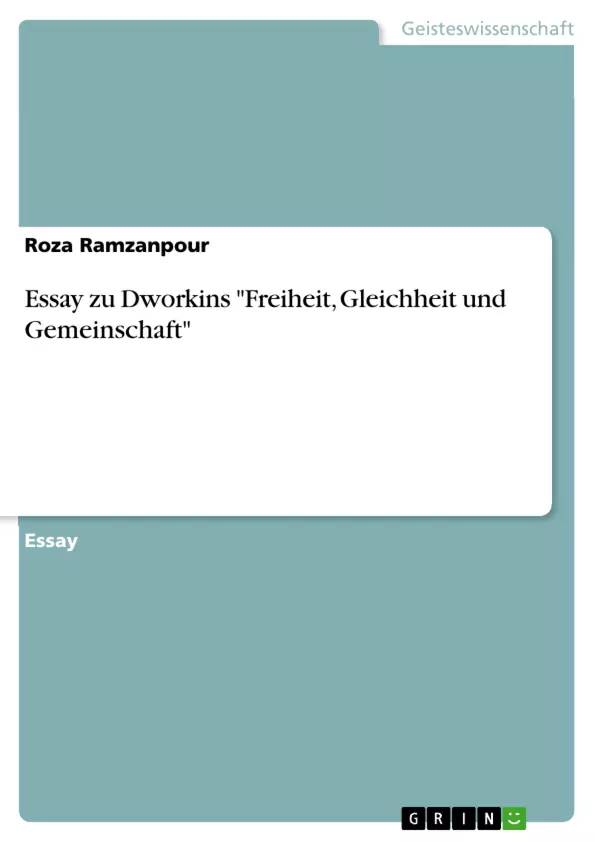Die westliche Welt stimmt damit überein, dass die liberale Demokratie die einzig annehmbare Regierungsform ist. Doch hinter der Übereinstimmung steckt die Unsicherheit, was die liberale Demokratie eigentlich ist.
Charles Taylor hat für sich die Antwort gefunden. Ihm zufolge sei die liberale Demokratie gleichzustellen mit der Freiheit und Selbstregierung unter Voraussetzungen der Gleichheit. Doch auch hier besteht ein Definitionsproblem: Was bedeutet Freiheit und Selbstregierung und welche Form der Gleichheit ist tauglich?
Inhaltsverzeichnis
- Die drei Tugenden
- Der vermeintliche Konflikt
- Osteuropa als Beispiel
- Dworkins Kritik am Konflikt
- Definitionen der Tugenden
- Die Vereinigung der Tugenden
- Ethischer Individualismus und seine Konsequenzen
- Egalitarismus
- Zwei Möglichkeiten zur Erreichung der Gleichheit
- Gleichheit der Ressourcen
- Persönliche Ressourcen
- Kompensationsstrategien
- Gleichheit und Freiheit
- Gemeinschaft als Grundlage der Demokratie
- Kollektives Handeln
- Bedingungen einer politischen Gemeinschaft
- Liberale Toleranz
- Kritik an Dworkins Theorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit Ronald Dworkins Theorie des Liberalismus, die auf der Verbindung der drei Tugenden Freiheit, Gleichheit und Gemeinschaft basiert. Er analysiert den vermeintlichen Konflikt zwischen diesen Tugenden und argumentiert, dass sie sich gegenseitig verstärken und nicht ausschließen. Dworkin untersucht dabei die Bedeutung des ethischen Individualismus und seine Konsequenzen für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft.
- Der vermeintliche Konflikt zwischen Freiheit, Gleichheit und Gemeinschaft
- Dworkins Theorie des Liberalismus als Verbindung der drei Tugenden
- Die Rolle des ethischen Individualismus in Dworkins Theorie
- Die Bedeutung von Gleichheit der Ressourcen und Kompensationsstrategien
- Die Verbindung von Gleichheit und Freiheit im Rahmen des Liberalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- In diesem Kapitel werden die drei Tugenden Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vorgestellt und deren vermeintlicher Konflikt erläutert. Es wird gezeigt, dass der Konflikt zwischen Freiheit und Gleichheit oft als ein innerer Konflikt des Liberalismus verstanden wird.
- In diesem Kapitel wird das Beispiel Osteuropas herangezogen, um die Gefahren der Annahme eines unvereinbaren Konflikts zwischen den drei Tugenden aufzuzeigen. Dworkin kritisiert dabei die Vorstellung, dass Gleichheit die Freiheit einschränkt und dass Freiheit und Gleichheit den Interessen der Gemeinschaft untergeordnet werden sollten.
- Dieses Kapitel beleuchtet Dworkins Kritik an der Annahme eines Konflikts zwischen den drei Tugenden. Er argumentiert, dass die Tugenden sich gegenseitig verstärken und dass der Liberalismus diese auf einen Nenner bringen muss.
- In diesem Kapitel werden verschiedene Interpretationen der drei Tugenden diskutiert, die zu der Annahme führen können, dass sie miteinander konkurrieren. Es wird gezeigt, dass diese Interpretationen die Tugenden falsch verstehen und ihren Kern verfehlen.
- Dieses Kapitel betont die Bedeutung der Vereinigung der drei Tugenden für die Bildung einer politischen Gemeinschaft, die auf ethischem Individualismus gründet. Dworkin betont dabei die Heiligkeit des menschlichen Lebens und den Erfolg des Lebens aller Bürger als kollektives, politisches Ziel.
- Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen von Dworkins Theorie des Liberalismus. Es wird argumentiert, dass seine Theorie eine egalitäre und antisozialistische Theorie ist, die den freien Markt und individuelle Entscheidungen fördert.
- Dieses Kapitel unterscheidet zwischen motivationalem und verteilungsbezogenem Egalitarismus. Während motivationaler Egalitarismus die Berücksichtigung aller Mitglieder der Gesellschaft bei politischen Entscheidungen fordert, befasst sich verteilungsbezogener Egalitarismus mit der gleichmäßigen Verteilung von Ressourcen und Wohlstand.
- Dieses Kapitel stellt zwei Möglichkeiten zur Erreichung der wirtschaftlichen Gleichheit dar: die Gleichheit des Wohlergehens und die Gleichheit der Ressourcen. Dworkin bevorzugt die Gleichheit der Ressourcen, da sie die Möglichkeit zur Eigenverantwortung und Lebensgestaltung eröffnet.
- Dieses Kapitel erklärt das Konzept der Gleichheit der Ressourcen. Es wird betont, dass dies nicht bedeutet, dass jeder über denselben Besitz verfügen soll, sondern dass die Ressourcen bezüglich der opportunity costs gleich sein sollten. Der "Neid-Test" soll sicherstellen, dass niemand den Besitz eines anderen beneidet.
- Dieses Kapitel erweitert die Diskussion um die Gleichheit der Ressourcen auf persönliche Ressourcen, die im Gegensatz zu den materiellen Ressourcen stehen. Es wird gezeigt, dass die Ungleichheit an persönlichen Ressourcen eine Herausforderung für die theoretische Auktion darstellt.
- Dieses Kapitel präsentiert Dworkins Lösung für das Problem der Ungleichheit an persönlichen Ressourcen: Kompensationsstrategien durch Besteuerung und Umverteilung. Dworkin bezieht sich dabei auf einen hypothetischen Versicherungsmarkt.
- Dieses Kapitel argumentiert, dass sich die egalitäre Seite des ethischen Individualismus mit der liberalen Seite vereinbaren lässt. Dworkin betont, dass Gleichheit und Freiheit Partner sind, die sich gegenseitig bedingen.
- Dieses Kapitel widerlegt die Auffassung der Kritiker des Liberalismus, dass dieser die Gemeinschaft nicht anerkennt. Dworkin argumentiert, dass der ethische Individualismus Ideen für eine politische Gemeinschaft formuliert, die auf gemeinsamen Grundsätzen basiert.
- Dieses Kapitel unterscheidet zwischen statistisch kollektivem Handeln und gemeinschaftlichem kollektivem Handeln. Statistisches Handeln impliziert das Mehrheitsprinzip, während gemeinschaftliches Handeln eine Identifikation mit der Gemeinschaft und dem Streben nach gemeinsamem Erfolg erfordert.
- Dieses Kapitel beschreibt die drei Bedingungen für eine echte politische Gemeinschaft: politische Partizipation, materielle Beteiligung und moralische Unabhängigkeit. Dworkin betont die Bedeutung von Toleranz und gemeinsamer Reflexion, ohne den Bürgern ihre Meinung aufzuzwingen.
- Dieses Kapitel räumt ein, dass liberale Toleranz nicht alle Probleme löst, betont aber ihre Notwendigkeit in einer gemeinschaftlichen Demokratie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Textes sind: Liberalismus, Freiheit, Gleichheit, Gemeinschaft, ethischer Individualismus, egalitär, antisozialistisch, Ressourcen-Gleichheit, Kompensationsstrategien, liberale Toleranz, kollektives Handeln, politische Gemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Tugenden in Dworkins Liberalismus?
Die drei Tugenden sind Freiheit, Gleichheit und Gemeinschaft (Brüderlichkeit).
Gibt es einen Konflikt zwischen Freiheit und Gleichheit?
Dworkin kritisiert diese Annahme. Er argumentiert, dass Freiheit und Gleichheit Partner sind, die sich gegenseitig bedingen und verstärken.
Was bedeutet "Gleichheit der Ressourcen"?
Jeder Bürger sollte über Ressourcen verfügen, deren Opportunitätskosten für die Gesellschaft gleich sind, um ein eigenverantwortliches Leben zu gestalten.
Was ist der "Neid-Test"?
Ein Kriterium zur Prüfung der Ressourcengleichheit: Niemand darf das Ressourcenpaket eines anderen dem eigenen vorziehen.
Wie steht Dworkin zur Gemeinschaft?
Er sieht die Gemeinschaft als Grundlage der Demokratie, die auf kollektivem Handeln und gegenseitiger Anerkennung moralischer Unabhängigkeit basiert.
- Quote paper
- Roza Ramzanpour (Author), 2012, Essay zu Dworkins "Freiheit, Gleichheit und Gemeinschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191074