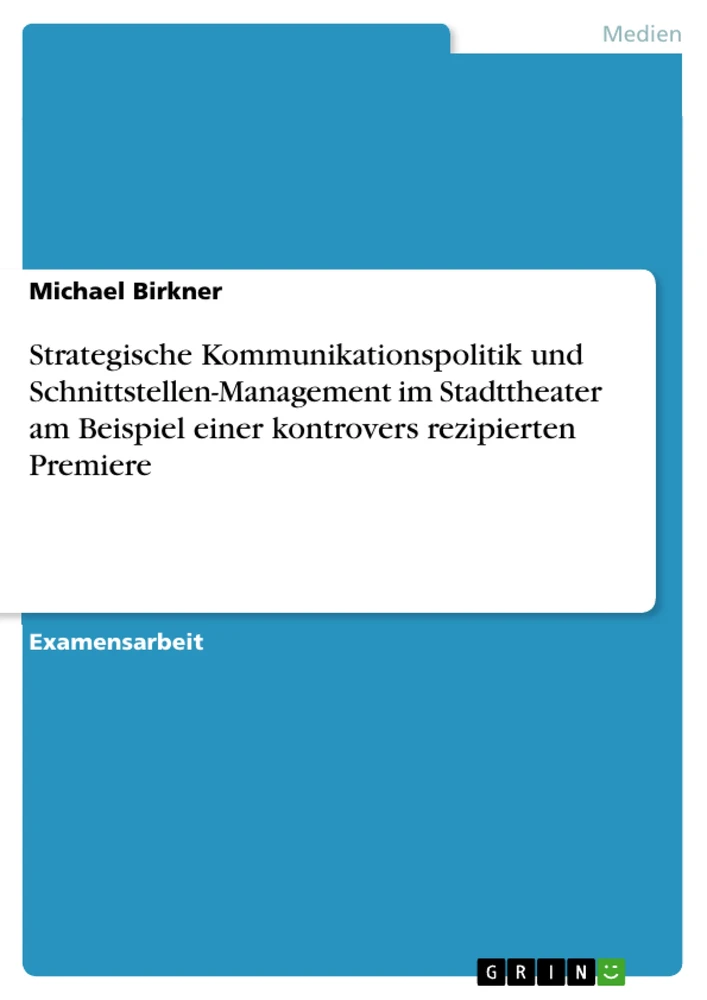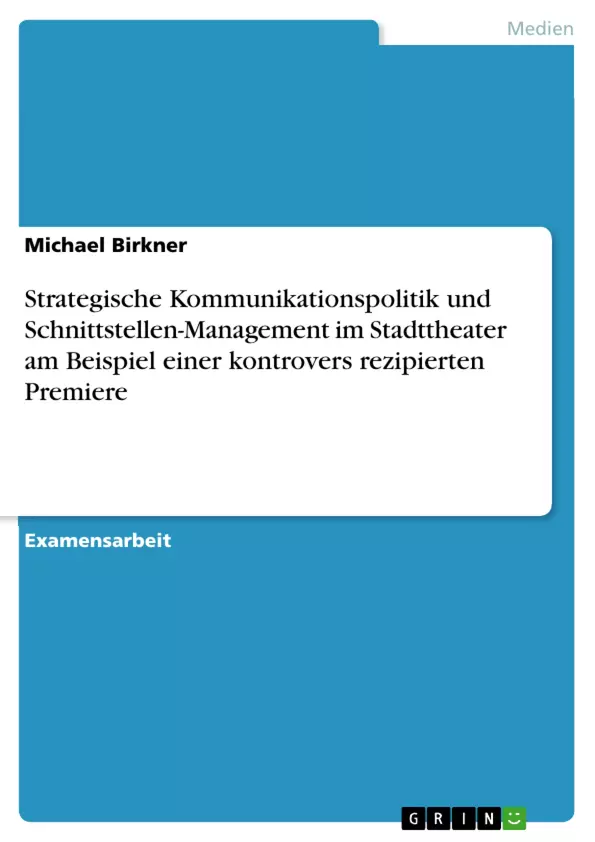Diese Studie am Beispiel der Kommunikationspolitik eines Theaterbetriebs aufzeigen, warum moderne Nonprofit-Unternehmen wie staatlich finanzierte Theater einen hohen Aufwand betreiben, um mit einem nach innen wie außen vermittelten unternehmerischen Konzept eine Corporate Identity auszubilden, welche die Zielorientierung im künstlerischen wie marktbezogenen Bereich sichern soll: Der öffentliche Auftrag, den sie über die Entwicklung von Produkten der Theaterkunst erfüllen, ist erstens an eine hinreichende Resonanz auf dem Markt gebunden, mit der sich die Investitionen rechtfertigen lassen. Zweitens sichert sich ein Unternehmen mit einer hohen Grundakzeptanz auf dem Markt aufgrund der erfolgreichen Ausbildung einer attraktiven Corporate Identity über das einzelne Produkt hinaus ab, das im Falle einer Theaterinszenierung immer Risiken in der Herstellung und Annahme durch die Besucher der Einrichtung besitzt. Durch die kommunikative Vermittlung eines überzeugenden Gesamtkonzeptes ist es dem Unternehmen drittens möglich, Produkte mit Eigenschaften zu veröffentlichen, welche aus dem kulturellen Auftrag gerechtfertigt sind, aber in der Betrachtungsweise einer Nahaufnahme, d.h. wenn diese als allein für das Unternehmen stehend wahrgenommen würden, eine Abwanderung von Teilen der Kundschaft bewirken könnten.
Diese Studie soll zudem anhand ausgewählter Beispiele die integrativen Prozesse der Kommunikation zwischen den Bereichen Kunst und Betrieb beleuchten, die im Rahmen der Kommunikationspolitik vonnöten sind, damit das Unternehmen, das im Kern produktorientiert ist, sich erfolgreich zum Markt hin orientieren kann. Dabei wurden von mir Stellen kenntlich gemacht und diskutiert, an denen Konfliktpotentiale entstehen und die sensibel durch die innerbetriebliche Kommunikation zu gestalten sind, um einheitlich erscheinen zu können. Am Beispiel der Kostprobe zu „Kasimir und Karoline“ sollte eine kommunikative Bruchstelle zwischen Kunst und Marketing innerhalb einer kommunikationspolitischen Maßnahme verdeutlicht werden, die auf den Widerspruch zwischen Marketing und Kunst hinweist, der lange Zeit im deutschen Theaterwesen ein marktorientiertes Denken im Betrieb verhindert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Corporate Identity und Unternehmensmission
- 2.1. Unternehmensidentität als „Wir-Bewusstsein“
- 2.2. Öffentlicher Auftrag beim Nonprofit-Unternehmen
- 3. Kommunikationspolitik und Schnittstellen-Management am Theater Lübeck
- 3.1. Theater Lübeck: Struktureller, politischer, wirtschaftlicher Hintergrund
- 3.2. Mission und strategische Ausrichtung der Kommunikationspolitik
- 3.3. Aspekte der internen Kommunikation am Beispiel der Aufführung von „Kasimir und Karoline“ am Theater Lübeck
- 3.4. Zwischen Kunst und Betrieb: Der Dramaturg als Schnittstellen-Manager im Theater
- 3.5. Aspekte der externen Kommunikation am Beispiel der Aufführung von „Kasimir und Karoline“ am Theater Lübeck
- 3.5.1. Beispiele für externe Kommunikationsinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Verkaufsförderung, Beschwerdemanagement)
- 4. Schlussbemerkung
- 5. Verzeichnis der verwendeten Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die strategische Kommunikationspolitik und das Schnittstellenmanagement eines Stadttheaters anhand einer kontrovers rezipierten Premiere. Ziel ist es, die Herausforderungen der Vermittlung von Kunst im Spannungsfeld von künstlerischer Produktion und Marktorientierung aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie ein Stadttheater trotz oder gerade wegen seiner Produktorientierung strategisch marktorientiert vorgeht, um die Legitimation seiner öffentlichen Subventionierung zu sichern.
- Die Verbindung von Kunst und Non-Profit-Marketing im Stadttheater.
- Strategien der internen und externen Kommunikation im Theater.
- Der Dramaturg als Schnittstellenmanager zwischen künstlerischen und betrieblichen Interessen.
- Die Bewältigung von potenziellen Kommunikationskonflikten bei kontroversen Inszenierungen.
- Die Rolle der Corporate Identity und der Unternehmensphilosophie in der Kommunikationsstrategie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Entwicklung von Stadt- und Staatstheatern zu markt- und kundenorientierten Non-Profit-Organisationen. Sie stellt die These auf, dass Theaterunternehmen trotz ihrer Produktorientierung strategisch marktorientiert handeln müssen, um ihre Legitimität zu sichern und ein breites Publikum zu erreichen. Die Arbeit fokussiert auf eine kontrovers rezipierte Aufführung am Theater Lübeck als Fallbeispiel, um die Strategien der internen und externen Kommunikation zu untersuchen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Marketing und den damit verbundenen Kommunikationsherausforderungen.
2. Corporate Identity und Unternehmensmission: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Unternehmensidentität (Corporate Identity) und der Unternehmensphilosophie (Mission) für ein Stadttheater. Es erläutert, wie die "zentrale Selbstdarstellung des Unternehmens nach innen und außen" (Bruhn) einheitliche Wahrnehmung und Identifikationsprozesse bei internen und externen Anspruchsgruppen erzeugt. Die Mission und die Corporate Identity bilden die Grundlage für die Gestaltung der Kommunikationspolitik und beeinflussen die Vermittlung von möglicherweise kontroversen künstlerischen Inhalten. Die Abstimmung von Corporate Design, Corporate Behavior und Corporate Communications wird als essentiell für eine einheitliche Wahrnehmung hervorgehoben.
3. Kommunikationspolitik und Schnittstellen-Management am Theater Lübeck: Dieses Kapitel analysiert die Kommunikationspolitik des Theaters Lübeck im Kontext seines strukturellen, politischen und wirtschaftlichen Hintergrunds. Es untersucht sowohl die interne Kommunikation (z.B. im Umgang mit der Inszenierung von „Kasimir und Karoline“) als auch die externe Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Verkaufsförderung, Beschwerdemanagement). Der Fokus liegt auf der Rolle des Dramaturgs als Schnittstellenmanager zwischen künstlerischen und betrieblichen Interessen und den Herausforderungen der Kommunikation bei einer kontroversen Inszenierung. Das Kapitel zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten und das Konfliktpotenzial an den Schnittstellen zwischen künstlerischer Produktion und Marketing auf.
Schlüsselwörter
Strategische Kommunikationspolitik, Stadttheater, Non-Profit-Organisation, Marketing, Kunstvermittlung, Corporate Identity, Schnittstellenmanagement, Interne Kommunikation, Externe Kommunikation, „Kasimir und Karoline“, Konfliktmanagement, Publikumsbindung, Unternehmensphilosophie, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Strategische Kommunikationspolitik und Schnittstellenmanagement am Theater Lübeck
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die strategische Kommunikationspolitik und das Schnittstellenmanagement eines Stadttheaters, anhand des Fallbeispiels einer kontrovers rezipierten Premiere am Theater Lübeck. Sie analysiert die Herausforderungen der Kunstvermittlung im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Produktion und Marktorientierung und beleuchtet, wie ein Stadttheater strategisch marktorientiert vorgeht, um seine öffentliche Subventionierung zu rechtfertigen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Herausforderungen der Vermittlung von Kunst im Spannungsfeld von künstlerischer Produktion und Marktorientierung aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie ein Stadttheater trotz oder gerade wegen seiner Produktorientierung strategisch marktorientiert vorgeht, um die Legitimation seiner öffentlichen Subventionierung zu sichern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbindung von Kunst und Non-Profit-Marketing im Stadttheater, Strategien der internen und externen Kommunikation, die Rolle des Dramaturgs als Schnittstellenmanager, die Bewältigung von Kommunikationskonflikten bei kontroversen Inszenierungen und die Bedeutung der Corporate Identity und Unternehmensphilosophie in der Kommunikationsstrategie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Corporate Identity und Unternehmensmission, ein Kapitel zur Kommunikationspolitik und zum Schnittstellenmanagement am Theater Lübeck, eine Schlussbemerkung und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 behandelt die Bedeutung der Corporate Identity und Mission für das Theater. Kapitel 3 analysiert die interne und externe Kommunikation am Theater Lübeck anhand der Aufführung von „Kasimir und Karoline“, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Dramaturgs als Schnittstellenmanager. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt die Aufführung von „Kasimir und Karoline“?
Die Aufführung von „Kasimir und Karoline“ am Theater Lübeck dient als Fallbeispiel, um die Strategien der internen und externen Kommunikation sowie die Herausforderungen des Schnittstellenmanagements bei einer kontroversen Inszenierung zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strategische Kommunikationspolitik, Stadttheater, Non-Profit-Organisation, Marketing, Kunstvermittlung, Corporate Identity, Schnittstellenmanagement, Interne Kommunikation, Externe Kommunikation, „Kasimir und Karoline“, Konfliktmanagement, Publikumsbindung, Unternehmensphilosophie, Dramaturgie.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass Stadttheater, trotz ihrer Produktorientierung, strategisch marktorientiert handeln müssen, um ihre Legitimität zu sichern und ein breites Publikum zu erreichen. Die Kunstvermittlung erfordert ein ausgeklügeltes Kommunikationsmanagement, welches interne und externe Anspruchsgruppen berücksichtigt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Kommunikationswissenschaft, Theaterwissenschaft, Kulturmanagement und alle, die sich für die strategische Kommunikation von Non-Profit-Organisationen und insbesondere von Theatern interessieren.
- Quote paper
- Magister Artium Michael Birkner (Author), 2011, Strategische Kommunikationspolitik und Schnittstellen-Management im Stadttheater am Beispiel einer kontrovers rezipierten Premiere, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191091