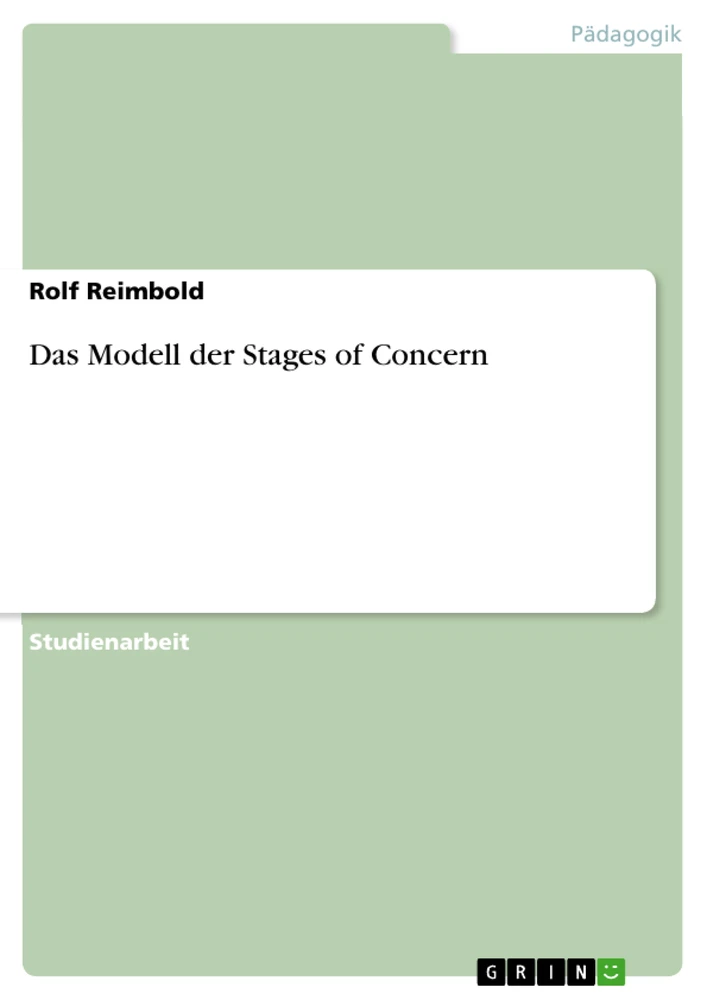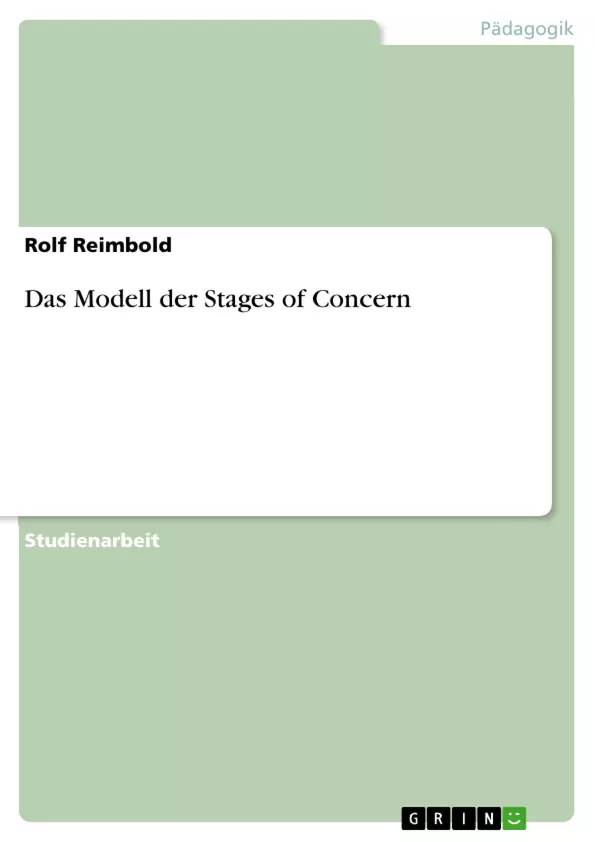„[...] Schulleiter Schatka formuliert es drastischer: ‚Eigentlich konnte in Bremen jeder machen, was er wollte.‘ Damit ist es vorbei. Jetzt wird gemessen, kontrolliert und verglichen. Output-Orientierung nennt sich das.“ (Spiewak 2004)
Bei diesem Zitat handelt es sich um einen Auszug aus dem Zeit-Artikel „Wandel ohne Vision“ von Martin Spiewak. Der etwas zynische und anklagende Unterton lässt erahnen, dass der Autor eine eher negative Einstellung zu dem Thema Output-Orientierung hat. Letztere gibt es natürlich nicht ausschließlich in Bremen. Dieses Phänomen und damit in Verbindung stehende Veränderungen im deutschen Schulwesen betreffen eine große Anzahl von Menschen Tag für Tag. Wie der bereits erwähnte Journalist und auch der im Zitat angesprochene Schulleiter, hat jeder an diesem Prozess Beteiligte seine eigenen Gedanken und Einstellungen in Bezug auf dieses Thema. So ist es wahrscheinlich, dass sich ein gewisser Teil der unterrichtenden Lehrkräfte bedrängt, überfordert oder sogar attackiert von derartigen Innovationen fühlt. Allerdings sind Veränderungen im Schulwesen wie beispielsweise der Wandel von einer Input- zu einer Output-Orientierung mithilfe der Bildungsstandards nur dann zu bewerkstelligen, wenn Lehrer und Lehrerinnen diesem Konzept nicht ablehnend gegenüberstehen, sondern die Veränderung akzeptieren, sich darauf einlassen und ihrer Teil zur Umsetzung der Innovation aktiv beitragen. An diesem Punkt wird deutlich, dass die Lehrkräfte bei der Implementation einer Neuerung eine herausragende Rolle einnehmen und es deshalb überaus wichtig ist, ihre Einstellung zu der jeweiligen Angelegenheit zu kennen und gegebenenfalls einzugreifen, wenn sich Probleme anbahnen.
Eine Möglichkeit dazu bietet das Modell der Stages of Concern. Hierbei handelt es sich um sieben Stufen, die von Lehrkräften im Laufe der Implementation einer Neuerung durchlaufen werden. Die Stages of Concern sind aus dem Grund, beispielsweise für die Schulleitung, ein gutes Instrument, weil anhand der Auswertung spezieller Fragebögen die Einstellungen und Bedenken der Lehrenden zu der infrage stehenden Innovation deutlich werden. Die Schulleitung hat dann konkrete Anhaltspunkte und kann anschließend adäquat reagieren, um die Innovation erfolgreich umzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der sieben Stufen
- Mögliche Reaktionen des Change Facilitator Teams
- Anwendungsbeispiel aus der Schweiz: Neue Kaufmännische Grundbildung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Implementation von Innovationen im Bildungswesen, insbesondere mit der Einführung von Bildungsstandards und Vergleichsarbeiten. Er analysiert die Reaktionen von Lehrkräften auf solche Veränderungen und stellt das Modell der Stages of Concern vor, welches die affektiven Phasen bei der Auseinandersetzung mit einer Innovation beschreibt.
- Das Modell der Stages of Concern
- Die Reaktion von Lehrkräften auf Innovationen
- Die Bedeutung von Akzeptanz und Mitwirkung
- Die Rolle der Schulleitung bei der Implementierung von Innovationen
- Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Wandel im deutschen Schulwesen von einer Input- zu einer Output-Orientierung und die damit verbundenen Herausforderungen. Die sieben Stufen des Stages of Concern-Modells werden im zweiten Kapitel vorgestellt und im dritten Kapitel wird auf mögliche Reaktionen von Change Facilitator Teams eingegangen. Das vierte Kapitel behandelt ein Anwendungsbeispiel aus der Schweiz.
Schlüsselwörter
Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten, Stages of Concern, Change Management, Innovation, Output-Orientierung, Lehrerreaktionen, Implementation, Schulleitung, Unterrichtsqualität, Veränderungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Modell der "Stages of Concern"?
Es beschreibt sieben Stufen der Besorgnis, die Personen durchlaufen, wenn sie mit einer Neuerung oder Innovation konfrontiert werden.
Warum ist das Modell für Schulleitungen wichtig?
Es hilft zu verstehen, warum Lehrkräfte Neuerungen (wie Bildungsstandards) ablehnen oder sich überfordert fühlen, und ermöglicht gezielte Unterstützung.
Welche Stufen der Besorgnis gibt es?
Die Stufen reichen von "Gleichgültigkeit" über "persönliche Bedenken" bis hin zur "Zusammenarbeit" und "Umgestaltung" der Innovation.
Was versteht man unter Output-Orientierung im Schulwesen?
Der Fokus verlagert sich von den Lehrplänen (Input) hin zu den tatsächlichen Lernergebnissen der Schüler (Output), gemessen durch Standards.
Wie kann ein "Change Facilitator Team" reagieren?
Durch Information, Schulungen und die Einbindung der Lehrkräfte in den Gestaltungsprozess können Widerstände abgebaut werden.
- Citation du texte
- Rolf Reimbold (Auteur), 2012, Das Modell der Stages of Concern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191201