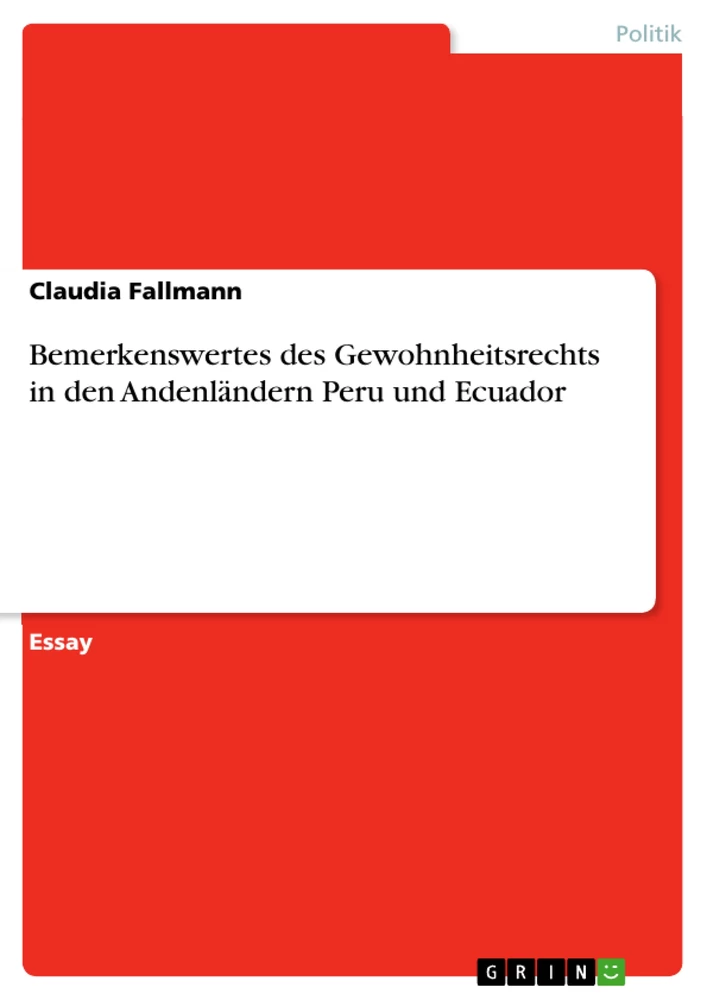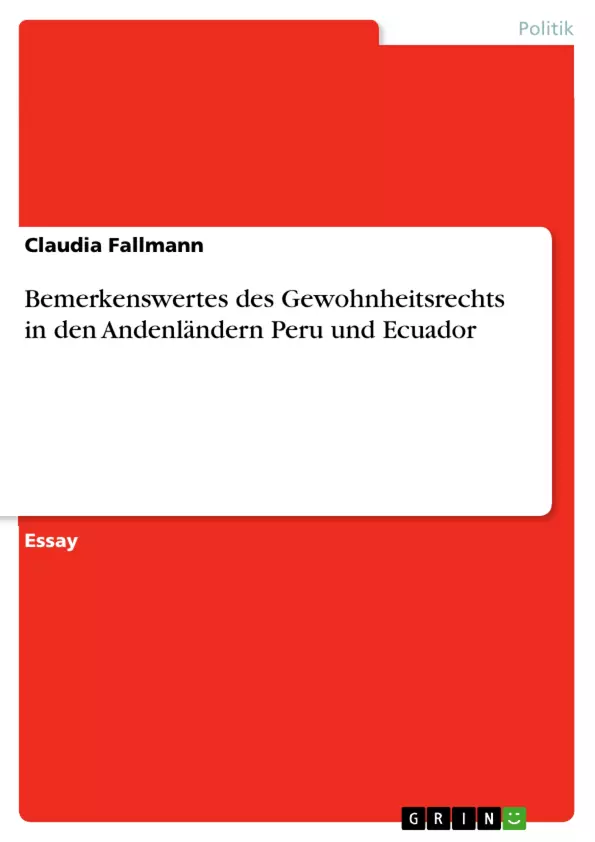Die Hauptfragen der Studie beschäftigen sich mit den Begriffen Justiz, Gerechtigkeit,
Recht sowie Aufgaben und Pflichten in indigenen Gemeinschaften der peruanischen Quecha
aus Cuzco, Quechua aus Puno und ecuadorianischen Kichwa/Quichua-Indigenen aus
Cotopaxi, Chimborazo und Loja in Anbetracht der Applikation von Gewohnheitsrecht. Eine
Ausnahme bilden dabei die „rondas campesinas“ in Peru, welche sich in Zeiten des
Kriegszustandes in den 1980er Jahren zum Selbstschutz von Bauern („campesinos“)
formierten. Auch sie wenden Gewohnheitsrecht an.
Die Studie ist eine sehr aufschlussreiche und detaillierte Aufstellung mit Beispielen zu
den oben erwähnten Themenbereichen. In dieser Zusammenfassung des Textes soll das
Hauptmoment jedoch nicht auf die vollständige Wiedergabe des Inhaltes liegen, sondern viel
mehr einige Unterschiede und Auffälligkeiten im Vergleich zu ordentlichem Recht
hervorheben.
Inhaltsverzeichnis
- Justiz, Gerechtigkeit und Recht in den Anden
- Gewohnheitsrecht und seine Anwendung
- Normen und Werte
- Kollektivismus und individuelle Rechte
- Soziale Beziehungen und das Gleichgewicht des Kosmos
- Konflikte, Probleme und Justiz
- Begriffe und Übersetzungen
- Delikte in indigenen Gemeinschaften
- Einfluss des Gewohnheitsrechts auf das ordentliche Recht
- Prozesse und Sanktionen
- Wiederherstellung des Gleichgewichts
- Ablauf der Prozesse
- Kriterien für Sanktionen
- Familienstand des Täters
- Vollzug von Bestrafungen
- Häufigkeit verschiedener Sanktionen
- Körperliche Züchtigung
- Moralappell als adäquate Bestrafung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie „Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador. Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria“ untersucht die Normen, Werte und Verfahrensweisen der Gemeinjustiz und des Gewohnheitsrechts in den Andenländern Peru und Ecuador. Sie beleuchtet die Anwendung des Gewohnheitsrechts in indigenen Gemeinschaften und analysiert die Unterschiede zum ordentlichen Recht.
- Das Verhältnis von Normen und Werten im Gewohnheitsrecht
- Die Bedeutung von Kollektivismus und individuellen Rechten in indigenen Gesellschaften
- Die Rolle der sozialen Beziehungen und des Gleichgewichts des Kosmos in der indigenen Rechtsauffassung
- Die Unterschiede zwischen westlichem und indigenem Rechtsverständnis
- Die Anwendung und die Sanktionen im Gewohnheitsrecht im Vergleich zum ordentlichen Recht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Studie beginnt mit einer genauen Beschreibung des Gewohnheitsrechts in den indigenen Gemeinschaften Perus und Ecuadors. Dabei wird auf die Normen und Werte, die Kollektivität und die Rolle der sozialen Beziehungen eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Frage nach dem Verständnis von Konflikt, Problem und Justiz in den indigenen Sprachen im Vergleich zum Spanischen beleuchtet. Darüber hinaus werden die Delikte in indigenen Gemeinschaften und der Einfluss des Gewohnheitsrechts auf das ordentliche Recht untersucht. Die Studie analysiert auch die Prozesse im Gewohnheitsrecht, die Kriterien für Sanktionen und die Rolle des Familienstandes des Täters. Schließlich werden die verschiedenen Arten von Strafen im Gewohnheitsrecht und deren Vollzug im Vergleich zum ordentlichen Recht betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Studie beschäftigt sich mit den zentralen Themen Gewohnheitsrecht, indigene Gemeinschaften, Normen, Werte, Kollektivismus, soziale Beziehungen, Gleichgewicht des Kosmos, Konflikt, Problem, Justiz, Delikte, Prozesse, Sanktionen, Strafen, ordentliches Recht, Peru, Ecuador.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am indigenen Gewohnheitsrecht in den Anden?
Es basiert auf kollektiven Werten, sozialen Beziehungen und der Wiederherstellung des kosmischen Gleichgewichts, anstatt nur auf individueller Bestrafung.
Wer sind die „Rondas Campesinas“ in Peru?
Das sind bäuerliche Selbstschutzorganisationen, die in den 1980er Jahren entstanden und heute eine wichtige Rolle bei der Ausübung der Gemeinjustiz und des Gewohnheitsrechts spielen.
Welche Sanktionen werden im Gewohnheitsrecht angewandt?
Die Sanktionen reichen von Moralappellen und Gemeinschaftsarbeit bis hin zu körperlichen Züchtigungen oder in schweren Fällen dem Ausschluss aus der Gemeinschaft.
Was unterscheidet das indigene Rechtsverständnis vom westlichen Recht?
Während das westliche Recht oft straforientiert und individuell ist, zielt die indigene Justiz auf Versöhnung, Wiedergutmachung und den Erhalt des sozialen Friedens ab.
Welche Rolle spielt der Familienstand bei der Urteilsfindung?
Der familiäre Hintergrund und der soziale Status des Täters innerhalb der Gemeinschaft sind oft wichtige Kriterien bei der Festlegung des Strafmaßes und der Art der Wiedergutmachung.
- Arbeit zitieren
- Claudia Fallmann (Autor:in), 2011, Bemerkenswertes des Gewohnheitsrechts in den Andenländern Peru und Ecuador, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191274