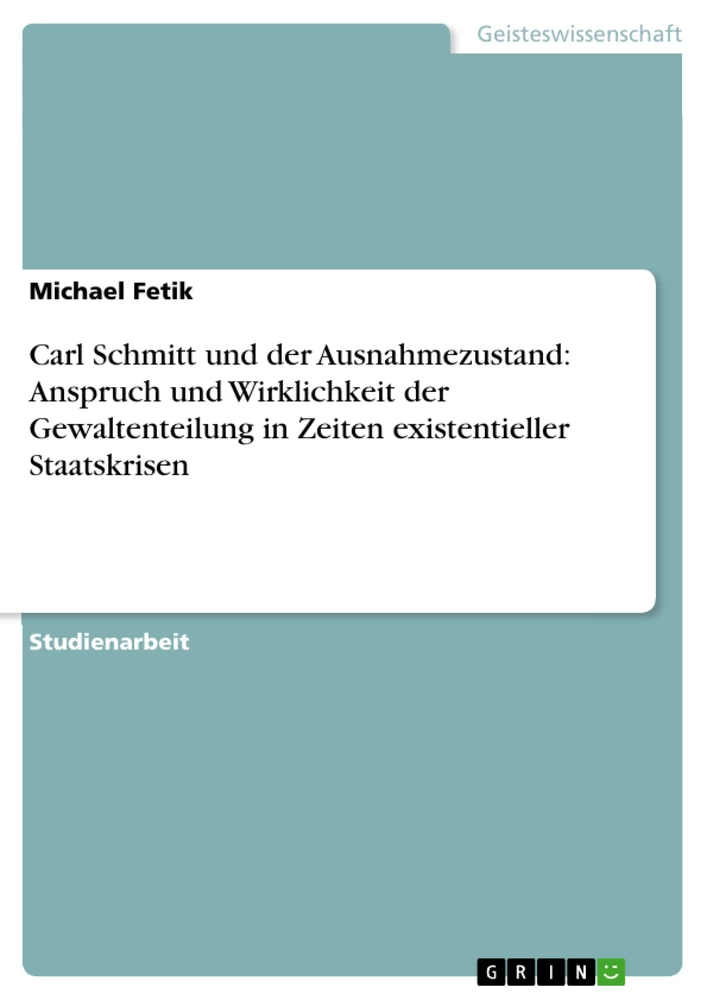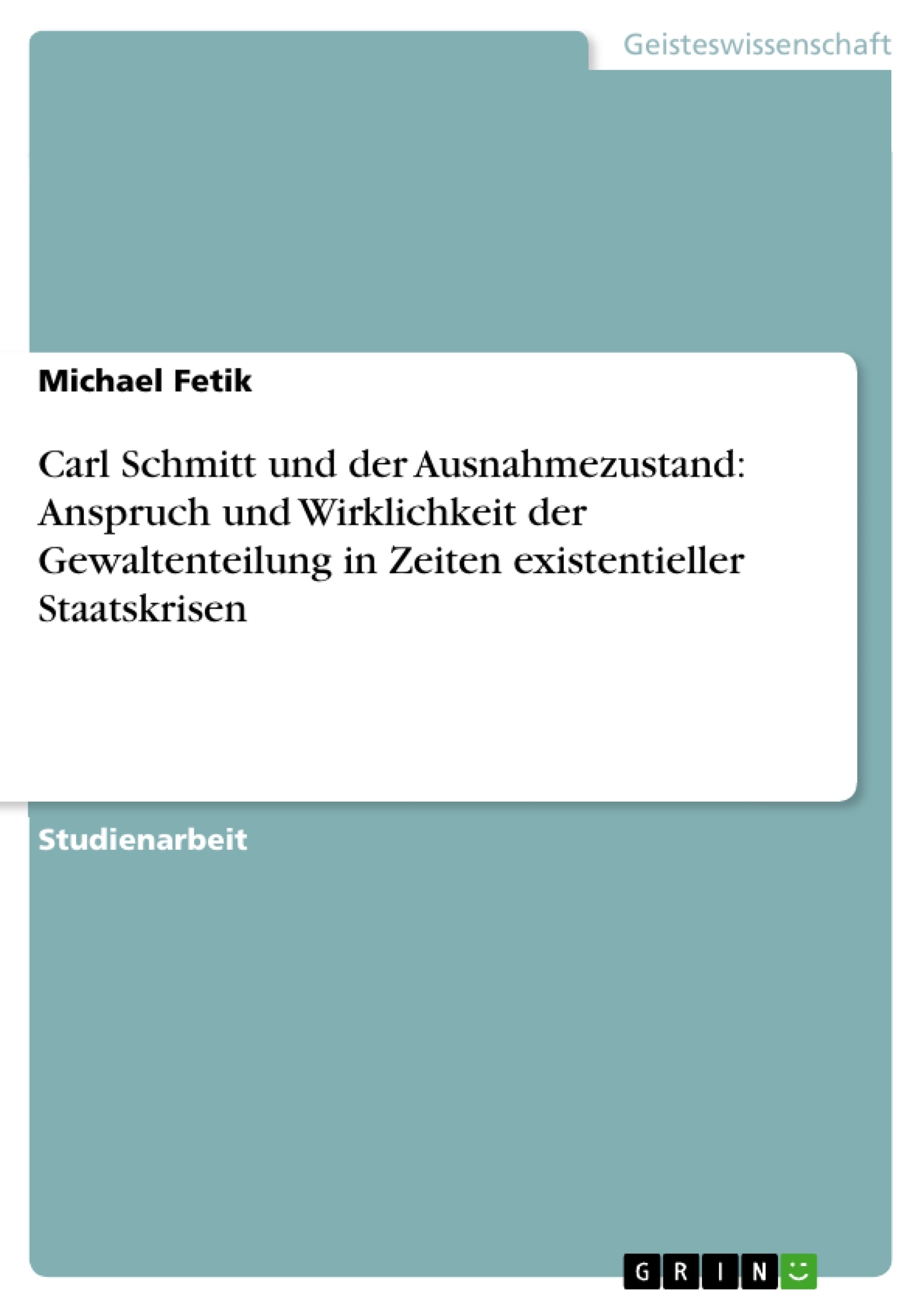„Der Ausnahmezustand offenbart das Wesen der staatlichen Macht am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm, und(um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht.“
Carl Schmitt (1888-1985) gilt als einer der bekanntesten, jedoch auch umstrittensten Staats- und Völkerrechtler des 20. Jahrhunderts, der die staatsrechtlichen Auseinandersetzungen der Weimarer Republik und des „Dritten Reichs“ entscheidend prägte und auch nach 1945 einen bedeutenden Einfluss auf die deutsche und europäische Staatsrechtslehre ausübte, wie es die zahlreichen Auseinandersetzungen gerade in den ersten Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik bezeugen.
Die Faszination an Carl Schmitt dürfte sich insbesondere durch sein Denken im Extremen erklären: Er denkt den Grenzfall, den Ausnahmefall. Die Ausnahme ist für ihn interessanter als der Normalfall: „Das Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles; sie bestätigt nicht nur die Regel, die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme.“ Seine berühmte, formelartige Zuspitzung, mit der er seine Politische Theologie einleitet: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“ verweist auf die Diktatur, die geradezu für den Ausnahmefall erfunden zu sein scheint. Dementsprechend heißt es bei Carl Schmitt, dass die „Diktatur notwendig Ausnahmezustand“ ist , was jedoch nicht bedeutet, dass die Diktatur den Ausnahmezustand begründet. Sie ist vielmehr selbst Resultat der Entscheidung über den Ausnahmezustand. Deshalb zeigt sich das „Wesen der staatlichen Souveränität“ nicht, wie Max Weber meint, „als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol.“
Ziel dieser Arbeit ist es, Carl Schmitts „Ausnahmedenken“ in seiner Konsequenz auf die Gewaltenteilung hin zu untersuchen. Zunächst soll kurz der historisch gewachsene, verfassungsrechtliche Anspruch der Gewaltenteilung als einer „Grundidee der bürgerlichen Freiheit“ nachgezeichnet und seine Verankerung innerhalb der bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassung wie der Weimarer Reichsverfassung (WRV) geklärt werden, um diesen sodann an der Wirklichkeit existentieller Staatskrisen zu messen. Hierzu wird es erforderlich sein, die Begriffe „Gewalt“ und „Recht“ sowie ihr Verhältnis zueinander zu klären, um danach für die Zeiten des Notstands aufzeigen zu können, wie Carl Schmitt den Weg in die Diktatur rechtlich zu begründen versucht, beginnend mit der „kommissarischen Diktatur“...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historisch gewachsene Anspruch der Gewaltenteilung als konstitutives Element der bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassung
- Die Gewaltenteilung als eine Grundidee der staatsbürgerlichen Freiheit
- Die Unterscheidung und Balancierung der Gewalten
- Vom politischen Programm zum Synonym der „Verfassung“
- Die Gewaltenteilung als Organisationsprinzip der bürgerlich-rechtstaatlichen Verfassung
- Bürgerlich-rechtsstaatlicher und politischer Bestandteil der Verfassung
- Die Dialektik von Recht und Gewalt
- Zwischenbilanz
- Die Gewaltenteilung als eine Grundidee der staatsbürgerlichen Freiheit
- Das Schicksal der Gewaltenteilung in Zeiten existentieller Staatskrisen
- Die „kommissarische Diktatur“ des Reichspräsidenten nach Art. 48 Abs. 2 und 3 der Weimarer Reichsverfassung
- Die erweiterte Auslegung des „Diktaturartikels“ durch Carl Schmitt
- Dezision versus Öffentlichkeit und Diskussion
- Das gemeinsame Schicksal von individueller Freiheit und Gewaltenteilung
- Einheitspathos statt Freiheitsideal
- Kontrolle ohne Kontrolleur
- Die „kommissarische Diktatur“ des Reichspräsidenten nach Art. 48 Abs. 2 und 3 der Weimarer Reichsverfassung
- Die „souveräne Diktatur“ mit der Suspension der gesamten Rechtsordnung
- Der Dreiklang aus Souveränität, Ausnahmezustand und Entscheidung
- Gewaltenteilung versus Souveränität
- Der Staat überlebt das Recht
- Die Paradoxie der Souveränität
- Der Dualismus von Recht und Rechtsverwirklichung
- Recht schaffen ohne Recht zu haben
- Der Dreiklang aus Souveränität, Ausnahmezustand und Entscheidung
- Zusammenfassung und kritische Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Carl Schmitts „Ausnahmedenken“ in Bezug auf die Gewaltenteilung. Zunächst wird der verfassungsrechtliche Anspruch der Gewaltenteilung als „Grundidee der bürgerlichen Freiheit“ dargestellt und in den Kontext der Weimarer Reichsverfassung eingeordnet. Anschließend wird dieser Anspruch an der Realität existentieller Staatskrisen gemessen. Schmitts Versuche, den Weg in die Diktatur rechtlich zu begründen – von der „kommissarischen Diktatur“ bis zur „souveränen Diktatur“ – werden analysiert. Im Mittelpunkt steht Schmitts Verständnis des Ausnahmezustands und dessen Zusammenhang mit Souveränität und Entscheidung.
- Der verfassungsrechtliche Anspruch der Gewaltenteilung als Grundprinzip bürgerlicher Freiheit
- Carl Schmitts Theorie des Ausnahmezustands und seine Bedeutung für die Gewaltenteilung
- Die rechtliche Begründung der Diktatur nach Schmitt
- Das Verhältnis von Recht, Gewalt und Souveränität in Schmitts Werk
- Die Frage nach der Realisierbarkeit bürgerlicher Freiheit ohne Gewaltenteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Carl Schmitt als einen einflussreichen, aber auch umstrittenen Staats- und Völkerrechtler vor und führt in sein „Ausnahmedenken“ ein. Sie hebt Schmitts Fokus auf den Ausnahmefall hervor, der für ihn aufschlussreicher ist als der Normalfall, und präsentiert seine zentrale These: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“. Die Arbeit untersucht, wie Schmitts Ausnahmetheorie die Gewaltenteilung beeinflusst.
Der historisch gewachsene Anspruch der Gewaltenteilung als konstitutives Element der bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts der Gewaltenteilung, beginnend mit Ansätzen in der Antike bis hin zu Locke und Montesquieu. Es untersucht die Gewaltenteilung als Grundidee der bürgerlichen Freiheit und als Organisationsprinzip der bürgerlich-rechtsstaatlichen Verfassung, unter Berücksichtigung der Dialektik von Recht und Gewalt. Der Abschnitt analysiert den verfassungsrechtlichen Anspruch der Gewaltenteilung innerhalb des bürgerlich-rechtsstaatlichen und politischen Systems.
Das Schicksal der Gewaltenteilung in Zeiten existentieller Staatskrisen: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen existentieller Staatskrisen auf die Gewaltenteilung, insbesondere im Kontext der Weimarer Republik. Es untersucht Carl Schmitts Interpretation des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung (die „kommissarische Diktatur“) und seine Argumentation für die Notwendigkeit einer Entscheidung im Ausnahmezustand. Die Verknüpfung von individueller Freiheit und Gewaltenteilung in Krisenzeiten wird ebenfalls behandelt.
Die „souveräne Diktatur“ mit der Suspension der gesamten Rechtsordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit Schmitts Konzept der „souveränen Diktatur“, wobei der Ausnahmezustand zur Suspension der gesamten Rechtsordnung führt. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Souveränität, Ausnahmezustand und Entscheidung, sowie die Paradoxie der Souveränität, die darin besteht, Recht zu schaffen, ohne selbst Recht zu haben. Der Dualismus von Recht und Rechtsverwirklichung wird kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Carl Schmitt, Ausnahmezustand, Gewaltenteilung, Souveränität, Entscheidung, Diktatur, Weimarer Reichsverfassung, Recht, Gewalt, bürgerliche Freiheit, Staatskrise.
Häufig gestellte Fragen zu: Carl Schmitts Ausnahmezustand und die Gewaltenteilung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Carl Schmitts Theorie des Ausnahmezustands und deren Auswirkungen auf das Prinzip der Gewaltenteilung, insbesondere im Kontext der Weimarer Republik. Sie untersucht, wie Schmitt die Notwendigkeit einer „Diktatur“ in Krisenzeiten rechtfertigt und wie dies mit seinem Verständnis von Souveränität und Entscheidung zusammenhängt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Konzepts der Gewaltenteilung, Schmitts Interpretation des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung (die „kommissarische Diktatur“), sein Konzept der „souveränen Diktatur“ mit der Suspension der Rechtsordnung, das Verhältnis von Recht, Gewalt und Souveränität, sowie die Frage nach der Realisierbarkeit bürgerlicher Freiheit ohne Gewaltenteilung. Der Fokus liegt auf Schmitts Verständnis des Ausnahmezustands und dessen Bedeutung für die Gewaltenteilung.
Welche zentralen Thesen Schmitts werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Schmitts These, dass der Souverän derjenige ist, der im Ausnahmezustand entscheidet. Sie analysiert, wie diese These die Gewaltenteilung untergräbt und zur Rechtfertigung von diktatorischen Maßnahmen genutzt wird. Weiterhin wird Schmitts Unterscheidung zwischen „kommissarischer“ und „souveräner Diktatur“ untersucht.
Wie wird die Weimarer Reichsverfassung in die Analyse einbezogen?
Die Weimarer Reichsverfassung dient als zentraler Bezugspunkt, um Schmitts Theorien zu kontextualisieren und zu kritisieren. Insbesondere Artikel 48, der die Möglichkeit einer „kommissarischen Diktatur“ durch den Reichspräsidenten vorsah, wird im Detail analysiert.
Welche Bedeutung hat der Ausnahmezustand in Schmitts Werk?
Der Ausnahmezustand ist der zentrale Begriff in Schmitts Theorie. Schmitt argumentiert, dass im Ausnahmezustand die normale Rechtsordnung außer Kraft gesetzt werden kann und der Souverän die Entscheidungsgewalt besitzt. Diese Argumentation wird in der Arbeit kritisch untersucht.
Wie wird das Verhältnis von Recht und Gewalt dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Dialektik von Recht und Gewalt und untersucht, wie Schmitt diese im Kontext des Ausnahmezustands und der Souveränität versteht. Es wird kritisch hinterfragt, ob und wie Recht im Ausnahmezustand überhaupt noch Geltung beanspruchen kann.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu kritischen Schlussfolgerungen über Schmitts Theorie des Ausnahmezustands und dessen Implikationen für die Gewaltenteilung und die bürgerliche Freiheit. Sie hinterfragt die Rechtfertigung von diktatorischen Maßnahmen und die Kompatibilität von Schmitts Theorien mit den Prinzipien des Rechtsstaats.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Carl Schmitt, Ausnahmezustand, Gewaltenteilung, Souveränität, Entscheidung, Diktatur, Weimarer Reichsverfassung, Recht, Gewalt, bürgerliche Freiheit, Staatskrise.
- Quote paper
- Michael Fetik (Author), 2012, Carl Schmitt und der Ausnahmezustand: Anspruch und Wirklichkeit der Gewaltenteilung in Zeiten existentieller Staatskrisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191280