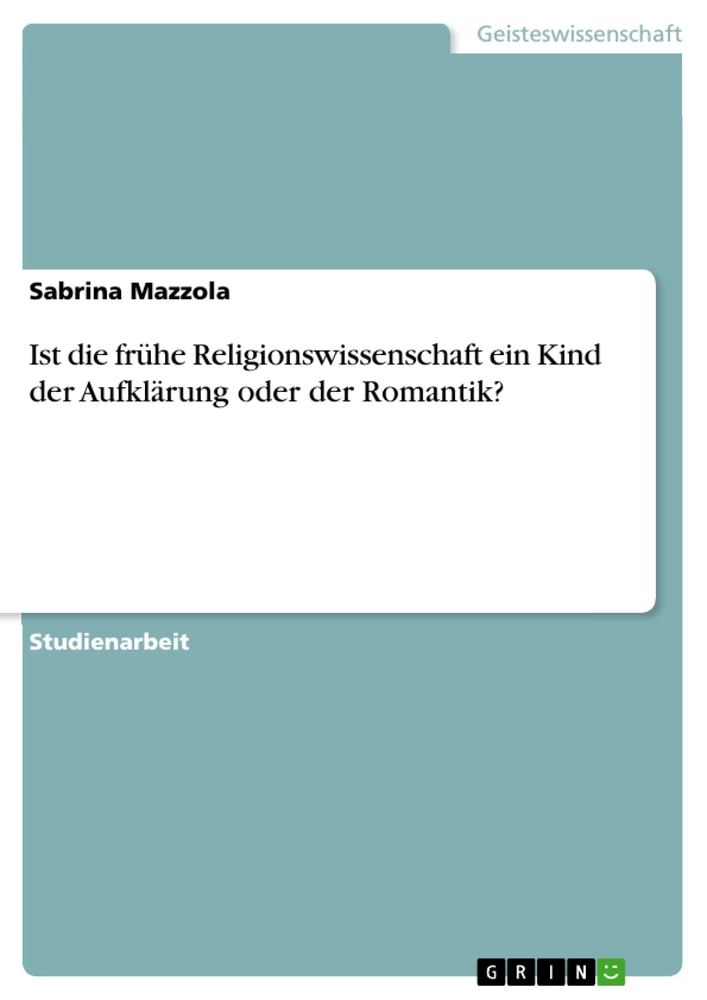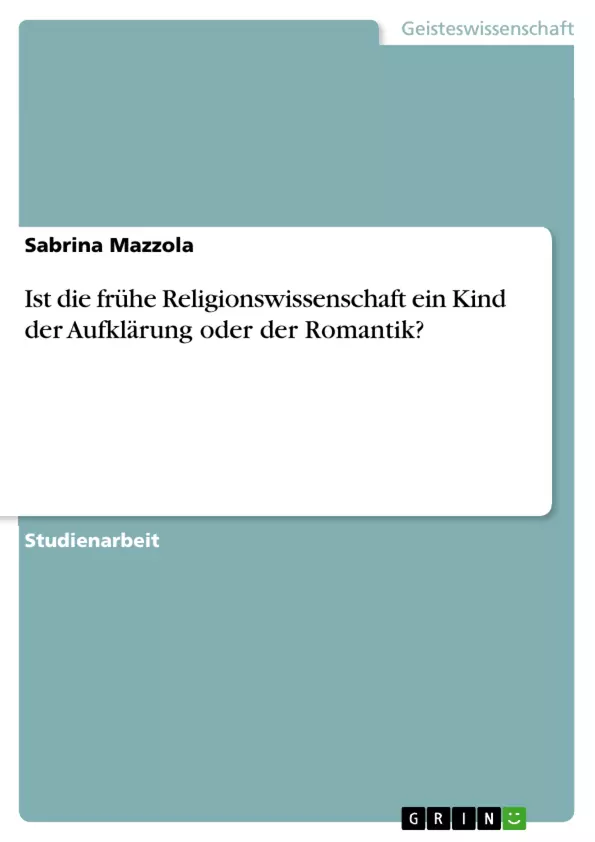Die frühe Religionswissenschaft ist zum einen untrennbar mit der christlichen Theologie verbunden, zum anderen mit dem Kulturraum des Abendlandes, da schon der Begriff „Religion“ (von lat. „religio, s. Smith und Hock) in seiner etymologischen Herkunft ein Abendländischer ist. Die frühe Religionswissenschaft folgte zeitlich nach der Aufklärung und während der Romantik, beide Strömungen sind für die Entwicklung der Disziplin äußerst relevant und sollten bei der Betrachtung der Disziplingeschichte eine große Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Aufklärung contra Romantik? Ein Ergebnis und eine Vermischung beider Strömungen
- Müller
- Die Religionsphänomenologen
- Otto
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der frühen Religionswissenschaft und deren Verhältnis zur Aufklärung und Romantik. Sie analysiert, inwiefern diese beiden philosophischen Strömungen die Entwicklung der Disziplin beeinflusst haben und ob eine klare Zuordnung möglich ist.
- Der Einfluss der Aufklärung auf die frühe Religionswissenschaft
- Der Einfluss der Romantik auf die frühe Religionswissenschaft
- Die Synthese von Aufklärung und Romantik in der frühen Religionswissenschaft
- Die Rolle der Theologie in der frühen Religionswissenschaft
- Methodische Ansätze der frühen Religionswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Die Vorbemerkung führt in die Thematik ein und betont die Verbundenheit der frühen Religionswissenschaft mit der christlichen Theologie und dem abendländischen Kulturraum. Sie hebt die zeitliche Nähe zur Aufklärung und Romantik hervor und deutet deren Relevanz für die Entwicklung der Disziplin an. Der Begriff „Religion“ selbst wird als abendländisch eingeordnet und die Notwendigkeit der Betrachtung beider Strömungen im Kontext der Disziplingeschichte wird unterstrichen.
Aufklärung contra Romantik? Ein Ergebnis und eine Vermischung beider Strömungen: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Aufklärung und Romantik auf die frühe Religionswissenschaft. Kant wird als Vertreter der Aufklärung dargestellt, der die Unantastbarkeit der Religion aufhob und zur Reflexion über sie anregte. Seine Forderung nach einer Vernunftreligion und seine Kritik an kirchlichen Riten werden hervorgehoben. Im Gegensatz dazu wird Schleiermacher als Romantiker präsentiert, der die Bedeutung von Anschauung, Gefühl und der individuellen religiösen Erfahrung betonte. Das Kapitel zeigt, dass die meisten Denker der frühen Religionswissenschaft Elemente beider Strömungen vereinten und eine eindeutige Zuordnung oft schwierig ist. Schleiermachers Betonung des Unendlichen und des „Schauens des Göttlichen im Wirklichen“ wird als Fortführung und Erweiterung des aufklärerischen Modells interpretiert, jedoch mit Ablehnung von Moral und Metaphysik.
Müller: Dieses Kapitel widmet sich Max Müller, der als „Vater der Religionswissenschaft“ gilt. Seine Arbeit wird als Synthese aus aufklärerischen und romantischen Elementen dargestellt. Müller verband Schleiermachers Fokus auf Anschauung und Gefühl mit sprachwissenschaftlichen Methoden. Er versuchte durch den Vergleich verschiedener Religionen, deren Ursprung und Gemeinsamkeiten zu erforschen, wobei sein christlicher Glaube und die damit verbundene Wertung des Christentums als die beste Religion deutlich werden. Sein Ansatz, aus den Fehlern anderer Religionen zu lernen, wird als aufklärerischer Aspekt interpretiert. Müller forderte eine kritische, aber tolerante Auseinandersetzung mit der eigenen Religion, um deren wahren Ursprung wiederzuentdecken.
Die Religionsphänomenologen: Das Kapitel behandelt Religionsphänomenologen wie van der Leeuw, Heiler und Wach. Ihr gemeinsames Anliegen, die Gemeinsamkeiten aller Religionen zu finden, wird dargestellt. Der Einfluss der Romantik und Müllers auf Heiler wird hervorgehoben, ebenso wie der wissenschaftliche Ansatz, der genaue Untersuchungen zur Erkenntnisgewinnung fordert. Waardenburgs Fokus auf die subjektive Bedeutung religiöser Erfahrung wird im Kontext von Schleiermachers Positionen betrachtet. Die Kombination aus romantischer Betonung der eigenen religiösen Erfahrung und aufklärerischer Forderung nach methodischer Distanz (Epoché) bei van der Leeuw wird analysiert.
Otto: Dieses Kapitel befasst sich mit Rudolf Otto und seiner Konzeption des Numinosen. Ottos Werk wird als Synthese aus aufklärerischen und romantischen Elementen präsentiert. Er greift Kants und Schleiermachers Ansätze auf, kritisiert aber gleichzeitig deren Grenzen. Seine Versuche, die Existenz des Heiligen „wissenschaftlich“ zu beweisen, werden im Spannungsfeld zwischen rationaler Argumentation und religiöser Annahme analysiert. Die Verbindung zwischen dem Numinosen und dem romantischen Modell religiöser Erfahrung wird herausgestellt.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Romantik, Religionswissenschaft, Max Müller, Religionsphänomenologie, Rudolf Otto, Schleiermacher, Kant, vergleichende Religionswissenschaft, Heiliges, Numinose, religiöse Erfahrung, Theologie, Methodologie.
FAQ: Entstehung der frühen Religionswissenschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der frühen Religionswissenschaft und ihr komplexes Verhältnis zur Aufklärung und Romantik. Sie analysiert den Einfluss beider philosophischen Strömungen auf die Entwicklung der Disziplin und hinterfragt, ob eine eindeutige Zuordnung möglich ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Aufklärung und der Romantik auf die frühe Religionswissenschaft, der Synthese beider Strömungen in diesem Kontext, der Rolle der Theologie, und den methodischen Ansätzen der frühen Religionswissenschaft. Konkrete Persönlichkeiten wie Max Müller, Rudolf Otto, Schleiermacher und Kant werden eingehend betrachtet.
Welche Personen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Beiträge wichtiger Denker der frühen Religionswissenschaft, darunter Max Müller (als "Vater der Religionswissenschaft"), Rudolf Otto (mit seiner Konzeption des Numinosen), Friedrich Schleiermacher (als Vertreter der Romantik) und Immanuel Kant (als Vertreter der Aufklärung). Zusätzlich werden Religionsphänomenologen wie van der Leeuw, Heiler und Wach behandelt.
Wie wird der Einfluss der Aufklärung dargestellt?
Der Einfluss der Aufklärung wird vor allem durch Kant repräsentiert, dessen Kritik an kirchlichen Riten und Forderung nach einer Vernunftreligion die Reflexion über Religion beförderte. Aufklärerische Aspekte finden sich auch in Müllers Ansatz, aus den Fehlern anderer Religionen zu lernen und eine kritische, aber tolerante Auseinandersetzung mit der eigenen Religion zu fordern.
Wie wird der Einfluss der Romantik dargestellt?
Der Einfluss der Romantik wird hauptsächlich durch Schleiermacher verkörpert, der die Bedeutung von Anschauung, Gefühl und individueller religiöser Erfahrung betonte. Romantische Elemente finden sich in der Betonung der subjektiven Bedeutung religiöser Erfahrung (Waardenburg) und in Ottos Konzeption des Numinosen.
Wie wird die Beziehung zwischen Aufklärung und Romantik dargestellt?
Die Arbeit zeigt, dass die meisten Denker der frühen Religionswissenschaft Elemente beider Strömungen vereinten. Eine eindeutige Zuordnung ist oft schwierig. Schleiermachers Werk wird beispielsweise als Fortführung und Erweiterung des aufklärerischen Modells interpretiert, jedoch mit Ablehnung von Moral und Metaphysik.
Welche methodischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene methodische Ansätze der frühen Religionswissenschaft, einschließlich der vergleichenden Religionswissenschaft (Max Müller), der Religionsphänomenologie (van der Leeuw, Heiler, Wach) und Ottos Ansatz, das Heilige „wissenschaftlich“ zu belegen. Die Kombination aus romantischer Betonung der eigenen religiösen Erfahrung und aufklärerischer Forderung nach methodischer Distanz (Epoché) wird analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aufklärung, Romantik, Religionswissenschaft, Max Müller, Religionsphänomenologie, Rudolf Otto, Schleiermacher, Kant, vergleichende Religionswissenschaft, Heiliges, Numinose, religiöse Erfahrung, Theologie, Methodologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Vorbemerkung, Aufklärung contra Romantik? Ein Ergebnis und eine Vermischung beider Strömungen, Müller, Die Religionsphänomenologen, Otto und Schluss.
Wo liegt der Fokus der Vorbemerkung?
Die Vorbemerkung führt in die Thematik ein und betont die Verbundenheit der frühen Religionswissenschaft mit der christlichen Theologie und dem abendländischen Kulturraum. Sie hebt die zeitliche Nähe zur Aufklärung und Romantik hervor und deutet deren Relevanz für die Entwicklung der Disziplin an. Der Begriff „Religion“ wird als abendländisch eingeordnet.
- Citation du texte
- Sabrina Mazzola (Auteur), 2006, Ist die frühe Religionswissenschaft ein Kind der Aufklärung oder der Romantik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191355