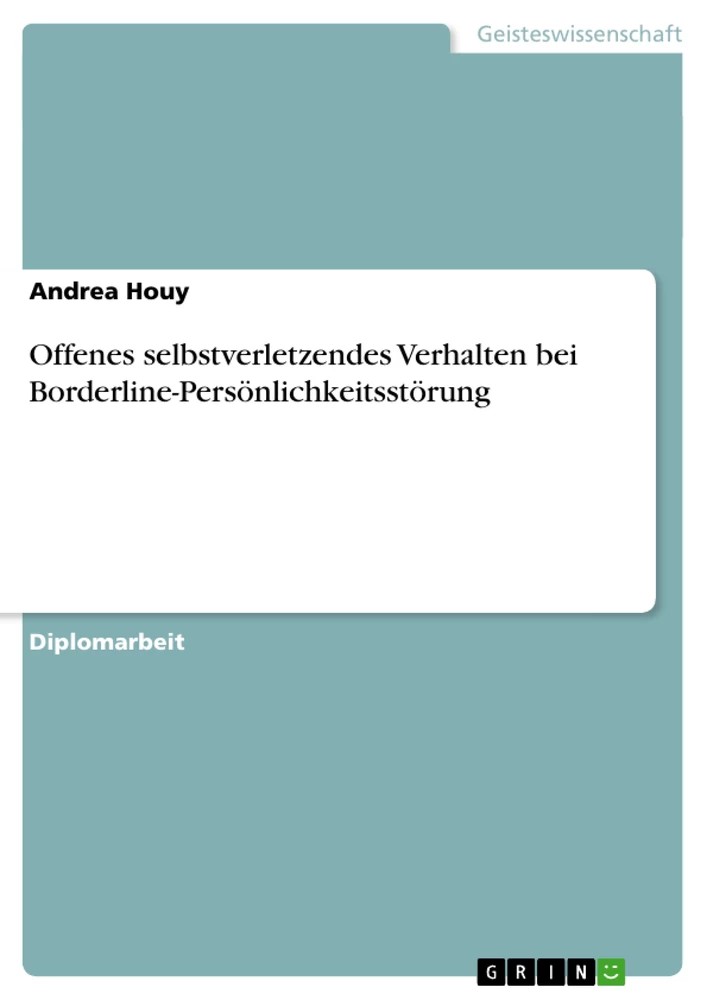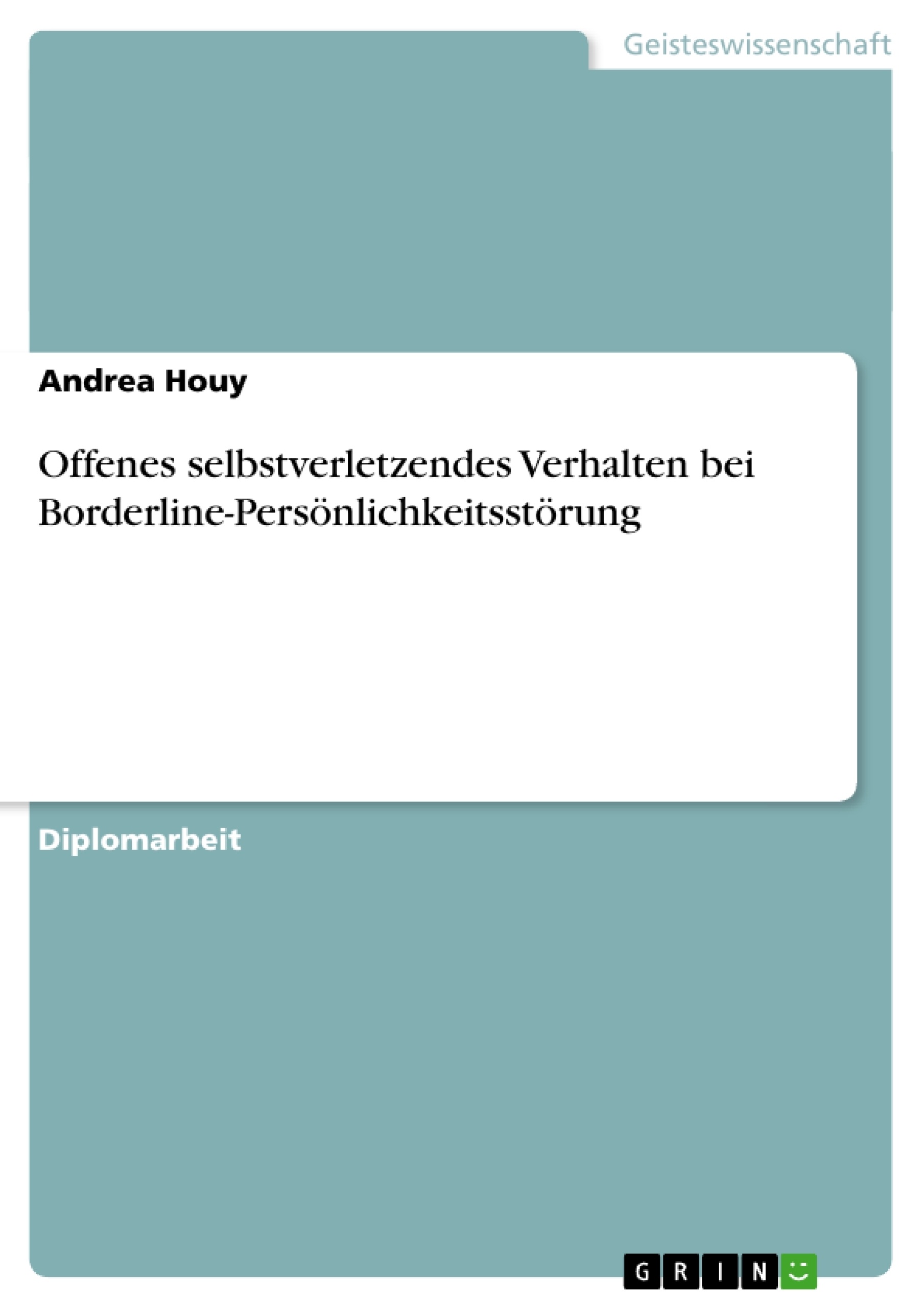Offene Selbstverletzungen sind nicht als eigenständige psychische Erkrankung aufzufassen, sondern als psychopathologische Begleitphänomene von komplexen symptomreichen Störungen, wie etwa Psychosen, Persönlichkeitsstörungen oder Essstörungen.
Wie der Titel dieser Arbeit verrät, liegt ihre Konzentration ausschließlich auf solchen Selbstverwundungen, die mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung assoziiert sind.
Vor dem Hintergrund eines sehr hohen Vorkommens dieses auffälligen Verhaltens bei Borderline-Erkrankten und der daraus resultierenden Annahme eines komplexen Zusammenhangs zwischen Grunderkrankung und Symptom soll geklärt werden, in welchem Beziehungsgefüge diese miteinander stehen bzw. inwiefern und welche die Borderline-Störung konstituierenden Faktoren für das Verständnis der Selbstverletzung relevant sind, d.h. welche Funktionen, Auswirkungen und Bedeutungen der Akt des Selbstschädigens für die Betroffenen hat.
Im Vordergrund dieser Arbeit soll damit die Spezifität mentaler Prozesse, insbesondere die bei Betroffenen weitverbreitete Problematik der Affektregulation, stehen.
Hinsichtlich der Frage nach der Entstehung dieser Erkrankung wird in Anlehnung an PARIS (2000) eine biopsychosoziale Verursachung postuliert.
Es wird aufgezeigt, dass bei der Entstehung der Borderline-Störung ein komplexes Netz verschiedener, sich wechselseitig beeinflussender Faktoren beteiligt ist. Ausgehend von den Funktionsdefiziten bei Borderline-Erkrankten und den aus empirischen Studien stammenden Informationen über „Borderline-Familien“ wird mit Hilfe von psychodynamischen, entwicklungspsychologischen und bindungstheoretischen Erkenntnissen der Versuch unternommen, diejenigen Erfahrungen eines Kindes zu ermitteln, die seine emotionale und soziale Entwicklung gefährden und dabei die Wahrscheinlichkeit, an dieser Persönlichkeitsstörung zu erkranken, erhöhen.
Die bei vielen dieser Patientinnen bestehende Neigung, sich zu verletzen, wird vor dem Hintergrund der frühkindlichen Erfahrungen und der daraus sich ergebenden Psychodynamik erklärbar. Die Annahme, dass die Selbstverletzung eng mit der Grunderkrankung verbunden ist, wird anhand einer funktionalen Analyse unter Einbeziehung von lerntheoretischen, psychoanalytischen, insbesondere bindungstheoretischen Perspektiven zu bestätigen versucht.
Die meisten der in der theoretischen Abhandlung aufgeführten psychodynamischen und funktionalen Aspekte finden sich auch im Fallbeispiel wieder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Diagnostik, Symptomatik und Komorbidität
- Prävalenz und Krankheitsbeginn
- Ätiologische Aspekte
- Biologische Befunde
- Psychologische Einflussfaktoren
- Soziale Faktoren
- Familienstudien
- Frühe Interaktionen in der Mutter-Kind-Dyade
- Spiegelung positiver Affekte und Intersubjektivität
- Containment negativer Affekte und Mentalisierung
- Bindung
- Resümierende Überlegungen
- Selbstverletzendes Verhalten
- Klassifikation, Definitionen, Übersicht
- Offene Selbstverletzung bei BPS
- Definition und Krankheitsbild
- Prävalenz und Krankheitsbeginn
- Auslöser und Ablauf der Selbstverletzung
- Psychodynamik und Funktionen selbstverletzenden Handelns
- Intrapersonale Bedeutungen und Funktionen
- Interpersonale Bedeutungen und Funktionen
- Offene Selbstverletzung bei BPS – Ein Fallbeispiel
- Biographie: Alexa B.
- Die ersten sechs Lebensjahre
- Schulzeit
- Erwachsenenalter
- Borderline: Ein Leben ohne Beständigkeit und Identität
- Pseudohalluzinationen und intensive Phantasietätigkeit
- Selbstverletzendes Verhalten
- Diskussion
- Geteilte Umwelterfahrungen
- Ungeteilte Umwelterfahrungen
- Kindheits- und Bindungserfahrungen der Eltern
- Protektive Faktoren
- Psychopathologie
- Biographie: Alexa B.
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit offenem selbstverletzendem Verhalten bei Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ziel ist es, die komplexen Zusammenhänge zwischen der Erkrankung und diesem auffälligen Verhalten zu beleuchten und die Funktionen, Auswirkungen und Bedeutungen des Selbstschädigens für die Betroffenen zu erforschen.
- Diagnostik und Symptomatik der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Prävalenz und Krankheitsbeginn von Borderline-Persönlichkeitsstörung und offenem selbstverletzendem Verhalten
- Ätiologische Faktoren, insbesondere soziale und psychologische Einflussfaktoren, die zu Borderline-Persönlichkeitsstörung und selbstverletzendem Verhalten beitragen
- Psychodynamik und Funktionen selbstverletzenden Handelns bei Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung der komplexen Zusammenhänge zwischen Borderline-Persönlichkeitsstörung und offenem selbstverletzendem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Selbstverletzung“ ein und verdeutlicht die Relevanz des Themas. Kapitel 1 bietet eine umfassende Darstellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, einschließlich ihrer Diagnostik, Symptomatik, Komorbidität, Prävalenz, Krankheitsbeginn und ätiologischen Aspekten. Besondere Aufmerksamkeit wird den sozialen Faktoren, insbesondere frühen Interaktionen in der Mutter-Kind-Dyade, gewidmet. Kapitel 2 beschäftigt sich mit selbstverletzendem Verhalten im Allgemeinen und fokussiert anschließend auf offene Selbstverletzung bei Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Prävalenz, Auslöser und Funktionen selbstverletzenden Handelns werden ausführlich behandelt. Schließlich stellt Kapitel 3 anhand eines Fallbeispiels die komplexe Beziehung zwischen Borderline-Persönlichkeitsstörung und offenem selbstverletzendem Verhalten vor. Der Fall von Alexa B. illustriert die biographischen, sozialen und psychopathologischen Faktoren, die mit der Entstehung und Aufrechterhaltung des selbstverletzenden Verhaltens zusammenhängen.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, offene Selbstverletzung, Selbstschädigung, Psychodynamik, Funktionen, Fallbeispiel, Prävalenz, Ätiologie, soziale Faktoren, Mutter-Kind-Dyade, Containment, Mentalisierung, Bindung, Interpersonale Bedeutungen.
- Citar trabajo
- Andrea Houy (Autor), 2003, Offenes selbstverletzendes Verhalten bei Borderline-Persönlichkeitsstörung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191498